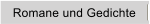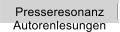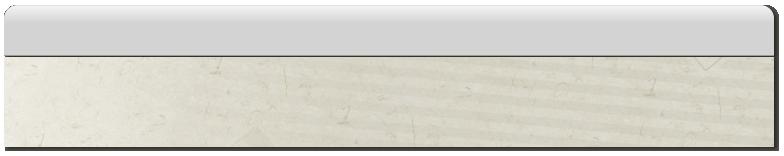


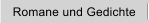

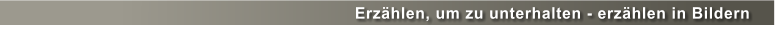
 “Plaisir d´amour” - Roman 2016
277 Seiten - Textumfang ca. 58500 Wörter
Zeit und vorwiegende Orte der Handlung: 1747 bis 1816, Freystadt, Neuburg/Donau, Straßburg,
Nancy, Paris, Lyon und wieder Paris und schließlich wieder Freystadt
ISBN: 978-3-95452-690-1 Spielberg Verlag Regensburg-Neumarkt 12,90 Euro
Den Roman können Sie bei allen Buchhandlungen, bei mehreren Internetanbietern, beim Verlag oder
beim Autor erwerben. Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Ein historisch-biografischer Roman über den Komponisten Jean Paul Egide Martini. Martini wurde
1741 in Freystadt geboren, und er verstarb 1816 in Paris. Dort brachte er es vor der Französischen
Revolution und danach als Komponist und Superintendant der königlichen Musik zu Anerkennung.
Weltruhm erlangte er mit der Kompositon des Liedes Plaisir d´amour. Der Roman erscheint zu
Martinis 200. Todestag im Januar 2016 im Spielberg Verlag Regensburg-Neumarkt. Die Stadt
Freystadt erklärt das Jahr 2016 zum Martini-Jahr.
Inhalt
Freystadt 1747. Die Mutter des 6-jährige Johann Paul Ägidius Martin stirbt. Sein Vater heiratet noch im
selben Jahr wieder. Der Bub hat fortan unter seiner Stiefmutter und seinen Halbgeschwistern zu leiden.
Seine außerordentliche musikalische Begabung ebnet dem 11-Jährigen den Weg ins Jesuitenseminar nach
Neuburg an der Donau. Dort fällt ein Mordverdacht auf ihn. Johann Paul Ägidius ist zum Priester
“Plaisir d´amour” - Roman 2016
277 Seiten - Textumfang ca. 58500 Wörter
Zeit und vorwiegende Orte der Handlung: 1747 bis 1816, Freystadt, Neuburg/Donau, Straßburg,
Nancy, Paris, Lyon und wieder Paris und schließlich wieder Freystadt
ISBN: 978-3-95452-690-1 Spielberg Verlag Regensburg-Neumarkt 12,90 Euro
Den Roman können Sie bei allen Buchhandlungen, bei mehreren Internetanbietern, beim Verlag oder
beim Autor erwerben. Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Ein historisch-biografischer Roman über den Komponisten Jean Paul Egide Martini. Martini wurde
1741 in Freystadt geboren, und er verstarb 1816 in Paris. Dort brachte er es vor der Französischen
Revolution und danach als Komponist und Superintendant der königlichen Musik zu Anerkennung.
Weltruhm erlangte er mit der Kompositon des Liedes Plaisir d´amour. Der Roman erscheint zu
Martinis 200. Todestag im Januar 2016 im Spielberg Verlag Regensburg-Neumarkt. Die Stadt
Freystadt erklärt das Jahr 2016 zum Martini-Jahr.
Inhalt
Freystadt 1747. Die Mutter des 6-jährige Johann Paul Ägidius Martin stirbt. Sein Vater heiratet noch im
selben Jahr wieder. Der Bub hat fortan unter seiner Stiefmutter und seinen Halbgeschwistern zu leiden.
Seine außerordentliche musikalische Begabung ebnet dem 11-Jährigen den Weg ins Jesuitenseminar nach
Neuburg an der Donau. Dort fällt ein Mordverdacht auf ihn. Johann Paul Ägidius ist zum Priester bestimmt. Er jedoch kann sich seine Zukunft nur als Musiker und Komponist vorstellen. 17-jährig sucht er
bei Nacht und Nebel das Weite. Erst nennt er sich Johann Paul Ägidius Schwarzendorf, später Jean Paul
Egide Martini, auch Jean Paul Egide Martini il Tedesco.
In Straßburg verlieben sich der junge, mittellose Musiker und dessen Clavierschülerin Clara unsterblich
ineinander. Doch diese Liebe scheitert an den Eltern des Mädchens. In dieser vermögenden und
angesehenen Straßburger Familie hegt man andere Pläne mit dem einzigen Sprössling, und Clara gehorcht.
Für sie komponiert er das Lied ohne Worte, die Melodie für das spätere Lied Plaisir d´amour. Martini zieht
weiter. Plaisir d´amour macht ihn über Nacht unsterblich. In Paris vermag er sich als Komponist,
Musiklehrer, Clavier- und Orgelvirtuose zu etablieren. Mit manchen seiner Opern feiert er Triumphe. Er
wird über Paris und Frankreich hinaus bekannt. Der König ernennt ihn zum Superintendanten der
königlichen Musik. Als »Le Grand Martini« bezeichnet man ihn. Er ist ganz oben angekommen, dann
überrascht ihn die Französischen Revolution. Zunächst bestätigt man ihn in seinem hohen Amt. Doch
plötzlich ist er nicht mehr gefragt und wird des Amtes enthoben. Immer wieder werden seine Hoffnungen
enttäuscht. So vergeht ein Jahr nach dem anderen. Trotz seines nach wie vor ungestillten Schaffensdrangs
glaubt Martini nicht mehr an bessere Zeiten. Ist er in Vergessenheit geraten? Martini sehnt sich nach Clara.
Es scheint, auch sie hat ihn vergessen.
Leseprobe Hans Regensburger - Plaisir d´amour - Roman
Prolog
Was kann man tun, um einen in Vergessenheit geratenen Menschen wieder ein Gesicht zu geben? Wie nähert man
bestimmt. Er jedoch kann sich seine Zukunft nur als Musiker und Komponist vorstellen. 17-jährig sucht er
bei Nacht und Nebel das Weite. Erst nennt er sich Johann Paul Ägidius Schwarzendorf, später Jean Paul
Egide Martini, auch Jean Paul Egide Martini il Tedesco.
In Straßburg verlieben sich der junge, mittellose Musiker und dessen Clavierschülerin Clara unsterblich
ineinander. Doch diese Liebe scheitert an den Eltern des Mädchens. In dieser vermögenden und
angesehenen Straßburger Familie hegt man andere Pläne mit dem einzigen Sprössling, und Clara gehorcht.
Für sie komponiert er das Lied ohne Worte, die Melodie für das spätere Lied Plaisir d´amour. Martini zieht
weiter. Plaisir d´amour macht ihn über Nacht unsterblich. In Paris vermag er sich als Komponist,
Musiklehrer, Clavier- und Orgelvirtuose zu etablieren. Mit manchen seiner Opern feiert er Triumphe. Er
wird über Paris und Frankreich hinaus bekannt. Der König ernennt ihn zum Superintendanten der
königlichen Musik. Als »Le Grand Martini« bezeichnet man ihn. Er ist ganz oben angekommen, dann
überrascht ihn die Französischen Revolution. Zunächst bestätigt man ihn in seinem hohen Amt. Doch
plötzlich ist er nicht mehr gefragt und wird des Amtes enthoben. Immer wieder werden seine Hoffnungen
enttäuscht. So vergeht ein Jahr nach dem anderen. Trotz seines nach wie vor ungestillten Schaffensdrangs
glaubt Martini nicht mehr an bessere Zeiten. Ist er in Vergessenheit geraten? Martini sehnt sich nach Clara.
Es scheint, auch sie hat ihn vergessen.
Leseprobe Hans Regensburger - Plaisir d´amour - Roman
Prolog
Was kann man tun, um einen in Vergessenheit geratenen Menschen wieder ein Gesicht zu geben? Wie nähert man sich einem solchen? Einem Mann, der vor zweihundert Jahren als Person des öffentlichen Lebens in Paris verstarb,
das hörte ich. Außerdem sagte man mir, dieser Tote sei berühmt gewesen, denn nicht ein paar Leute folgten sei-
sich einem solchen? Einem Mann, der vor zweihundert Jahren als Person des öffentlichen Lebens in Paris verstarb,
das hörte ich. Außerdem sagte man mir, dieser Tote sei berühmt gewesen, denn nicht ein paar Leute folgten sei- nem Sarg, sondern halb Paris in einem Kondukt; nicht von ungefähr ehrte ihn der nachnapoléonische König Lud-
nem Sarg, sondern halb Paris in einem Kondukt; nicht von ungefähr ehrte ihn der nachnapoléonische König Lud- wig XVIII. mit einem Staatsbegräbnis und einer letzten Ruhestätte in Père Lachaise.
Ich horchte auf, denn auf dieser Begräbnisstätte für Außergewöhnliche und Reiche sowie sicherlich auch für
wig XVIII. mit einem Staatsbegräbnis und einer letzten Ruhestätte in Père Lachaise.
Ich horchte auf, denn auf dieser Begräbnisstätte für Außergewöhnliche und Reiche sowie sicherlich auch für  Lebenskünstler und Glücksritter, doch vor allem ein letzter Ort für Komponisten, Musiker, Maler, Bildhauer,
Lebenskünstler und Glücksritter, doch vor allem ein letzter Ort für Komponisten, Musiker, Maler, Bildhauer, Dichter und Wissenschaftler ist jedes Grab auch ein Kunstwerk. Der Friedhof ein Gesamtkunstwerk, das die
Dichter und Wissenschaftler ist jedes Grab auch ein Kunstwerk. Der Friedhof ein Gesamtkunstwerk, das die Schönheit und in ihr die Künste preist und feiert. Vielleicht ein heimlicher Versuch, um dem Tode zu trotzen, der
Schönheit und in ihr die Künste preist und feiert. Vielleicht ein heimlicher Versuch, um dem Tode zu trotzen, der den Menschen gleichmachen und seinen Geist zerstäuben möchte. Père Lachaise aber scheint ihn am Entrücken ins
Sphärische zu hindern und wartet mit einer eigenen Form der Seelenwanderung und Wiedergeburt auf. Eine
den Menschen gleichmachen und seinen Geist zerstäuben möchte. Père Lachaise aber scheint ihn am Entrücken ins
Sphärische zu hindern und wartet mit einer eigenen Form der Seelenwanderung und Wiedergeburt auf. Eine Wiedergeburt in nichts als den Schönen Künsten.
Wo könnte man Nietzsches Zuversicht – ja, grenzenlose Zuversicht und nicht trostlose Einsicht –, dass der Mensch
die Künste habe, damit er an der Wahrheit nicht zugrunde gehen müsse, besser verstehen als in Père Lachaise?
Wiedergeburt in nichts als den Schönen Künsten.
Wo könnte man Nietzsches Zuversicht – ja, grenzenlose Zuversicht und nicht trostlose Einsicht –, dass der Mensch
die Künste habe, damit er an der Wahrheit nicht zugrunde gehen müsse, besser verstehen als in Père Lachaise? Wenngleich für die Franzosen dieser Ort etwas geringere Bedeutung haben mag als das Panthéon. Denn dort liegen
die Allergrößten der französischen Nation, allen voran Voltaire und Rousseau. Links und rechts am Eingang der
Wenngleich für die Franzosen dieser Ort etwas geringere Bedeutung haben mag als das Panthéon. Denn dort liegen
die Allergrößten der französischen Nation, allen voran Voltaire und Rousseau. Links und rechts am Eingang der Gruft scheinen ihre Sarkophage zu wachen, vielleicht um unablässig den Geist der Aufklärung, der Freiheit, der
Gruft scheinen ihre Sarkophage zu wachen, vielleicht um unablässig den Geist der Aufklärung, der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit anzumahnen.
Mir dämmerte, wen man meinte, und man nickte, als ich fragte, ob es sich bei jenem Vergessenen um Jean Paul
Gleichheit und der Brüderlichkeit anzumahnen.
Mir dämmerte, wen man meinte, und man nickte, als ich fragte, ob es sich bei jenem Vergessenen um Jean Paul Egide Martini handele. Nun erinnerte ich mich an meinen Besuch in Père Lachaise.
Vor einigen Jahren, es war November, schlenderte ich dort durch die Grabreihen. Plötzlich spürte ich etwas in einem
meiner Schuhe. Ein Steinchen befand sich darin. Beim Entfernen fuhr mir ein milder Windstoß durchs Haar. Denn
Egide Martini handele. Nun erinnerte ich mich an meinen Besuch in Père Lachaise.
Vor einigen Jahren, es war November, schlenderte ich dort durch die Grabreihen. Plötzlich spürte ich etwas in einem
meiner Schuhe. Ein Steinchen befand sich darin. Beim Entfernen fuhr mir ein milder Windstoß durchs Haar. Denn sogar im Schatten der Grabmäler und Mausoleen war die Luft lau. Diesen sonnigen Novembernachmittag hätte man
auch mit einem Nachmittag im Mai verwechseln können.
Damals wusste ich nicht, dass auf diesem Friedhof auch das Grab Jean Paul Egide Martinis zu finden war, dessen
sogar im Schatten der Grabmäler und Mausoleen war die Luft lau. Diesen sonnigen Novembernachmittag hätte man
auch mit einem Nachmittag im Mai verwechseln können.
Damals wusste ich nicht, dass auf diesem Friedhof auch das Grab Jean Paul Egide Martinis zu finden war, dessen  Todestag sich am 14. Februar 2016 zum 200. Mal jährt. Und wenn ich dessen Grabmal so zufällig entdeckt hätte wie
das des Lyrikers Apollinaire, wäre ich davor stehen geblieben? Gewiss! Und wie es in Père Lachaise Sitte ist, hätte
Todestag sich am 14. Februar 2016 zum 200. Mal jährt. Und wenn ich dessen Grabmal so zufällig entdeckt hätte wie
das des Lyrikers Apollinaire, wäre ich davor stehen geblieben? Gewiss! Und wie es in Père Lachaise Sitte ist, hätte ich auf dieses Grab nicht nur einen Stein gelegt, sondern auch das Steinchen aus meinem Schuh.
Man ist geneigt, selbst mit einem x-beliebigen Menschen zu wetten, dass dieser Wiederzuentdeckende aus dem Aus-
land kam, in der Provinz geboren wurde und ein Künstler war – ein Musiker und Komponist. Denn welcher
ich auf dieses Grab nicht nur einen Stein gelegt, sondern auch das Steinchen aus meinem Schuh.
Man ist geneigt, selbst mit einem x-beliebigen Menschen zu wetten, dass dieser Wiederzuentdeckende aus dem Aus-
land kam, in der Provinz geboren wurde und ein Künstler war – ein Musiker und Komponist. Denn welcher  Künstler war damals nicht Musiker und welcher Musiker nicht auch Komponist? Bände füllend all jene, die damit ihr
Auskommen suchten und so schnell vergessen wurden wie Musik im Ohr eines unmusikalischen Menschen. Hätte
Künstler war damals nicht Musiker und welcher Musiker nicht auch Komponist? Bände füllend all jene, die damit ihr
Auskommen suchten und so schnell vergessen wurden wie Musik im Ohr eines unmusikalischen Menschen. Hätte  jemand dagegengehalten, man hätte die Wette gewonnen. Tatsächlich, Martinis Wiege stand im Westen der
jemand dagegengehalten, man hätte die Wette gewonnen. Tatsächlich, Martinis Wiege stand im Westen der Oberpfalz, in Freystadt, wo ich einen Katzensprung davon entfernt geboren wurde und lebe. In Freystadt hatte
Oberpfalz, in Freystadt, wo ich einen Katzensprung davon entfernt geboren wurde und lebe. In Freystadt hatte man an seinem Geburtshaus eine Erinnerung in Stein gemeißelt und die Schule nach ihm benannt. Was ihm bislang
dort nicht zuteil werden konnte war, ihn aus der Finsternis der Archive zu befreien, ihm wieder Leben
man an seinem Geburtshaus eine Erinnerung in Stein gemeißelt und die Schule nach ihm benannt. Was ihm bislang
dort nicht zuteil werden konnte war, ihn aus der Finsternis der Archive zu befreien, ihm wieder Leben einzuhauchen, um ihn für jedermann erleb- und fassbar zu machen, spätestens im Gedenk-jahr 2016.
Im Spitalcafé in Freystadt bei Bier und Wein schien man einen solchen Zustand herbeizusehnen und wusste nicht,
einzuhauchen, um ihn für jedermann erleb- und fassbar zu machen, spätestens im Gedenk-jahr 2016.
Im Spitalcafé in Freystadt bei Bier und Wein schien man einen solchen Zustand herbeizusehnen und wusste nicht, wie man ihn herbeiführen konnte. Man hatte ja bereits über die steinerne Erinnerungstafel am Geburtshaus und die
Namensgebung der Schule hinaus einiges dafür getan: so manches aus Martinis Œuvre aufgeführt. – Eine große,
wie man ihn herbeiführen konnte. Man hatte ja bereits über die steinerne Erinnerungstafel am Geburtshaus und die
Namensgebung der Schule hinaus einiges dafür getan: so manches aus Martinis Œuvre aufgeführt. – Eine große,  feierliche Messe in der Wallfahrtskirche, dort und andernorts Musik aus seinen Opern, einige Sinfonien und immer
feierliche Messe in der Wallfahrtskirche, dort und andernorts Musik aus seinen Opern, einige Sinfonien und immer und immer wieder Plaisir d´amour – sein unsterbliches Lied. Möglicherweise das Lied seines Lebens. Ein Lied, so
und immer wieder Plaisir d´amour – sein unsterbliches Lied. Möglicherweise das Lied seines Lebens. Ein Lied, so morbide und schön wie Lili Marleen. Eine Poesie, ein Mikrokosmos seiner 75 Lebensjahre – vielleicht. Wenn
morbide und schön wie Lili Marleen. Eine Poesie, ein Mikrokosmos seiner 75 Lebensjahre – vielleicht. Wenn überhaupt, wollte ich diesen wenigen Minuten großer Kunst nachspüren, um in ihr den Schöpfer und Menschen zu
entdecken, den ich eigentlich nicht entdecken wollte. Einen Opportunisten – doch vielleicht notgedrungen, wer
überhaupt, wollte ich diesen wenigen Minuten großer Kunst nachspüren, um in ihr den Schöpfer und Menschen zu
entdecken, den ich eigentlich nicht entdecken wollte. Einen Opportunisten – doch vielleicht notgedrungen, wer weiß.
Die Kultur- und Kunstliebhaberinnen Ursula Steinert und Marie Luise Karl überraschten mich in dieser geselligen
weiß.
Die Kultur- und Kunstliebhaberinnen Ursula Steinert und Marie Luise Karl überraschten mich in dieser geselligen  Runde mit der Idee, ich möge einen Roman über diesen Künstler schreiben. Ich erschrak. Dessen ungeachtet soli-
Runde mit der Idee, ich möge einen Roman über diesen Künstler schreiben. Ich erschrak. Dessen ungeachtet soli- darisierte sich Willibald Gailler, der Bürgermeister von Freystadt, mit diesem Gedanken. Fortan schien es für mich
darisierte sich Willibald Gailler, der Bürgermeister von Freystadt, mit diesem Gedanken. Fortan schien es für mich  kein Zurück mehr zu geben. Nun heftete sich dieser Künstler wie ein Schatten an meine Fersen. Ein ständiger
kein Zurück mehr zu geben. Nun heftete sich dieser Künstler wie ein Schatten an meine Fersen. Ein ständiger Begleiter, den ich weder abschütteln konnte noch wollte; dennoch ein lästiger Verfolger, der mir nicht ganz geheuer
war. Ich liebäugelte mit dem Wunsch, wie einst Peter Schlemihl, so möge auch mir eine Person begegnen, die
Begleiter, den ich weder abschütteln konnte noch wollte; dennoch ein lästiger Verfolger, der mir nicht ganz geheuer
war. Ich liebäugelte mit dem Wunsch, wie einst Peter Schlemihl, so möge auch mir eine Person begegnen, die Schatten kaufe. Doch in Erinnerung an Schlemihls Schicksal war mir dieser Schatten tausendmal wertvoller als der
Ertrag seiner Veräußerung – eine Börse mit Gold, die nie leer wird. Dass ich das ungeachtet dessen nicht tun würde,
war so gewiss wie die Wahrmachung dieses Bildes unmöglich. Doch konnte ich mich an diesen Schatten gewöhnen
oder gar mit ihm anfreunden und an welchem Ort, wenn es denn schon sein musste? Paris oder Freystadt standen
Schatten kaufe. Doch in Erinnerung an Schlemihls Schicksal war mir dieser Schatten tausendmal wertvoller als der
Ertrag seiner Veräußerung – eine Börse mit Gold, die nie leer wird. Dass ich das ungeachtet dessen nicht tun würde,
war so gewiss wie die Wahrmachung dieses Bildes unmöglich. Doch konnte ich mich an diesen Schatten gewöhnen
oder gar mit ihm anfreunden und an welchem Ort, wenn es denn schon sein musste? Paris oder Freystadt standen zur Wahl, was sonst. Ich favorisierte Paris. Von dort wollte ich, reich an Abenteuern, im Gedenkjahr 2016 den
zur Wahl, was sonst. Ich favorisierte Paris. Von dort wollte ich, reich an Abenteuern, im Gedenkjahr 2016 den großen Sohn nach Freystadt heimholen – zwischen zwei Buchdeckeln als Held eines Romans. Bevor ich mich spät
in der Nacht schlafen legte, ging ich zum Geburtshaus des Komponisten. Dort vergewisserte ich mich, was auf der
steinernen Tafel geschrieben stand. Zum ersten Mal wunderte ich mich über dessen französische Vornamen und den
italienischen Familiennamen.
Ich kehrte nach Hause zurück und las in meinem spärlichen Fundus, dass er seine Vornamen französisch und seinen
Familiennamen italienisch naturalisiert hatte. So war aus dem am 31. August 1741 in Freystadt zur Welt gekom-
großen Sohn nach Freystadt heimholen – zwischen zwei Buchdeckeln als Held eines Romans. Bevor ich mich spät
in der Nacht schlafen legte, ging ich zum Geburtshaus des Komponisten. Dort vergewisserte ich mich, was auf der
steinernen Tafel geschrieben stand. Zum ersten Mal wunderte ich mich über dessen französische Vornamen und den
italienischen Familiennamen.
Ich kehrte nach Hause zurück und las in meinem spärlichen Fundus, dass er seine Vornamen französisch und seinen
Familiennamen italienisch naturalisiert hatte. So war aus dem am 31. August 1741 in Freystadt zur Welt gekom- menen Johann Paul Ägidius Martin später in Frankreich ein Jean Paul Egide Martini geworden. Wie ich vermutete:
menen Johann Paul Ägidius Martin später in Frankreich ein Jean Paul Egide Martini geworden. Wie ich vermutete: ein Opportunist. Doch ein weiterer Blick in die Liste seiner Lebensdaten belehrte mich eines Besseren: Martini war
kaum sechs, da starb seine Mutter. – Deshalb ein Leidtragender und vielleicht bald schon ein doppelt Leidtragender,
weil ihm noch im Todesjahr seiner Mutter eine Stiefmutter zugemutet wurde.
Wer wollte darüber den Kopf schütteln, dass er fünf Jahre später keine Träne vergoss, als man ihn ins Seminar zu
ein Opportunist. Doch ein weiterer Blick in die Liste seiner Lebensdaten belehrte mich eines Besseren: Martini war
kaum sechs, da starb seine Mutter. – Deshalb ein Leidtragender und vielleicht bald schon ein doppelt Leidtragender,
weil ihm noch im Todesjahr seiner Mutter eine Stiefmutter zugemutet wurde.
Wer wollte darüber den Kopf schütteln, dass er fünf Jahre später keine Träne vergoss, als man ihn ins Seminar zu den Jesuiten nach Neuburg an der Donau schickte. Im Bett liegend versuchte ich mich mit der Vorstellung
den Jesuiten nach Neuburg an der Donau schickte. Im Bett liegend versuchte ich mich mit der Vorstellung anzufreunden, damals in Père Lachaise doch sein Grab gesucht und gefunden zu haben. Reumütig und das Gerippe
von Martinis Lebens- und Schaffensdaten in Erinnerung rufend, ersehnte ich den Schlaf. Wie würde ich so bewehrt
und befrachtet schlafen können und aufwachen?, vielleicht mich in diesen Mann hineinträumen, wohlwissend, dass
man über seine Träume keine Macht hat. Ich legte mich auf meine Einschlafseite, schloss die Augen und verkroch
anzufreunden, damals in Père Lachaise doch sein Grab gesucht und gefunden zu haben. Reumütig und das Gerippe
von Martinis Lebens- und Schaffensdaten in Erinnerung rufend, ersehnte ich den Schlaf. Wie würde ich so bewehrt
und befrachtet schlafen können und aufwachen?, vielleicht mich in diesen Mann hineinträumen, wohlwissend, dass
man über seine Träume keine Macht hat. Ich legte mich auf meine Einschlafseite, schloss die Augen und verkroch mich im Oberbett. Plötzlich erschien vor meinem inneren Auge Martinis Portrait. Ein Haupt mit Perücke, ein breiter
Schädel, ein selbstgefälliger Blick. »Unbeirrt und protzig«, dachte ich. Und obwohl es nicht Martinis Epoche war,
mich im Oberbett. Plötzlich erschien vor meinem inneren Auge Martinis Portrait. Ein Haupt mit Perücke, ein breiter
Schädel, ein selbstgefälliger Blick. »Unbeirrt und protzig«, dachte ich. Und obwohl es nicht Martinis Epoche war,  kamen nach und nach Bilder des Renaissancemenschen hinzu. So wie diese ihre Einzigartigkeit, Selbstgewissheit und
Schönheit feierten, pflegten sie auch die Melancholie: die Haltung des in sich gekehrten Suchers. Eine Lebens- und
Leidensform, die damals die Künstler, Kaiser und Könige für sich beanspruchten; Menschen, die sich selbst
kamen nach und nach Bilder des Renaissancemenschen hinzu. So wie diese ihre Einzigartigkeit, Selbstgewissheit und
Schönheit feierten, pflegten sie auch die Melancholie: die Haltung des in sich gekehrten Suchers. Eine Lebens- und
Leidensform, die damals die Künstler, Kaiser und Könige für sich beanspruchten; Menschen, die sich selbst entdeckt und die Ernsthaftigkeit ihrer Existenz verinnerlicht hatten und darauf stolz waren. Von alldem keine Spur
in Martinis Gesicht. Mir erschien es so selbstgefällig und unernst wie die Kette seines französisch und italienisch
entdeckt und die Ernsthaftigkeit ihrer Existenz verinnerlicht hatten und darauf stolz waren. Von alldem keine Spur
in Martinis Gesicht. Mir erschien es so selbstgefällig und unernst wie die Kette seines französisch und italienisch naturalisierten Namens, der mir stereotyp durch den Kopf geisterte. Ich hoffte, dass ich bald einschlafen und diesen
Martini für immer vergessen würde. Doch es kam anders. Wusste ich denn nicht, dass man keine Macht über seine
naturalisierten Namens, der mir stereotyp durch den Kopf geisterte. Ich hoffte, dass ich bald einschlafen und diesen
Martini für immer vergessen würde. Doch es kam anders. Wusste ich denn nicht, dass man keine Macht über seine Träume hat? Zuhörer und Begleiter wurde ich, Zeuge von Martinis Zwiesprache mit sich. Er legte von sich
Träume hat? Zuhörer und Begleiter wurde ich, Zeuge von Martinis Zwiesprache mit sich. Er legte von sich Rechenschaft ab. Denn trotz der Komposition von Revolutionsliedern und Militärmusik, trotz der Hymne auf die
Rechenschaft ab. Denn trotz der Komposition von Revolutionsliedern und Militärmusik, trotz der Hymne auf die Republik, trotz mancher Ergebenheitsadressen und Loyalitätsbezeugungen für den neuen Staat – die Französische
Republik, trotz mancher Ergebenheitsadressen und Loyalitätsbezeugungen für den neuen Staat – die Französische Republik und das Französische Kaiserreich – verlor er 1792 das Amt des Generalmusikdirektors und 1802 seine
Republik und das Französische Kaiserreich – verlor er 1792 das Amt des Generalmusikdirektors und 1802 seine Stellung als Inspekteur des Musikkonservatoriums von Paris, die er 1796 erhalten hatte. Offenbar hatte man dem
Stellung als Inspekteur des Musikkonservatoriums von Paris, die er 1796 erhalten hatte. Offenbar hatte man dem neuen Herrscher hintertragen, dass er vor dem 14. Juli 1789 dem verhassten König zu Diensten gewesen sei.
neuen Herrscher hintertragen, dass er vor dem 14. Juli 1789 dem verhassten König zu Diensten gewesen sei.  Dieser intime Zustand von Martinis Erzählen strafte sein angebliches Abbild – unmöglich auch Portrait – samt
Dieser intime Zustand von Martinis Erzählen strafte sein angebliches Abbild – unmöglich auch Portrait – samt Maler Lügen. Es schien, Martini war froh, mich an seiner Seite zu wissen. In mir hatte er jemanden gefunden, dem
Maler Lügen. Es schien, Martini war froh, mich an seiner Seite zu wissen. In mir hatte er jemanden gefunden, dem er alles anvertrauen konnte, ohne der Schönfärberei anheimzufallen, etwas verbergen und lügen zu müssen. So wie
er alles anvertrauen konnte, ohne der Schönfärberei anheimzufallen, etwas verbergen und lügen zu müssen. So wie er zu mir sprach, sprach er zu sich. Martini blickte weit in sein Leben zurück und erzählte.
1760 – Nach Straßburg geraten – als 19-Jähriger (6. Kapitel)
Eigentlich war Nancy mein Ziel und nicht Straßburg. Vor diesem Sinneswandel, der in Colmar plötzlich über mich
er zu mir sprach, sprach er zu sich. Martini blickte weit in sein Leben zurück und erzählte.
1760 – Nach Straßburg geraten – als 19-Jähriger (6. Kapitel)
Eigentlich war Nancy mein Ziel und nicht Straßburg. Vor diesem Sinneswandel, der in Colmar plötzlich über mich kam, hatten mich Zweifel heimgesucht. Trotz meines Ziels überwog plötzlich das Gefühl, ziellos unterwegs zu sein,
beim Zechen falschen Versprechungen auf den Leim gegangen zu sein. Wieder wurde mein Geld knapp. Würde es
noch bis Nancy reichen? Ich scheute mich davor, meine Börse zu stürzen und es nachzuzählen. Was nutzte mir in
kam, hatten mich Zweifel heimgesucht. Trotz meines Ziels überwog plötzlich das Gefühl, ziellos unterwegs zu sein,
beim Zechen falschen Versprechungen auf den Leim gegangen zu sein. Wieder wurde mein Geld knapp. Würde es
noch bis Nancy reichen? Ich scheute mich davor, meine Börse zu stürzen und es nachzuzählen. Was nutzte mir in dieser vertrackten Lage – angesichts meines schmalen Geldbeutels – die dicke Mappe mit meinen ersten
dieser vertrackten Lage – angesichts meines schmalen Geldbeutels – die dicke Mappe mit meinen ersten Kompositionen? Würde ich in Nancy überhaupt den Baron de Rondad finden oder würde sich dieser hohe Beamte
und Musikenthusiast am Hofe Herzogs Stanislas von Lothringen dort gar als Erfindung erweisen? Der Baron habe
Kompositionen? Würde ich in Nancy überhaupt den Baron de Rondad finden oder würde sich dieser hohe Beamte
und Musikenthusiast am Hofe Herzogs Stanislas von Lothringen dort gar als Erfindung erweisen? Der Baron habe das Ohr des Herzogs, hatte ein Frankreichreisender behauptet. Mit ihm war ich in einer Freiburger
das Ohr des Herzogs, hatte ein Frankreichreisender behauptet. Mit ihm war ich in einer Freiburger  Studentenschenke ins Gespräch gekommen. Er, der Baron, könne mir den Konzertsaal des Herzogs öffnen und
Studentenschenke ins Gespräch gekommen. Er, der Baron, könne mir den Konzertsaal des Herzogs öffnen und gewiss auch die Orgelempore von dessen Hofkirche. Erneut bestellte ich für ihn und mich Bier. Immer wieder hob
er an diesem feucht-fröhlichen Abend seinen Krug und stieß mit mir auf meine Zukunft als großer Musiker und
gewiss auch die Orgelempore von dessen Hofkirche. Erneut bestellte ich für ihn und mich Bier. Immer wieder hob
er an diesem feucht-fröhlichen Abend seinen Krug und stieß mit mir auf meine Zukunft als großer Musiker und Komponist an. Doch so wie mein Glaube schwand, in die Residenz des musikbesessenen Herzogs mithilfe des
Komponist an. Doch so wie mein Glaube schwand, in die Residenz des musikbesessenen Herzogs mithilfe des Barons de Rondad Eingang zu finden, konnte ich nun meinen Verdacht nicht mehr abschütteln, dass dieser
Barons de Rondad Eingang zu finden, konnte ich nun meinen Verdacht nicht mehr abschütteln, dass dieser herzogliche Beamte auf einer freien Erfindung beruhte, ich einst in Freiburg beim siebten, achten Krug Bier zum
herzogliche Beamte auf einer freien Erfindung beruhte, ich einst in Freiburg beim siebten, achten Krug Bier zum Besten gehalten wurde. Das süffisante Lächeln, der hinterhältige Augenaufschlag dieses Frankreichreisenden
Besten gehalten wurde. Das süffisante Lächeln, der hinterhältige Augenaufschlag dieses Frankreichreisenden schienen mir dafür Beweis genug zu sein. Waren diese Beobachtungen urplötzlich aus meiner Erinnerung erwacht
schienen mir dafür Beweis genug zu sein. Waren diese Beobachtungen urplötzlich aus meiner Erinnerung erwacht oder lediglich meiner Phantasie entsprungen? Setzte ich mich mit Tatsachen auseinander oder sah ich Gespenster?
Einerlei, meine Zuversicht war dahin. Ich bereute, während der beiden Jahre in Freiburg mit meinen Kompositionen
mehr Zeit verbracht zu haben als an der einen oder anderen Kirchenorgel und der Unterweisung von Schülern. Nun
trauerte ich dem Geld nach, das mir der Dienst als Organist und Kantor zusätzlich eingebracht hätte. In Freiburg
oder lediglich meiner Phantasie entsprungen? Setzte ich mich mit Tatsachen auseinander oder sah ich Gespenster?
Einerlei, meine Zuversicht war dahin. Ich bereute, während der beiden Jahre in Freiburg mit meinen Kompositionen
mehr Zeit verbracht zu haben als an der einen oder anderen Kirchenorgel und der Unterweisung von Schülern. Nun
trauerte ich dem Geld nach, das mir der Dienst als Organist und Kantor zusätzlich eingebracht hätte. In Freiburg und Umgebung hatte ich vor allem bei den Protestanten so manchen Organistendienst leichtfertig ausgeschlagen,
und Umgebung hatte ich vor allem bei den Protestanten so manchen Organistendienst leichtfertig ausgeschlagen, den einen oder anderen Orgelschüler hochnäsig abgewiesen.
Geknickt stieg ich in Colmar aus der Postkutsche und folgte den anderen Reisenden zur Posthalterei. Unter dem
den einen oder anderen Orgelschüler hochnäsig abgewiesen.
Geknickt stieg ich in Colmar aus der Postkutsche und folgte den anderen Reisenden zur Posthalterei. Unter dem Druck in meiner Brust verharrte mein Blick auf dem zerklüfteten Pflaster, worüber vor und hinter mir einige Frauen
jammerten und schimpften. Trotz der nahen Nacht und meines knurrenden Magens hätte ich am liebsten vor der
Druck in meiner Brust verharrte mein Blick auf dem zerklüfteten Pflaster, worüber vor und hinter mir einige Frauen
jammerten und schimpften. Trotz der nahen Nacht und meines knurrenden Magens hätte ich am liebsten vor der Wirtshaustür meinen Schritt gewendet und wäre zu Fuß nach Freiburg zurückgekehrt. Ich fühlte mich nicht mehr
Wirtshaustür meinen Schritt gewendet und wäre zu Fuß nach Freiburg zurückgekehrt. Ich fühlte mich nicht mehr frei wie ein Vogel, sondern vogelfrei – verloren. Kaum, dass ich mich in der Wirtstube der Posthalterei an einen
frei wie ein Vogel, sondern vogelfrei – verloren. Kaum, dass ich mich in der Wirtstube der Posthalterei an einen Tisch gezwängt hatte, horchte ich auf. Was hatte ich trotz des lauten Durcheinanders, das dort herrschte, soeben aus
einem Gespräch zweier Männer aufgeschnappt? Ich sah auf. Etwa eineinhalb Armlängen vor mir saßen zwei Chor-
herren mit mir am Tisch. Sie bestellten bei der dunkelhaarigen Kellnerin Wein, Brot, Butter und geselchten
Tisch gezwängt hatte, horchte ich auf. Was hatte ich trotz des lauten Durcheinanders, das dort herrschte, soeben aus
einem Gespräch zweier Männer aufgeschnappt? Ich sah auf. Etwa eineinhalb Armlängen vor mir saßen zwei Chor-
herren mit mir am Tisch. Sie bestellten bei der dunkelhaarigen Kellnerin Wein, Brot, Butter und geselchten Schinken. Als die blutjunge Frau mich ansah und fragte, was ich wünsche, begnügte ich mich mit Bier und Butter-
Schinken. Als die blutjunge Frau mich ansah und fragte, was ich wünsche, begnügte ich mich mit Bier und Butter- broten. »Den Schnittlauch nicht vergessen!«, rief ich ihr hinterher. Dann kreiste das Gespräch der Geistlichen
broten. »Den Schnittlauch nicht vergessen!«, rief ich ihr hinterher. Dann kreiste das Gespräch der Geistlichen wieder um jenes Thema, das mich kurz zuvor aus meiner Niedergeschlagenheit gerissen hatte. Erneut beklagten sie
die über Nacht eingetretene Vakanz der Ersten Hilfsorganistenstelle am Straßburger Münster. Sie wünschten jenem
Verliebten, der mit einer Straßburger Bürgerstochter bei Nacht und Nebel durchgebrannt sei, die Pest an den Hals.
Bald darauf runzelte einer von ihnen seine Stirn und der andere warf die Frage auf, ob sich mit jenem Talent im
wieder um jenes Thema, das mich kurz zuvor aus meiner Niedergeschlagenheit gerissen hatte. Erneut beklagten sie
die über Nacht eingetretene Vakanz der Ersten Hilfsorganistenstelle am Straßburger Münster. Sie wünschten jenem
Verliebten, der mit einer Straßburger Bürgerstochter bei Nacht und Nebel durchgebrannt sei, die Pest an den Hals.
Bald darauf runzelte einer von ihnen seine Stirn und der andere warf die Frage auf, ob sich mit jenem Talent im Badischen, zu dem sie unterwegs seien, diese Lücke wieder füllen lasse. »Nichts wie hin nach Straßburg!«, sagte ich
mir.
Und tatsächlich kam ich dort den beiden mit ihrem Kandidaten um drei Wochen zuvor. Als dieser mein Spiel hörte,
konnte ihn die hohe Geistlichkeit des Münsters am nächsten Tag in ganz Straßburg nicht mehr ausfindig machen.
Badischen, zu dem sie unterwegs seien, diese Lücke wieder füllen lasse. »Nichts wie hin nach Straßburg!«, sagte ich
mir.
Und tatsächlich kam ich dort den beiden mit ihrem Kandidaten um drei Wochen zuvor. Als dieser mein Spiel hörte,
konnte ihn die hohe Geistlichkeit des Münsters am nächsten Tag in ganz Straßburg nicht mehr ausfindig machen.  So wie ich meinen Kontrahenten mit meiner Kunst an der Orgel in die Flucht geschlagen hatte, zog sie im Laufe der
Zeit Madame Edlinger an. Sie hatte mit ihrer Mutter beinahe täglich im Münster die Messe besucht. Wie sie mir
So wie ich meinen Kontrahenten mit meiner Kunst an der Orgel in die Flucht geschlagen hatte, zog sie im Laufe der
Zeit Madame Edlinger an. Sie hatte mit ihrer Mutter beinahe täglich im Münster die Messe besucht. Wie sie mir später erzählte, war sie eines Tages hellhörig geworden. Just an diesem Morgen spielte ich dort meine erste Messe.
später erzählte, war sie eines Tages hellhörig geworden. Just an diesem Morgen spielte ich dort meine erste Messe. Mit der Zeit fand Madame Edlinger heraus, dass ich – jener Neue – vor allem werktags beim Siebenuhrgottesdienst
in die Tasten griff und das Pedal traktierte. Schnell war in ihr der Entschluss gereift, an mich heranzutreten. Zu
Mit der Zeit fand Madame Edlinger heraus, dass ich – jener Neue – vor allem werktags beim Siebenuhrgottesdienst
in die Tasten griff und das Pedal traktierte. Schnell war in ihr der Entschluss gereift, an mich heranzutreten. Zu diesem Zweck hatte sie noch während der Messe ihren Hausdiener und Kutscher, einen liebenswürdigen alten
diesem Zweck hatte sie noch während der Messe ihren Hausdiener und Kutscher, einen liebenswürdigen alten Mann, zu mir auf die Schwalbennestorgel des Münsters beordert. Und ich staunte, was ich auf dem schmucken
Mann, zu mir auf die Schwalbennestorgel des Münsters beordert. Und ich staunte, was ich auf dem schmucken Billett der vornehmen Frau Edlinger las, das ich plötzlich auf dem Notenpult sah. Nach dem Auszug führte mich
Billett der vornehmen Frau Edlinger las, das ich plötzlich auf dem Notenpult sah. Nach dem Auszug führte mich der gebeugte Alte zu seiner Herrin. Sie erwartete mich vor dem Münster.
»Mein Herr, auf ein Wort.« In ihrer Begleitung befand sich eine ältere Dame, ihre Mutter, wie ich angesichts der
der gebeugte Alte zu seiner Herrin. Sie erwartete mich vor dem Münster.
»Mein Herr, auf ein Wort.« In ihrer Begleitung befand sich eine ältere Dame, ihre Mutter, wie ich angesichts der  Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge sofort richtig vermutet hatte. Ich lüftete meinen Dreispitz und erwiderte:
Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge sofort richtig vermutet hatte. Ich lüftete meinen Dreispitz und erwiderte: »Mesdames, Euer ergebener Diener!«
»Seit Euerer ersten Messe rätseln meine Frau Mutter und ich, welch großer Künstler plötzlich die Orgel spiele.«
»Mesdames, Euer ergebener Diener!«
»Seit Euerer ersten Messe rätseln meine Frau Mutter und ich, welch großer Künstler plötzlich die Orgel spiele.« Dieses Lob machte mich sprachlos. Ich errötete. »O Gott, wie jung Ihr noch seid – so unschuldig jung«, erschrak
Dieses Lob machte mich sprachlos. Ich errötete. »O Gott, wie jung Ihr noch seid – so unschuldig jung«, erschrak ihre Mutter, eine Frau, von keineswegs kleinem und zartem Wuchs. Allein der Aufzug der beiden Damen verriet
ihre Mutter, eine Frau, von keineswegs kleinem und zartem Wuchs. Allein der Aufzug der beiden Damen verriet ihre Eleganz und wohl auch ihren Reichtum, noch mehr die zweispännige Kalesche, die ich im Schatten des
ihre Eleganz und wohl auch ihren Reichtum, noch mehr die zweispännige Kalesche, die ich im Schatten des Münsters sah.
»Ich bin neunzehn, bald zwanzig, Madame«, erwiderte ich und stellte mich vor. Beide Damen wurden nicht müde,
Münsters sah.
»Ich bin neunzehn, bald zwanzig, Madame«, erwiderte ich und stellte mich vor. Beide Damen wurden nicht müde, mich mit Komplimenten zu überhäufen. »Meine Frau Mut-ter und ich sind längst nicht mehr die Einzigen, die Euch
bewundern«, sagte die Jüngere. »Nach jeder Messe wird die Schar Euerer Anhänger größer«, so die Ältere. Als
mich mit Komplimenten zu überhäufen. »Meine Frau Mut-ter und ich sind längst nicht mehr die Einzigen, die Euch
bewundern«, sagte die Jüngere. »Nach jeder Messe wird die Schar Euerer Anhänger größer«, so die Ältere. Als Ausdruck meiner Freude nahm ich meinen Dreispitz ab, schwang mit ihm eine Luftwelle und verneigte mich. »Euer
Diener, Mesdames – ganz Euer ergebener Diener!«
»Ihr könnt wahrlich die Orgel traktieren…, o nein: spielen wie nur wenige und gewiss genauso bravourös das
Ausdruck meiner Freude nahm ich meinen Dreispitz ab, schwang mit ihm eine Luftwelle und verneigte mich. »Euer
Diener, Mesdames – ganz Euer ergebener Diener!«
»Ihr könnt wahrlich die Orgel traktieren…, o nein: spielen wie nur wenige und gewiss genauso bravourös das Clavier!«, meinte die Jüngere und schwenkte ihr Schirmchen vors Gesicht, worauf die Sonne geschienen hatte.
Clavier!«, meinte die Jüngere und schwenkte ihr Schirmchen vors Gesicht, worauf die Sonne geschienen hatte.  »Nun…«, äußerte ich und versuchte mich meiner erneuten Sprachlosigkeit zu entwinden.
»Mein guter Gatte beschenkte unsere geliebte Clara zu dero 16. Geburtstag mit einem Clavier neuerster Machart«,
»Nun…«, äußerte ich und versuchte mich meiner erneuten Sprachlosigkeit zu entwinden.
»Mein guter Gatte beschenkte unsere geliebte Clara zu dero 16. Geburtstag mit einem Clavier neuerster Machart«, hob sie an. ... Ihr Anblick verschlug mir die Sprache. Clara hatte glattes, blondes Haar, ihre Augen waren hellblau
und ihre Nase etwas breit, doch unaufdringlich. Claras Wuchs war schmal und hoch. Ihr breites Lachen, das
hob sie an. ... Ihr Anblick verschlug mir die Sprache. Clara hatte glattes, blondes Haar, ihre Augen waren hellblau
und ihre Nase etwas breit, doch unaufdringlich. Claras Wuchs war schmal und hoch. Ihr breites Lachen, das plötzlich in ihrem Gesicht erstrahlte, nahm mir im Nu die Angst, die mir ihre engelsgleiche und unnahbare Aura
plötzlich in ihrem Gesicht erstrahlte, nahm mir im Nu die Angst, die mir ihre engelsgleiche und unnahbare Aura bereits untergeschoben hatte. Als ich sie zu ihrem Namenstag beglückwünschen wollte, brachte ich dennoch nur ein
Stammeln über meine Lippen. Flugs erkannte sie meine Notlage und stand mir bei: »Ich bin so froh, mit Euerer
bereits untergeschoben hatte. Als ich sie zu ihrem Namenstag beglückwünschen wollte, brachte ich dennoch nur ein
Stammeln über meine Lippen. Flugs erkannte sie meine Notlage und stand mir bei: »Ich bin so froh, mit Euerer Kunst am Clavier zum Namenstag beschenkt zu werden.« Sie nahm mich beiseite und ging mit mir ein Stück – stahl
sich mit mir in die Schar der Gäste. Niemand nahm von uns Notiz. Eingenebelt von der Namenstagsgesellschaft
Kunst am Clavier zum Namenstag beschenkt zu werden.« Sie nahm mich beiseite und ging mit mir ein Stück – stahl
sich mit mir in die Schar der Gäste. Niemand nahm von uns Notiz. Eingenebelt von der Namenstagsgesellschaft und dem Geschwirr ihrer Plaudereien und Gelächter, schienen Clara und ich vor ihr verborgen zu sein. »Nun kann
und dem Geschwirr ihrer Plaudereien und Gelächter, schienen Clara und ich vor ihr verborgen zu sein. »Nun kann ich es kaum mehr erwarten, Euch an diesem schönen Instrument zu erleben«, sagte sie. Dabei versuchte sie mir
ich es kaum mehr erwarten, Euch an diesem schönen Instrument zu erleben«, sagte sie. Dabei versuchte sie mir etwas zu sagen, doch sie kam gegen ihr Kichern nicht an. »Ich alter Kindskopf hätte es wenigstens ahnen müssen«,
brachte sie schließlich unter Tränen heraus, »dass Ihr, Herr Martin, Mamas und Papas Überraschung seid. Hatten sie
doch zuvor Euer Können an der Orgel und am Clavier in den höchsten Tönen gelobt. Mama war hingerissen. Sie
etwas zu sagen, doch sie kam gegen ihr Kichern nicht an. »Ich alter Kindskopf hätte es wenigstens ahnen müssen«,
brachte sie schließlich unter Tränen heraus, »dass Ihr, Herr Martin, Mamas und Papas Überraschung seid. Hatten sie
doch zuvor Euer Können an der Orgel und am Clavier in den höchsten Tönen gelobt. Mama war hingerissen. Sie meinte gar, Euere Musik und Euer Musizieren gleiche einem Wunder. Als sie sah, was Euere Finger mit den Tasten
anstellten, konnte sie nur noch staunen.« Nun war auch mein Verdruss wie weggeblasen. Er hatte mich ereilt, kaum
dass ich meinen Fuß über die Schwelle des Palais Edlinger gesetzt hatte. Zu meinem Entsetzen teilte mir der
meinte gar, Euere Musik und Euer Musizieren gleiche einem Wunder. Als sie sah, was Euere Finger mit den Tasten
anstellten, konnte sie nur noch staunen.« Nun war auch mein Verdruss wie weggeblasen. Er hatte mich ereilt, kaum
dass ich meinen Fuß über die Schwelle des Palais Edlinger gesetzt hatte. Zu meinem Entsetzen teilte mir der Haushofmeister mit, dass ich während meines Auftritts eine Livree zu tragen habe. »Die gleiche wie die
Haushofmeister mit, dass ich während meines Auftritts eine Livree zu tragen habe. »Die gleiche wie die Dienerschaft im Palais Edlinger«, betonte er. Meinen neuen blauen Rock und schneeweißen Kragen, meine neue
Dienerschaft im Palais Edlinger«, betonte er. Meinen neuen blauen Rock und schneeweißen Kragen, meine neue hellgraue Weste, meine neuen dunkelgrauen Hosen und beigen Strümpfe und meine Perücke musste ich ablegen
hellgraue Weste, meine neuen dunkelgrauen Hosen und beigen Strümpfe und meine Perücke musste ich ablegen und dieses steife, uniforme Mausgrau mit seinen gelben Bordüren anlegen. Allein meine neuen Schuhe durfte ich
und dieses steife, uniforme Mausgrau mit seinen gelben Bordüren anlegen. Allein meine neuen Schuhe durfte ich wieder anziehen, doch nur, weil der Haushofmeister im Gewandmagazin des Personals für mich keine passenden
wieder anziehen, doch nur, weil der Haushofmeister im Gewandmagazin des Personals für mich keine passenden gefunden hatte. Es dauerte einige Zeit, bis er sich endlich mit meinen braunen abfinden wollte. Ich schüttelte den
gefunden hatte. Es dauerte einige Zeit, bis er sich endlich mit meinen braunen abfinden wollte. Ich schüttelte den Kopf, vor allem über mich. Hatte ich mir doch in wenigen Tagen meine neuen Sachen machen lassen und mich
Kopf, vor allem über mich. Hatte ich mir doch in wenigen Tagen meine neuen Sachen machen lassen und mich deshalb auch verschuldet. Damit sie rechtzeitig fertig würden, war ich die ganze Zeit nicht nur von Pontius zu
deshalb auch verschuldet. Damit sie rechtzeitig fertig würden, war ich die ganze Zeit nicht nur von Pontius zu  Pilatus geeilt, sondern ich erklärte mich bei manchem Stück mit einem der Eile geschuldeten Preisaufschlag
Pilatus geeilt, sondern ich erklärte mich bei manchem Stück mit einem der Eile geschuldeten Preisaufschlag einverstanden. Nun war alles umsonst gewesen. »Das fängt ja gut an!«, murrte ich, obschon ich mich längst dem
einverstanden. Nun war alles umsonst gewesen. »Das fängt ja gut an!«, murrte ich, obschon ich mich längst dem Willen des Haushofmeisters und damit gewiss auch dem der Edlingers gebeugt hatte. Claras Erscheinung und
Willen des Haushofmeisters und damit gewiss auch dem der Edlingers gebeugt hatte. Claras Erscheinung und Lachen befreite mich von dieser Kränkung, erlöste mich aus meiner Trübsal. Schweigend standen wir uns
Lachen befreite mich von dieser Kränkung, erlöste mich aus meiner Trübsal. Schweigend standen wir uns gegenüber. Plötzlich sah Clara zu Boden. Ich folgte ihrem Blick. In diesem Moment raffte sie ein wenig den
gegenüber. Plötzlich sah Clara zu Boden. Ich folgte ihrem Blick. In diesem Moment raffte sie ein wenig den Reifrock ihres Kleides und trat einen kleinen Schritt zurück. Ein Taschentuch kam zum Vorschein. Ich hob es auf
Reifrock ihres Kleides und trat einen kleinen Schritt zurück. Ein Taschentuch kam zum Vorschein. Ich hob es auf und reichte es ihr. Sie errötete, nickte und lächelte.
und reichte es ihr. Sie errötete, nickte und lächelte.



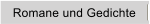
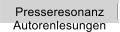




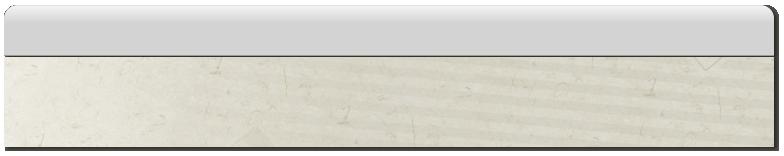


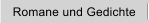

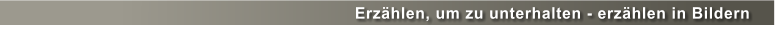
 “Plaisir d´amour” - Roman 2016
277 Seiten - Textumfang ca. 58500 Wörter
Zeit und vorwiegende Orte der Handlung: 1747 bis 1816, Freystadt, Neuburg/Donau, Straßburg,
Nancy, Paris, Lyon und wieder Paris und schließlich wieder Freystadt
ISBN: 978-3-95452-690-1 Spielberg Verlag Regensburg-Neumarkt 12,90 Euro
Den Roman können Sie bei allen Buchhandlungen, bei mehreren Internetanbietern, beim Verlag oder
beim Autor erwerben. Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Ein historisch-biografischer Roman über den Komponisten Jean Paul Egide Martini. Martini wurde
1741 in Freystadt geboren, und er verstarb 1816 in Paris. Dort brachte er es vor der Französischen
Revolution und danach als Komponist und Superintendant der königlichen Musik zu Anerkennung.
Weltruhm erlangte er mit der Kompositon des Liedes Plaisir d´amour. Der Roman erscheint zu
Martinis 200. Todestag im Januar 2016 im Spielberg Verlag Regensburg-Neumarkt. Die Stadt
Freystadt erklärt das Jahr 2016 zum Martini-Jahr.
Inhalt
Freystadt 1747. Die Mutter des 6-jährige Johann Paul Ägidius Martin stirbt. Sein Vater heiratet noch im
selben Jahr wieder. Der Bub hat fortan unter seiner Stiefmutter und seinen Halbgeschwistern zu leiden.
Seine außerordentliche musikalische Begabung ebnet dem 11-Jährigen den Weg ins Jesuitenseminar nach
Neuburg an der Donau. Dort fällt ein Mordverdacht auf ihn. Johann Paul Ägidius ist zum Priester
“Plaisir d´amour” - Roman 2016
277 Seiten - Textumfang ca. 58500 Wörter
Zeit und vorwiegende Orte der Handlung: 1747 bis 1816, Freystadt, Neuburg/Donau, Straßburg,
Nancy, Paris, Lyon und wieder Paris und schließlich wieder Freystadt
ISBN: 978-3-95452-690-1 Spielberg Verlag Regensburg-Neumarkt 12,90 Euro
Den Roman können Sie bei allen Buchhandlungen, bei mehreren Internetanbietern, beim Verlag oder
beim Autor erwerben. Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Ein historisch-biografischer Roman über den Komponisten Jean Paul Egide Martini. Martini wurde
1741 in Freystadt geboren, und er verstarb 1816 in Paris. Dort brachte er es vor der Französischen
Revolution und danach als Komponist und Superintendant der königlichen Musik zu Anerkennung.
Weltruhm erlangte er mit der Kompositon des Liedes Plaisir d´amour. Der Roman erscheint zu
Martinis 200. Todestag im Januar 2016 im Spielberg Verlag Regensburg-Neumarkt. Die Stadt
Freystadt erklärt das Jahr 2016 zum Martini-Jahr.
Inhalt
Freystadt 1747. Die Mutter des 6-jährige Johann Paul Ägidius Martin stirbt. Sein Vater heiratet noch im
selben Jahr wieder. Der Bub hat fortan unter seiner Stiefmutter und seinen Halbgeschwistern zu leiden.
Seine außerordentliche musikalische Begabung ebnet dem 11-Jährigen den Weg ins Jesuitenseminar nach
Neuburg an der Donau. Dort fällt ein Mordverdacht auf ihn. Johann Paul Ägidius ist zum Priester bestimmt. Er jedoch kann sich seine Zukunft nur als Musiker und Komponist vorstellen. 17-jährig sucht er
bei Nacht und Nebel das Weite. Erst nennt er sich Johann Paul Ägidius Schwarzendorf, später Jean Paul
Egide Martini, auch Jean Paul Egide Martini il Tedesco.
In Straßburg verlieben sich der junge, mittellose Musiker und dessen Clavierschülerin Clara unsterblich
ineinander. Doch diese Liebe scheitert an den Eltern des Mädchens. In dieser vermögenden und
angesehenen Straßburger Familie hegt man andere Pläne mit dem einzigen Sprössling, und Clara gehorcht.
Für sie komponiert er das Lied ohne Worte, die Melodie für das spätere Lied Plaisir d´amour. Martini zieht
weiter. Plaisir d´amour macht ihn über Nacht unsterblich. In Paris vermag er sich als Komponist,
Musiklehrer, Clavier- und Orgelvirtuose zu etablieren. Mit manchen seiner Opern feiert er Triumphe. Er
wird über Paris und Frankreich hinaus bekannt. Der König ernennt ihn zum Superintendanten der
königlichen Musik. Als »Le Grand Martini« bezeichnet man ihn. Er ist ganz oben angekommen, dann
überrascht ihn die Französischen Revolution. Zunächst bestätigt man ihn in seinem hohen Amt. Doch
plötzlich ist er nicht mehr gefragt und wird des Amtes enthoben. Immer wieder werden seine Hoffnungen
enttäuscht. So vergeht ein Jahr nach dem anderen. Trotz seines nach wie vor ungestillten Schaffensdrangs
glaubt Martini nicht mehr an bessere Zeiten. Ist er in Vergessenheit geraten? Martini sehnt sich nach Clara.
Es scheint, auch sie hat ihn vergessen.
Leseprobe Hans Regensburger - Plaisir d´amour - Roman
Prolog
Was kann man tun, um einen in Vergessenheit geratenen Menschen wieder ein Gesicht zu geben? Wie nähert man
bestimmt. Er jedoch kann sich seine Zukunft nur als Musiker und Komponist vorstellen. 17-jährig sucht er
bei Nacht und Nebel das Weite. Erst nennt er sich Johann Paul Ägidius Schwarzendorf, später Jean Paul
Egide Martini, auch Jean Paul Egide Martini il Tedesco.
In Straßburg verlieben sich der junge, mittellose Musiker und dessen Clavierschülerin Clara unsterblich
ineinander. Doch diese Liebe scheitert an den Eltern des Mädchens. In dieser vermögenden und
angesehenen Straßburger Familie hegt man andere Pläne mit dem einzigen Sprössling, und Clara gehorcht.
Für sie komponiert er das Lied ohne Worte, die Melodie für das spätere Lied Plaisir d´amour. Martini zieht
weiter. Plaisir d´amour macht ihn über Nacht unsterblich. In Paris vermag er sich als Komponist,
Musiklehrer, Clavier- und Orgelvirtuose zu etablieren. Mit manchen seiner Opern feiert er Triumphe. Er
wird über Paris und Frankreich hinaus bekannt. Der König ernennt ihn zum Superintendanten der
königlichen Musik. Als »Le Grand Martini« bezeichnet man ihn. Er ist ganz oben angekommen, dann
überrascht ihn die Französischen Revolution. Zunächst bestätigt man ihn in seinem hohen Amt. Doch
plötzlich ist er nicht mehr gefragt und wird des Amtes enthoben. Immer wieder werden seine Hoffnungen
enttäuscht. So vergeht ein Jahr nach dem anderen. Trotz seines nach wie vor ungestillten Schaffensdrangs
glaubt Martini nicht mehr an bessere Zeiten. Ist er in Vergessenheit geraten? Martini sehnt sich nach Clara.
Es scheint, auch sie hat ihn vergessen.
Leseprobe Hans Regensburger - Plaisir d´amour - Roman
Prolog
Was kann man tun, um einen in Vergessenheit geratenen Menschen wieder ein Gesicht zu geben? Wie nähert man sich einem solchen? Einem Mann, der vor zweihundert Jahren als Person des öffentlichen Lebens in Paris verstarb,
das hörte ich. Außerdem sagte man mir, dieser Tote sei berühmt gewesen, denn nicht ein paar Leute folgten sei-
sich einem solchen? Einem Mann, der vor zweihundert Jahren als Person des öffentlichen Lebens in Paris verstarb,
das hörte ich. Außerdem sagte man mir, dieser Tote sei berühmt gewesen, denn nicht ein paar Leute folgten sei- nem Sarg, sondern halb Paris in einem Kondukt; nicht von ungefähr ehrte ihn der nachnapoléonische König Lud-
nem Sarg, sondern halb Paris in einem Kondukt; nicht von ungefähr ehrte ihn der nachnapoléonische König Lud- wig XVIII. mit einem Staatsbegräbnis und einer letzten Ruhestätte in Père Lachaise.
Ich horchte auf, denn auf dieser Begräbnisstätte für Außergewöhnliche und Reiche sowie sicherlich auch für
wig XVIII. mit einem Staatsbegräbnis und einer letzten Ruhestätte in Père Lachaise.
Ich horchte auf, denn auf dieser Begräbnisstätte für Außergewöhnliche und Reiche sowie sicherlich auch für  Lebenskünstler und Glücksritter, doch vor allem ein letzter Ort für Komponisten, Musiker, Maler, Bildhauer,
Lebenskünstler und Glücksritter, doch vor allem ein letzter Ort für Komponisten, Musiker, Maler, Bildhauer, Dichter und Wissenschaftler ist jedes Grab auch ein Kunstwerk. Der Friedhof ein Gesamtkunstwerk, das die
Dichter und Wissenschaftler ist jedes Grab auch ein Kunstwerk. Der Friedhof ein Gesamtkunstwerk, das die Schönheit und in ihr die Künste preist und feiert. Vielleicht ein heimlicher Versuch, um dem Tode zu trotzen, der
Schönheit und in ihr die Künste preist und feiert. Vielleicht ein heimlicher Versuch, um dem Tode zu trotzen, der den Menschen gleichmachen und seinen Geist zerstäuben möchte. Père Lachaise aber scheint ihn am Entrücken ins
Sphärische zu hindern und wartet mit einer eigenen Form der Seelenwanderung und Wiedergeburt auf. Eine
den Menschen gleichmachen und seinen Geist zerstäuben möchte. Père Lachaise aber scheint ihn am Entrücken ins
Sphärische zu hindern und wartet mit einer eigenen Form der Seelenwanderung und Wiedergeburt auf. Eine Wiedergeburt in nichts als den Schönen Künsten.
Wo könnte man Nietzsches Zuversicht – ja, grenzenlose Zuversicht und nicht trostlose Einsicht –, dass der Mensch
die Künste habe, damit er an der Wahrheit nicht zugrunde gehen müsse, besser verstehen als in Père Lachaise?
Wiedergeburt in nichts als den Schönen Künsten.
Wo könnte man Nietzsches Zuversicht – ja, grenzenlose Zuversicht und nicht trostlose Einsicht –, dass der Mensch
die Künste habe, damit er an der Wahrheit nicht zugrunde gehen müsse, besser verstehen als in Père Lachaise? Wenngleich für die Franzosen dieser Ort etwas geringere Bedeutung haben mag als das Panthéon. Denn dort liegen
die Allergrößten der französischen Nation, allen voran Voltaire und Rousseau. Links und rechts am Eingang der
Wenngleich für die Franzosen dieser Ort etwas geringere Bedeutung haben mag als das Panthéon. Denn dort liegen
die Allergrößten der französischen Nation, allen voran Voltaire und Rousseau. Links und rechts am Eingang der Gruft scheinen ihre Sarkophage zu wachen, vielleicht um unablässig den Geist der Aufklärung, der Freiheit, der
Gruft scheinen ihre Sarkophage zu wachen, vielleicht um unablässig den Geist der Aufklärung, der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit anzumahnen.
Mir dämmerte, wen man meinte, und man nickte, als ich fragte, ob es sich bei jenem Vergessenen um Jean Paul
Gleichheit und der Brüderlichkeit anzumahnen.
Mir dämmerte, wen man meinte, und man nickte, als ich fragte, ob es sich bei jenem Vergessenen um Jean Paul Egide Martini handele. Nun erinnerte ich mich an meinen Besuch in Père Lachaise.
Vor einigen Jahren, es war November, schlenderte ich dort durch die Grabreihen. Plötzlich spürte ich etwas in einem
meiner Schuhe. Ein Steinchen befand sich darin. Beim Entfernen fuhr mir ein milder Windstoß durchs Haar. Denn
Egide Martini handele. Nun erinnerte ich mich an meinen Besuch in Père Lachaise.
Vor einigen Jahren, es war November, schlenderte ich dort durch die Grabreihen. Plötzlich spürte ich etwas in einem
meiner Schuhe. Ein Steinchen befand sich darin. Beim Entfernen fuhr mir ein milder Windstoß durchs Haar. Denn sogar im Schatten der Grabmäler und Mausoleen war die Luft lau. Diesen sonnigen Novembernachmittag hätte man
auch mit einem Nachmittag im Mai verwechseln können.
Damals wusste ich nicht, dass auf diesem Friedhof auch das Grab Jean Paul Egide Martinis zu finden war, dessen
sogar im Schatten der Grabmäler und Mausoleen war die Luft lau. Diesen sonnigen Novembernachmittag hätte man
auch mit einem Nachmittag im Mai verwechseln können.
Damals wusste ich nicht, dass auf diesem Friedhof auch das Grab Jean Paul Egide Martinis zu finden war, dessen  Todestag sich am 14. Februar 2016 zum 200. Mal jährt. Und wenn ich dessen Grabmal so zufällig entdeckt hätte wie
das des Lyrikers Apollinaire, wäre ich davor stehen geblieben? Gewiss! Und wie es in Père Lachaise Sitte ist, hätte
Todestag sich am 14. Februar 2016 zum 200. Mal jährt. Und wenn ich dessen Grabmal so zufällig entdeckt hätte wie
das des Lyrikers Apollinaire, wäre ich davor stehen geblieben? Gewiss! Und wie es in Père Lachaise Sitte ist, hätte ich auf dieses Grab nicht nur einen Stein gelegt, sondern auch das Steinchen aus meinem Schuh.
Man ist geneigt, selbst mit einem x-beliebigen Menschen zu wetten, dass dieser Wiederzuentdeckende aus dem Aus-
land kam, in der Provinz geboren wurde und ein Künstler war – ein Musiker und Komponist. Denn welcher
ich auf dieses Grab nicht nur einen Stein gelegt, sondern auch das Steinchen aus meinem Schuh.
Man ist geneigt, selbst mit einem x-beliebigen Menschen zu wetten, dass dieser Wiederzuentdeckende aus dem Aus-
land kam, in der Provinz geboren wurde und ein Künstler war – ein Musiker und Komponist. Denn welcher  Künstler war damals nicht Musiker und welcher Musiker nicht auch Komponist? Bände füllend all jene, die damit ihr
Auskommen suchten und so schnell vergessen wurden wie Musik im Ohr eines unmusikalischen Menschen. Hätte
Künstler war damals nicht Musiker und welcher Musiker nicht auch Komponist? Bände füllend all jene, die damit ihr
Auskommen suchten und so schnell vergessen wurden wie Musik im Ohr eines unmusikalischen Menschen. Hätte  jemand dagegengehalten, man hätte die Wette gewonnen. Tatsächlich, Martinis Wiege stand im Westen der
jemand dagegengehalten, man hätte die Wette gewonnen. Tatsächlich, Martinis Wiege stand im Westen der Oberpfalz, in Freystadt, wo ich einen Katzensprung davon entfernt geboren wurde und lebe. In Freystadt hatte
Oberpfalz, in Freystadt, wo ich einen Katzensprung davon entfernt geboren wurde und lebe. In Freystadt hatte man an seinem Geburtshaus eine Erinnerung in Stein gemeißelt und die Schule nach ihm benannt. Was ihm bislang
dort nicht zuteil werden konnte war, ihn aus der Finsternis der Archive zu befreien, ihm wieder Leben
man an seinem Geburtshaus eine Erinnerung in Stein gemeißelt und die Schule nach ihm benannt. Was ihm bislang
dort nicht zuteil werden konnte war, ihn aus der Finsternis der Archive zu befreien, ihm wieder Leben einzuhauchen, um ihn für jedermann erleb- und fassbar zu machen, spätestens im Gedenk-jahr 2016.
Im Spitalcafé in Freystadt bei Bier und Wein schien man einen solchen Zustand herbeizusehnen und wusste nicht,
einzuhauchen, um ihn für jedermann erleb- und fassbar zu machen, spätestens im Gedenk-jahr 2016.
Im Spitalcafé in Freystadt bei Bier und Wein schien man einen solchen Zustand herbeizusehnen und wusste nicht, wie man ihn herbeiführen konnte. Man hatte ja bereits über die steinerne Erinnerungstafel am Geburtshaus und die
Namensgebung der Schule hinaus einiges dafür getan: so manches aus Martinis Œuvre aufgeführt. – Eine große,
wie man ihn herbeiführen konnte. Man hatte ja bereits über die steinerne Erinnerungstafel am Geburtshaus und die
Namensgebung der Schule hinaus einiges dafür getan: so manches aus Martinis Œuvre aufgeführt. – Eine große,  feierliche Messe in der Wallfahrtskirche, dort und andernorts Musik aus seinen Opern, einige Sinfonien und immer
feierliche Messe in der Wallfahrtskirche, dort und andernorts Musik aus seinen Opern, einige Sinfonien und immer und immer wieder Plaisir d´amour – sein unsterbliches Lied. Möglicherweise das Lied seines Lebens. Ein Lied, so
und immer wieder Plaisir d´amour – sein unsterbliches Lied. Möglicherweise das Lied seines Lebens. Ein Lied, so morbide und schön wie Lili Marleen. Eine Poesie, ein Mikrokosmos seiner 75 Lebensjahre – vielleicht. Wenn
morbide und schön wie Lili Marleen. Eine Poesie, ein Mikrokosmos seiner 75 Lebensjahre – vielleicht. Wenn überhaupt, wollte ich diesen wenigen Minuten großer Kunst nachspüren, um in ihr den Schöpfer und Menschen zu
entdecken, den ich eigentlich nicht entdecken wollte. Einen Opportunisten – doch vielleicht notgedrungen, wer
überhaupt, wollte ich diesen wenigen Minuten großer Kunst nachspüren, um in ihr den Schöpfer und Menschen zu
entdecken, den ich eigentlich nicht entdecken wollte. Einen Opportunisten – doch vielleicht notgedrungen, wer weiß.
Die Kultur- und Kunstliebhaberinnen Ursula Steinert und Marie Luise Karl überraschten mich in dieser geselligen
weiß.
Die Kultur- und Kunstliebhaberinnen Ursula Steinert und Marie Luise Karl überraschten mich in dieser geselligen  Runde mit der Idee, ich möge einen Roman über diesen Künstler schreiben. Ich erschrak. Dessen ungeachtet soli-
Runde mit der Idee, ich möge einen Roman über diesen Künstler schreiben. Ich erschrak. Dessen ungeachtet soli- darisierte sich Willibald Gailler, der Bürgermeister von Freystadt, mit diesem Gedanken. Fortan schien es für mich
darisierte sich Willibald Gailler, der Bürgermeister von Freystadt, mit diesem Gedanken. Fortan schien es für mich  kein Zurück mehr zu geben. Nun heftete sich dieser Künstler wie ein Schatten an meine Fersen. Ein ständiger
kein Zurück mehr zu geben. Nun heftete sich dieser Künstler wie ein Schatten an meine Fersen. Ein ständiger Begleiter, den ich weder abschütteln konnte noch wollte; dennoch ein lästiger Verfolger, der mir nicht ganz geheuer
war. Ich liebäugelte mit dem Wunsch, wie einst Peter Schlemihl, so möge auch mir eine Person begegnen, die
Begleiter, den ich weder abschütteln konnte noch wollte; dennoch ein lästiger Verfolger, der mir nicht ganz geheuer
war. Ich liebäugelte mit dem Wunsch, wie einst Peter Schlemihl, so möge auch mir eine Person begegnen, die Schatten kaufe. Doch in Erinnerung an Schlemihls Schicksal war mir dieser Schatten tausendmal wertvoller als der
Ertrag seiner Veräußerung – eine Börse mit Gold, die nie leer wird. Dass ich das ungeachtet dessen nicht tun würde,
war so gewiss wie die Wahrmachung dieses Bildes unmöglich. Doch konnte ich mich an diesen Schatten gewöhnen
oder gar mit ihm anfreunden und an welchem Ort, wenn es denn schon sein musste? Paris oder Freystadt standen
Schatten kaufe. Doch in Erinnerung an Schlemihls Schicksal war mir dieser Schatten tausendmal wertvoller als der
Ertrag seiner Veräußerung – eine Börse mit Gold, die nie leer wird. Dass ich das ungeachtet dessen nicht tun würde,
war so gewiss wie die Wahrmachung dieses Bildes unmöglich. Doch konnte ich mich an diesen Schatten gewöhnen
oder gar mit ihm anfreunden und an welchem Ort, wenn es denn schon sein musste? Paris oder Freystadt standen zur Wahl, was sonst. Ich favorisierte Paris. Von dort wollte ich, reich an Abenteuern, im Gedenkjahr 2016 den
zur Wahl, was sonst. Ich favorisierte Paris. Von dort wollte ich, reich an Abenteuern, im Gedenkjahr 2016 den großen Sohn nach Freystadt heimholen – zwischen zwei Buchdeckeln als Held eines Romans. Bevor ich mich spät
in der Nacht schlafen legte, ging ich zum Geburtshaus des Komponisten. Dort vergewisserte ich mich, was auf der
steinernen Tafel geschrieben stand. Zum ersten Mal wunderte ich mich über dessen französische Vornamen und den
italienischen Familiennamen.
Ich kehrte nach Hause zurück und las in meinem spärlichen Fundus, dass er seine Vornamen französisch und seinen
Familiennamen italienisch naturalisiert hatte. So war aus dem am 31. August 1741 in Freystadt zur Welt gekom-
großen Sohn nach Freystadt heimholen – zwischen zwei Buchdeckeln als Held eines Romans. Bevor ich mich spät
in der Nacht schlafen legte, ging ich zum Geburtshaus des Komponisten. Dort vergewisserte ich mich, was auf der
steinernen Tafel geschrieben stand. Zum ersten Mal wunderte ich mich über dessen französische Vornamen und den
italienischen Familiennamen.
Ich kehrte nach Hause zurück und las in meinem spärlichen Fundus, dass er seine Vornamen französisch und seinen
Familiennamen italienisch naturalisiert hatte. So war aus dem am 31. August 1741 in Freystadt zur Welt gekom- menen Johann Paul Ägidius Martin später in Frankreich ein Jean Paul Egide Martini geworden. Wie ich vermutete:
menen Johann Paul Ägidius Martin später in Frankreich ein Jean Paul Egide Martini geworden. Wie ich vermutete: ein Opportunist. Doch ein weiterer Blick in die Liste seiner Lebensdaten belehrte mich eines Besseren: Martini war
kaum sechs, da starb seine Mutter. – Deshalb ein Leidtragender und vielleicht bald schon ein doppelt Leidtragender,
weil ihm noch im Todesjahr seiner Mutter eine Stiefmutter zugemutet wurde.
Wer wollte darüber den Kopf schütteln, dass er fünf Jahre später keine Träne vergoss, als man ihn ins Seminar zu
ein Opportunist. Doch ein weiterer Blick in die Liste seiner Lebensdaten belehrte mich eines Besseren: Martini war
kaum sechs, da starb seine Mutter. – Deshalb ein Leidtragender und vielleicht bald schon ein doppelt Leidtragender,
weil ihm noch im Todesjahr seiner Mutter eine Stiefmutter zugemutet wurde.
Wer wollte darüber den Kopf schütteln, dass er fünf Jahre später keine Träne vergoss, als man ihn ins Seminar zu den Jesuiten nach Neuburg an der Donau schickte. Im Bett liegend versuchte ich mich mit der Vorstellung
den Jesuiten nach Neuburg an der Donau schickte. Im Bett liegend versuchte ich mich mit der Vorstellung anzufreunden, damals in Père Lachaise doch sein Grab gesucht und gefunden zu haben. Reumütig und das Gerippe
von Martinis Lebens- und Schaffensdaten in Erinnerung rufend, ersehnte ich den Schlaf. Wie würde ich so bewehrt
und befrachtet schlafen können und aufwachen?, vielleicht mich in diesen Mann hineinträumen, wohlwissend, dass
man über seine Träume keine Macht hat. Ich legte mich auf meine Einschlafseite, schloss die Augen und verkroch
anzufreunden, damals in Père Lachaise doch sein Grab gesucht und gefunden zu haben. Reumütig und das Gerippe
von Martinis Lebens- und Schaffensdaten in Erinnerung rufend, ersehnte ich den Schlaf. Wie würde ich so bewehrt
und befrachtet schlafen können und aufwachen?, vielleicht mich in diesen Mann hineinträumen, wohlwissend, dass
man über seine Träume keine Macht hat. Ich legte mich auf meine Einschlafseite, schloss die Augen und verkroch mich im Oberbett. Plötzlich erschien vor meinem inneren Auge Martinis Portrait. Ein Haupt mit Perücke, ein breiter
Schädel, ein selbstgefälliger Blick. »Unbeirrt und protzig«, dachte ich. Und obwohl es nicht Martinis Epoche war,
mich im Oberbett. Plötzlich erschien vor meinem inneren Auge Martinis Portrait. Ein Haupt mit Perücke, ein breiter
Schädel, ein selbstgefälliger Blick. »Unbeirrt und protzig«, dachte ich. Und obwohl es nicht Martinis Epoche war,  kamen nach und nach Bilder des Renaissancemenschen hinzu. So wie diese ihre Einzigartigkeit, Selbstgewissheit und
Schönheit feierten, pflegten sie auch die Melancholie: die Haltung des in sich gekehrten Suchers. Eine Lebens- und
Leidensform, die damals die Künstler, Kaiser und Könige für sich beanspruchten; Menschen, die sich selbst
kamen nach und nach Bilder des Renaissancemenschen hinzu. So wie diese ihre Einzigartigkeit, Selbstgewissheit und
Schönheit feierten, pflegten sie auch die Melancholie: die Haltung des in sich gekehrten Suchers. Eine Lebens- und
Leidensform, die damals die Künstler, Kaiser und Könige für sich beanspruchten; Menschen, die sich selbst entdeckt und die Ernsthaftigkeit ihrer Existenz verinnerlicht hatten und darauf stolz waren. Von alldem keine Spur
in Martinis Gesicht. Mir erschien es so selbstgefällig und unernst wie die Kette seines französisch und italienisch
entdeckt und die Ernsthaftigkeit ihrer Existenz verinnerlicht hatten und darauf stolz waren. Von alldem keine Spur
in Martinis Gesicht. Mir erschien es so selbstgefällig und unernst wie die Kette seines französisch und italienisch naturalisierten Namens, der mir stereotyp durch den Kopf geisterte. Ich hoffte, dass ich bald einschlafen und diesen
Martini für immer vergessen würde. Doch es kam anders. Wusste ich denn nicht, dass man keine Macht über seine
naturalisierten Namens, der mir stereotyp durch den Kopf geisterte. Ich hoffte, dass ich bald einschlafen und diesen
Martini für immer vergessen würde. Doch es kam anders. Wusste ich denn nicht, dass man keine Macht über seine Träume hat? Zuhörer und Begleiter wurde ich, Zeuge von Martinis Zwiesprache mit sich. Er legte von sich
Träume hat? Zuhörer und Begleiter wurde ich, Zeuge von Martinis Zwiesprache mit sich. Er legte von sich Rechenschaft ab. Denn trotz der Komposition von Revolutionsliedern und Militärmusik, trotz der Hymne auf die
Rechenschaft ab. Denn trotz der Komposition von Revolutionsliedern und Militärmusik, trotz der Hymne auf die Republik, trotz mancher Ergebenheitsadressen und Loyalitätsbezeugungen für den neuen Staat – die Französische
Republik, trotz mancher Ergebenheitsadressen und Loyalitätsbezeugungen für den neuen Staat – die Französische Republik und das Französische Kaiserreich – verlor er 1792 das Amt des Generalmusikdirektors und 1802 seine
Republik und das Französische Kaiserreich – verlor er 1792 das Amt des Generalmusikdirektors und 1802 seine Stellung als Inspekteur des Musikkonservatoriums von Paris, die er 1796 erhalten hatte. Offenbar hatte man dem
Stellung als Inspekteur des Musikkonservatoriums von Paris, die er 1796 erhalten hatte. Offenbar hatte man dem neuen Herrscher hintertragen, dass er vor dem 14. Juli 1789 dem verhassten König zu Diensten gewesen sei.
neuen Herrscher hintertragen, dass er vor dem 14. Juli 1789 dem verhassten König zu Diensten gewesen sei.  Dieser intime Zustand von Martinis Erzählen strafte sein angebliches Abbild – unmöglich auch Portrait – samt
Dieser intime Zustand von Martinis Erzählen strafte sein angebliches Abbild – unmöglich auch Portrait – samt Maler Lügen. Es schien, Martini war froh, mich an seiner Seite zu wissen. In mir hatte er jemanden gefunden, dem
Maler Lügen. Es schien, Martini war froh, mich an seiner Seite zu wissen. In mir hatte er jemanden gefunden, dem er alles anvertrauen konnte, ohne der Schönfärberei anheimzufallen, etwas verbergen und lügen zu müssen. So wie
er alles anvertrauen konnte, ohne der Schönfärberei anheimzufallen, etwas verbergen und lügen zu müssen. So wie er zu mir sprach, sprach er zu sich. Martini blickte weit in sein Leben zurück und erzählte.
1760 – Nach Straßburg geraten – als 19-Jähriger (6. Kapitel)
Eigentlich war Nancy mein Ziel und nicht Straßburg. Vor diesem Sinneswandel, der in Colmar plötzlich über mich
er zu mir sprach, sprach er zu sich. Martini blickte weit in sein Leben zurück und erzählte.
1760 – Nach Straßburg geraten – als 19-Jähriger (6. Kapitel)
Eigentlich war Nancy mein Ziel und nicht Straßburg. Vor diesem Sinneswandel, der in Colmar plötzlich über mich kam, hatten mich Zweifel heimgesucht. Trotz meines Ziels überwog plötzlich das Gefühl, ziellos unterwegs zu sein,
beim Zechen falschen Versprechungen auf den Leim gegangen zu sein. Wieder wurde mein Geld knapp. Würde es
noch bis Nancy reichen? Ich scheute mich davor, meine Börse zu stürzen und es nachzuzählen. Was nutzte mir in
kam, hatten mich Zweifel heimgesucht. Trotz meines Ziels überwog plötzlich das Gefühl, ziellos unterwegs zu sein,
beim Zechen falschen Versprechungen auf den Leim gegangen zu sein. Wieder wurde mein Geld knapp. Würde es
noch bis Nancy reichen? Ich scheute mich davor, meine Börse zu stürzen und es nachzuzählen. Was nutzte mir in dieser vertrackten Lage – angesichts meines schmalen Geldbeutels – die dicke Mappe mit meinen ersten
dieser vertrackten Lage – angesichts meines schmalen Geldbeutels – die dicke Mappe mit meinen ersten Kompositionen? Würde ich in Nancy überhaupt den Baron de Rondad finden oder würde sich dieser hohe Beamte
und Musikenthusiast am Hofe Herzogs Stanislas von Lothringen dort gar als Erfindung erweisen? Der Baron habe
Kompositionen? Würde ich in Nancy überhaupt den Baron de Rondad finden oder würde sich dieser hohe Beamte
und Musikenthusiast am Hofe Herzogs Stanislas von Lothringen dort gar als Erfindung erweisen? Der Baron habe das Ohr des Herzogs, hatte ein Frankreichreisender behauptet. Mit ihm war ich in einer Freiburger
das Ohr des Herzogs, hatte ein Frankreichreisender behauptet. Mit ihm war ich in einer Freiburger  Studentenschenke ins Gespräch gekommen. Er, der Baron, könne mir den Konzertsaal des Herzogs öffnen und
Studentenschenke ins Gespräch gekommen. Er, der Baron, könne mir den Konzertsaal des Herzogs öffnen und gewiss auch die Orgelempore von dessen Hofkirche. Erneut bestellte ich für ihn und mich Bier. Immer wieder hob
er an diesem feucht-fröhlichen Abend seinen Krug und stieß mit mir auf meine Zukunft als großer Musiker und
gewiss auch die Orgelempore von dessen Hofkirche. Erneut bestellte ich für ihn und mich Bier. Immer wieder hob
er an diesem feucht-fröhlichen Abend seinen Krug und stieß mit mir auf meine Zukunft als großer Musiker und Komponist an. Doch so wie mein Glaube schwand, in die Residenz des musikbesessenen Herzogs mithilfe des
Komponist an. Doch so wie mein Glaube schwand, in die Residenz des musikbesessenen Herzogs mithilfe des Barons de Rondad Eingang zu finden, konnte ich nun meinen Verdacht nicht mehr abschütteln, dass dieser
Barons de Rondad Eingang zu finden, konnte ich nun meinen Verdacht nicht mehr abschütteln, dass dieser herzogliche Beamte auf einer freien Erfindung beruhte, ich einst in Freiburg beim siebten, achten Krug Bier zum
herzogliche Beamte auf einer freien Erfindung beruhte, ich einst in Freiburg beim siebten, achten Krug Bier zum Besten gehalten wurde. Das süffisante Lächeln, der hinterhältige Augenaufschlag dieses Frankreichreisenden
Besten gehalten wurde. Das süffisante Lächeln, der hinterhältige Augenaufschlag dieses Frankreichreisenden schienen mir dafür Beweis genug zu sein. Waren diese Beobachtungen urplötzlich aus meiner Erinnerung erwacht
schienen mir dafür Beweis genug zu sein. Waren diese Beobachtungen urplötzlich aus meiner Erinnerung erwacht oder lediglich meiner Phantasie entsprungen? Setzte ich mich mit Tatsachen auseinander oder sah ich Gespenster?
Einerlei, meine Zuversicht war dahin. Ich bereute, während der beiden Jahre in Freiburg mit meinen Kompositionen
mehr Zeit verbracht zu haben als an der einen oder anderen Kirchenorgel und der Unterweisung von Schülern. Nun
trauerte ich dem Geld nach, das mir der Dienst als Organist und Kantor zusätzlich eingebracht hätte. In Freiburg
oder lediglich meiner Phantasie entsprungen? Setzte ich mich mit Tatsachen auseinander oder sah ich Gespenster?
Einerlei, meine Zuversicht war dahin. Ich bereute, während der beiden Jahre in Freiburg mit meinen Kompositionen
mehr Zeit verbracht zu haben als an der einen oder anderen Kirchenorgel und der Unterweisung von Schülern. Nun
trauerte ich dem Geld nach, das mir der Dienst als Organist und Kantor zusätzlich eingebracht hätte. In Freiburg und Umgebung hatte ich vor allem bei den Protestanten so manchen Organistendienst leichtfertig ausgeschlagen,
und Umgebung hatte ich vor allem bei den Protestanten so manchen Organistendienst leichtfertig ausgeschlagen, den einen oder anderen Orgelschüler hochnäsig abgewiesen.
Geknickt stieg ich in Colmar aus der Postkutsche und folgte den anderen Reisenden zur Posthalterei. Unter dem
den einen oder anderen Orgelschüler hochnäsig abgewiesen.
Geknickt stieg ich in Colmar aus der Postkutsche und folgte den anderen Reisenden zur Posthalterei. Unter dem Druck in meiner Brust verharrte mein Blick auf dem zerklüfteten Pflaster, worüber vor und hinter mir einige Frauen
jammerten und schimpften. Trotz der nahen Nacht und meines knurrenden Magens hätte ich am liebsten vor der
Druck in meiner Brust verharrte mein Blick auf dem zerklüfteten Pflaster, worüber vor und hinter mir einige Frauen
jammerten und schimpften. Trotz der nahen Nacht und meines knurrenden Magens hätte ich am liebsten vor der Wirtshaustür meinen Schritt gewendet und wäre zu Fuß nach Freiburg zurückgekehrt. Ich fühlte mich nicht mehr
Wirtshaustür meinen Schritt gewendet und wäre zu Fuß nach Freiburg zurückgekehrt. Ich fühlte mich nicht mehr frei wie ein Vogel, sondern vogelfrei – verloren. Kaum, dass ich mich in der Wirtstube der Posthalterei an einen
frei wie ein Vogel, sondern vogelfrei – verloren. Kaum, dass ich mich in der Wirtstube der Posthalterei an einen Tisch gezwängt hatte, horchte ich auf. Was hatte ich trotz des lauten Durcheinanders, das dort herrschte, soeben aus
einem Gespräch zweier Männer aufgeschnappt? Ich sah auf. Etwa eineinhalb Armlängen vor mir saßen zwei Chor-
herren mit mir am Tisch. Sie bestellten bei der dunkelhaarigen Kellnerin Wein, Brot, Butter und geselchten
Tisch gezwängt hatte, horchte ich auf. Was hatte ich trotz des lauten Durcheinanders, das dort herrschte, soeben aus
einem Gespräch zweier Männer aufgeschnappt? Ich sah auf. Etwa eineinhalb Armlängen vor mir saßen zwei Chor-
herren mit mir am Tisch. Sie bestellten bei der dunkelhaarigen Kellnerin Wein, Brot, Butter und geselchten Schinken. Als die blutjunge Frau mich ansah und fragte, was ich wünsche, begnügte ich mich mit Bier und Butter-
Schinken. Als die blutjunge Frau mich ansah und fragte, was ich wünsche, begnügte ich mich mit Bier und Butter- broten. »Den Schnittlauch nicht vergessen!«, rief ich ihr hinterher. Dann kreiste das Gespräch der Geistlichen
broten. »Den Schnittlauch nicht vergessen!«, rief ich ihr hinterher. Dann kreiste das Gespräch der Geistlichen wieder um jenes Thema, das mich kurz zuvor aus meiner Niedergeschlagenheit gerissen hatte. Erneut beklagten sie
die über Nacht eingetretene Vakanz der Ersten Hilfsorganistenstelle am Straßburger Münster. Sie wünschten jenem
Verliebten, der mit einer Straßburger Bürgerstochter bei Nacht und Nebel durchgebrannt sei, die Pest an den Hals.
Bald darauf runzelte einer von ihnen seine Stirn und der andere warf die Frage auf, ob sich mit jenem Talent im
wieder um jenes Thema, das mich kurz zuvor aus meiner Niedergeschlagenheit gerissen hatte. Erneut beklagten sie
die über Nacht eingetretene Vakanz der Ersten Hilfsorganistenstelle am Straßburger Münster. Sie wünschten jenem
Verliebten, der mit einer Straßburger Bürgerstochter bei Nacht und Nebel durchgebrannt sei, die Pest an den Hals.
Bald darauf runzelte einer von ihnen seine Stirn und der andere warf die Frage auf, ob sich mit jenem Talent im Badischen, zu dem sie unterwegs seien, diese Lücke wieder füllen lasse. »Nichts wie hin nach Straßburg!«, sagte ich
mir.
Und tatsächlich kam ich dort den beiden mit ihrem Kandidaten um drei Wochen zuvor. Als dieser mein Spiel hörte,
konnte ihn die hohe Geistlichkeit des Münsters am nächsten Tag in ganz Straßburg nicht mehr ausfindig machen.
Badischen, zu dem sie unterwegs seien, diese Lücke wieder füllen lasse. »Nichts wie hin nach Straßburg!«, sagte ich
mir.
Und tatsächlich kam ich dort den beiden mit ihrem Kandidaten um drei Wochen zuvor. Als dieser mein Spiel hörte,
konnte ihn die hohe Geistlichkeit des Münsters am nächsten Tag in ganz Straßburg nicht mehr ausfindig machen.  So wie ich meinen Kontrahenten mit meiner Kunst an der Orgel in die Flucht geschlagen hatte, zog sie im Laufe der
Zeit Madame Edlinger an. Sie hatte mit ihrer Mutter beinahe täglich im Münster die Messe besucht. Wie sie mir
So wie ich meinen Kontrahenten mit meiner Kunst an der Orgel in die Flucht geschlagen hatte, zog sie im Laufe der
Zeit Madame Edlinger an. Sie hatte mit ihrer Mutter beinahe täglich im Münster die Messe besucht. Wie sie mir später erzählte, war sie eines Tages hellhörig geworden. Just an diesem Morgen spielte ich dort meine erste Messe.
später erzählte, war sie eines Tages hellhörig geworden. Just an diesem Morgen spielte ich dort meine erste Messe. Mit der Zeit fand Madame Edlinger heraus, dass ich – jener Neue – vor allem werktags beim Siebenuhrgottesdienst
in die Tasten griff und das Pedal traktierte. Schnell war in ihr der Entschluss gereift, an mich heranzutreten. Zu
Mit der Zeit fand Madame Edlinger heraus, dass ich – jener Neue – vor allem werktags beim Siebenuhrgottesdienst
in die Tasten griff und das Pedal traktierte. Schnell war in ihr der Entschluss gereift, an mich heranzutreten. Zu diesem Zweck hatte sie noch während der Messe ihren Hausdiener und Kutscher, einen liebenswürdigen alten
diesem Zweck hatte sie noch während der Messe ihren Hausdiener und Kutscher, einen liebenswürdigen alten Mann, zu mir auf die Schwalbennestorgel des Münsters beordert. Und ich staunte, was ich auf dem schmucken
Mann, zu mir auf die Schwalbennestorgel des Münsters beordert. Und ich staunte, was ich auf dem schmucken Billett der vornehmen Frau Edlinger las, das ich plötzlich auf dem Notenpult sah. Nach dem Auszug führte mich
Billett der vornehmen Frau Edlinger las, das ich plötzlich auf dem Notenpult sah. Nach dem Auszug führte mich der gebeugte Alte zu seiner Herrin. Sie erwartete mich vor dem Münster.
»Mein Herr, auf ein Wort.« In ihrer Begleitung befand sich eine ältere Dame, ihre Mutter, wie ich angesichts der
der gebeugte Alte zu seiner Herrin. Sie erwartete mich vor dem Münster.
»Mein Herr, auf ein Wort.« In ihrer Begleitung befand sich eine ältere Dame, ihre Mutter, wie ich angesichts der  Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge sofort richtig vermutet hatte. Ich lüftete meinen Dreispitz und erwiderte:
Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge sofort richtig vermutet hatte. Ich lüftete meinen Dreispitz und erwiderte: »Mesdames, Euer ergebener Diener!«
»Seit Euerer ersten Messe rätseln meine Frau Mutter und ich, welch großer Künstler plötzlich die Orgel spiele.«
»Mesdames, Euer ergebener Diener!«
»Seit Euerer ersten Messe rätseln meine Frau Mutter und ich, welch großer Künstler plötzlich die Orgel spiele.« Dieses Lob machte mich sprachlos. Ich errötete. »O Gott, wie jung Ihr noch seid – so unschuldig jung«, erschrak
Dieses Lob machte mich sprachlos. Ich errötete. »O Gott, wie jung Ihr noch seid – so unschuldig jung«, erschrak ihre Mutter, eine Frau, von keineswegs kleinem und zartem Wuchs. Allein der Aufzug der beiden Damen verriet
ihre Mutter, eine Frau, von keineswegs kleinem und zartem Wuchs. Allein der Aufzug der beiden Damen verriet ihre Eleganz und wohl auch ihren Reichtum, noch mehr die zweispännige Kalesche, die ich im Schatten des
ihre Eleganz und wohl auch ihren Reichtum, noch mehr die zweispännige Kalesche, die ich im Schatten des Münsters sah.
»Ich bin neunzehn, bald zwanzig, Madame«, erwiderte ich und stellte mich vor. Beide Damen wurden nicht müde,
Münsters sah.
»Ich bin neunzehn, bald zwanzig, Madame«, erwiderte ich und stellte mich vor. Beide Damen wurden nicht müde, mich mit Komplimenten zu überhäufen. »Meine Frau Mut-ter und ich sind längst nicht mehr die Einzigen, die Euch
bewundern«, sagte die Jüngere. »Nach jeder Messe wird die Schar Euerer Anhänger größer«, so die Ältere. Als
mich mit Komplimenten zu überhäufen. »Meine Frau Mut-ter und ich sind längst nicht mehr die Einzigen, die Euch
bewundern«, sagte die Jüngere. »Nach jeder Messe wird die Schar Euerer Anhänger größer«, so die Ältere. Als Ausdruck meiner Freude nahm ich meinen Dreispitz ab, schwang mit ihm eine Luftwelle und verneigte mich. »Euer
Diener, Mesdames – ganz Euer ergebener Diener!«
»Ihr könnt wahrlich die Orgel traktieren…, o nein: spielen wie nur wenige und gewiss genauso bravourös das
Ausdruck meiner Freude nahm ich meinen Dreispitz ab, schwang mit ihm eine Luftwelle und verneigte mich. »Euer
Diener, Mesdames – ganz Euer ergebener Diener!«
»Ihr könnt wahrlich die Orgel traktieren…, o nein: spielen wie nur wenige und gewiss genauso bravourös das Clavier!«, meinte die Jüngere und schwenkte ihr Schirmchen vors Gesicht, worauf die Sonne geschienen hatte.
Clavier!«, meinte die Jüngere und schwenkte ihr Schirmchen vors Gesicht, worauf die Sonne geschienen hatte.  »Nun…«, äußerte ich und versuchte mich meiner erneuten Sprachlosigkeit zu entwinden.
»Mein guter Gatte beschenkte unsere geliebte Clara zu dero 16. Geburtstag mit einem Clavier neuerster Machart«,
»Nun…«, äußerte ich und versuchte mich meiner erneuten Sprachlosigkeit zu entwinden.
»Mein guter Gatte beschenkte unsere geliebte Clara zu dero 16. Geburtstag mit einem Clavier neuerster Machart«, hob sie an. ... Ihr Anblick verschlug mir die Sprache. Clara hatte glattes, blondes Haar, ihre Augen waren hellblau
und ihre Nase etwas breit, doch unaufdringlich. Claras Wuchs war schmal und hoch. Ihr breites Lachen, das
hob sie an. ... Ihr Anblick verschlug mir die Sprache. Clara hatte glattes, blondes Haar, ihre Augen waren hellblau
und ihre Nase etwas breit, doch unaufdringlich. Claras Wuchs war schmal und hoch. Ihr breites Lachen, das plötzlich in ihrem Gesicht erstrahlte, nahm mir im Nu die Angst, die mir ihre engelsgleiche und unnahbare Aura
plötzlich in ihrem Gesicht erstrahlte, nahm mir im Nu die Angst, die mir ihre engelsgleiche und unnahbare Aura bereits untergeschoben hatte. Als ich sie zu ihrem Namenstag beglückwünschen wollte, brachte ich dennoch nur ein
Stammeln über meine Lippen. Flugs erkannte sie meine Notlage und stand mir bei: »Ich bin so froh, mit Euerer
bereits untergeschoben hatte. Als ich sie zu ihrem Namenstag beglückwünschen wollte, brachte ich dennoch nur ein
Stammeln über meine Lippen. Flugs erkannte sie meine Notlage und stand mir bei: »Ich bin so froh, mit Euerer Kunst am Clavier zum Namenstag beschenkt zu werden.« Sie nahm mich beiseite und ging mit mir ein Stück – stahl
sich mit mir in die Schar der Gäste. Niemand nahm von uns Notiz. Eingenebelt von der Namenstagsgesellschaft
Kunst am Clavier zum Namenstag beschenkt zu werden.« Sie nahm mich beiseite und ging mit mir ein Stück – stahl
sich mit mir in die Schar der Gäste. Niemand nahm von uns Notiz. Eingenebelt von der Namenstagsgesellschaft und dem Geschwirr ihrer Plaudereien und Gelächter, schienen Clara und ich vor ihr verborgen zu sein. »Nun kann
und dem Geschwirr ihrer Plaudereien und Gelächter, schienen Clara und ich vor ihr verborgen zu sein. »Nun kann ich es kaum mehr erwarten, Euch an diesem schönen Instrument zu erleben«, sagte sie. Dabei versuchte sie mir
ich es kaum mehr erwarten, Euch an diesem schönen Instrument zu erleben«, sagte sie. Dabei versuchte sie mir etwas zu sagen, doch sie kam gegen ihr Kichern nicht an. »Ich alter Kindskopf hätte es wenigstens ahnen müssen«,
brachte sie schließlich unter Tränen heraus, »dass Ihr, Herr Martin, Mamas und Papas Überraschung seid. Hatten sie
doch zuvor Euer Können an der Orgel und am Clavier in den höchsten Tönen gelobt. Mama war hingerissen. Sie
etwas zu sagen, doch sie kam gegen ihr Kichern nicht an. »Ich alter Kindskopf hätte es wenigstens ahnen müssen«,
brachte sie schließlich unter Tränen heraus, »dass Ihr, Herr Martin, Mamas und Papas Überraschung seid. Hatten sie
doch zuvor Euer Können an der Orgel und am Clavier in den höchsten Tönen gelobt. Mama war hingerissen. Sie meinte gar, Euere Musik und Euer Musizieren gleiche einem Wunder. Als sie sah, was Euere Finger mit den Tasten
anstellten, konnte sie nur noch staunen.« Nun war auch mein Verdruss wie weggeblasen. Er hatte mich ereilt, kaum
dass ich meinen Fuß über die Schwelle des Palais Edlinger gesetzt hatte. Zu meinem Entsetzen teilte mir der
meinte gar, Euere Musik und Euer Musizieren gleiche einem Wunder. Als sie sah, was Euere Finger mit den Tasten
anstellten, konnte sie nur noch staunen.« Nun war auch mein Verdruss wie weggeblasen. Er hatte mich ereilt, kaum
dass ich meinen Fuß über die Schwelle des Palais Edlinger gesetzt hatte. Zu meinem Entsetzen teilte mir der Haushofmeister mit, dass ich während meines Auftritts eine Livree zu tragen habe. »Die gleiche wie die
Haushofmeister mit, dass ich während meines Auftritts eine Livree zu tragen habe. »Die gleiche wie die Dienerschaft im Palais Edlinger«, betonte er. Meinen neuen blauen Rock und schneeweißen Kragen, meine neue
Dienerschaft im Palais Edlinger«, betonte er. Meinen neuen blauen Rock und schneeweißen Kragen, meine neue hellgraue Weste, meine neuen dunkelgrauen Hosen und beigen Strümpfe und meine Perücke musste ich ablegen
hellgraue Weste, meine neuen dunkelgrauen Hosen und beigen Strümpfe und meine Perücke musste ich ablegen und dieses steife, uniforme Mausgrau mit seinen gelben Bordüren anlegen. Allein meine neuen Schuhe durfte ich
und dieses steife, uniforme Mausgrau mit seinen gelben Bordüren anlegen. Allein meine neuen Schuhe durfte ich wieder anziehen, doch nur, weil der Haushofmeister im Gewandmagazin des Personals für mich keine passenden
wieder anziehen, doch nur, weil der Haushofmeister im Gewandmagazin des Personals für mich keine passenden gefunden hatte. Es dauerte einige Zeit, bis er sich endlich mit meinen braunen abfinden wollte. Ich schüttelte den
gefunden hatte. Es dauerte einige Zeit, bis er sich endlich mit meinen braunen abfinden wollte. Ich schüttelte den Kopf, vor allem über mich. Hatte ich mir doch in wenigen Tagen meine neuen Sachen machen lassen und mich
Kopf, vor allem über mich. Hatte ich mir doch in wenigen Tagen meine neuen Sachen machen lassen und mich deshalb auch verschuldet. Damit sie rechtzeitig fertig würden, war ich die ganze Zeit nicht nur von Pontius zu
deshalb auch verschuldet. Damit sie rechtzeitig fertig würden, war ich die ganze Zeit nicht nur von Pontius zu  Pilatus geeilt, sondern ich erklärte mich bei manchem Stück mit einem der Eile geschuldeten Preisaufschlag
Pilatus geeilt, sondern ich erklärte mich bei manchem Stück mit einem der Eile geschuldeten Preisaufschlag einverstanden. Nun war alles umsonst gewesen. »Das fängt ja gut an!«, murrte ich, obschon ich mich längst dem
einverstanden. Nun war alles umsonst gewesen. »Das fängt ja gut an!«, murrte ich, obschon ich mich längst dem Willen des Haushofmeisters und damit gewiss auch dem der Edlingers gebeugt hatte. Claras Erscheinung und
Willen des Haushofmeisters und damit gewiss auch dem der Edlingers gebeugt hatte. Claras Erscheinung und Lachen befreite mich von dieser Kränkung, erlöste mich aus meiner Trübsal. Schweigend standen wir uns
Lachen befreite mich von dieser Kränkung, erlöste mich aus meiner Trübsal. Schweigend standen wir uns gegenüber. Plötzlich sah Clara zu Boden. Ich folgte ihrem Blick. In diesem Moment raffte sie ein wenig den
gegenüber. Plötzlich sah Clara zu Boden. Ich folgte ihrem Blick. In diesem Moment raffte sie ein wenig den Reifrock ihres Kleides und trat einen kleinen Schritt zurück. Ein Taschentuch kam zum Vorschein. Ich hob es auf
Reifrock ihres Kleides und trat einen kleinen Schritt zurück. Ein Taschentuch kam zum Vorschein. Ich hob es auf und reichte es ihr. Sie errötete, nickte und lächelte.
und reichte es ihr. Sie errötete, nickte und lächelte.