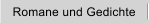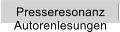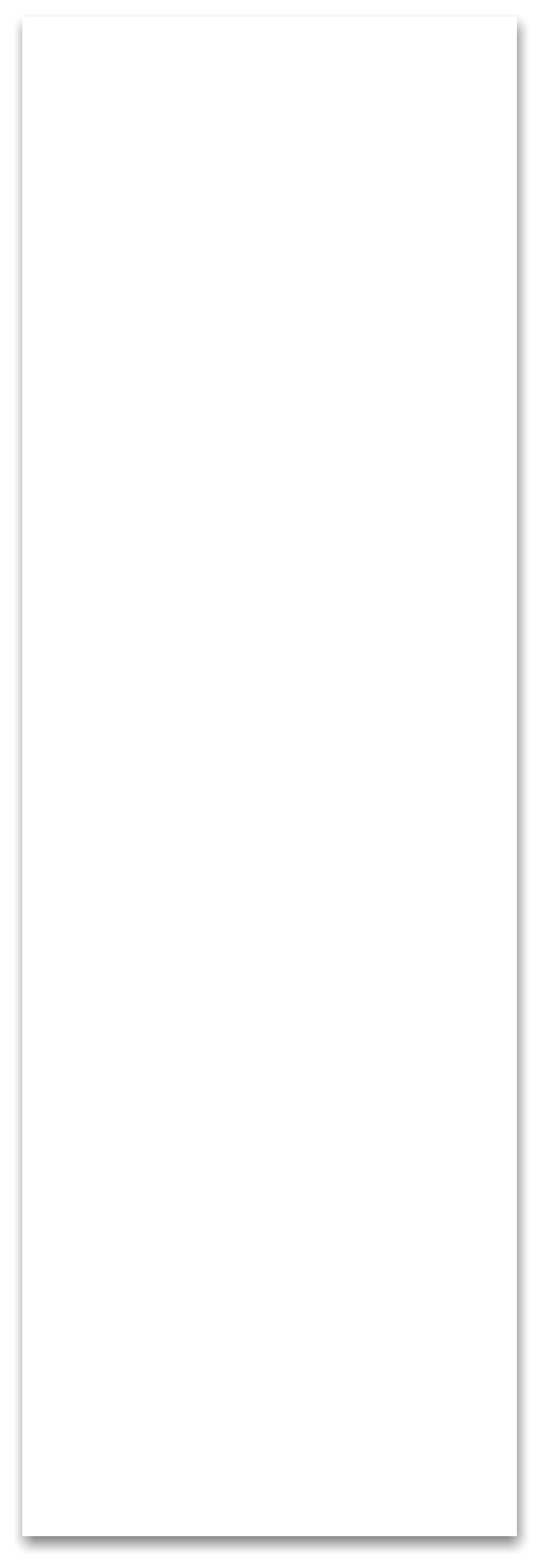
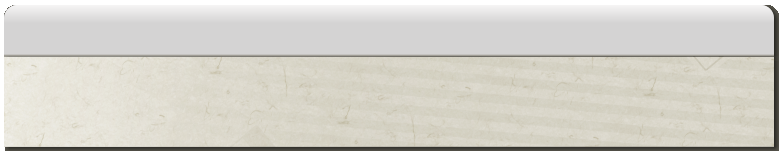


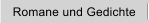
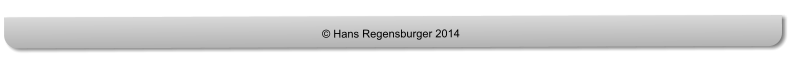
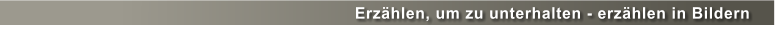 Marguerites Liebe - Der Gluck-Roman
Roman 2010
Schicksalhafte Begegnung mit Chevalier Christoph Willibald Gluck
276 Seiten; Orte und Zeit: Paris, Wien, Freystadt, Schmidmühle, Erasbach, Weidenwang und Berching, 1774 bis 1794
Textumfang ca. 115.000 Wörter
wek-Verlag Christel Keller, Treuchtlingen - Berlin
ISBN 978-3-934145-76-4; 19,80 €
Wegen der bevorstehenden Geschäftsauflösung des wek-Verlags kann der Roman bis zu einer eventuellen Neuauflage im
Spielberg Verlag Neumarkt direkt beim Autor vor Ort gekauft oder bei ihm bestellt werden - Versand vom Autor mit
Portoaufschlag.
Der Gluck-Roman
Historisches Epos - ein Sittengemälde
Zum Inhalt - 1774, nahe Paris
Marguerite, die Köchin, begegnet Pascal, dem Lehrer und Musikus. Sie wendet sich von ihrem mächtigen Geliebten ab. Dieser
lockt Pascal unter dem Vorwand nach Paris, bei den Musikdirektoren von Notre-Dame studieren zu können. In Wahrheit soll
ihm dort sein Hang zu neuen Melodien ausgetrieben werden, von denen Marguerite vereinnahmt wurde. Doch Pascal erlebt in
der Opéra die Musik von Christoph Willibald Gluck, die das Gegenteil in ihm bewirkt. Auch Marguerite verfällt ihr. Diese Musik
ist eine machtvolle, dramatische Poesie in Tönen, an der sich zunächst die Geister scheiden. Sie ist neu, revolutionär, zutiefst
menschlich wie ein Ruf nach Freiheit - der Herzschlag der Aufklärung. Es ist Marguerites und Pascals Schicksal, dass sie als
Köchin und Haushälterin und er als Notenkopist, Hausknecht und Kutscher bei der Familie Gluck Anstellung und Eingang
finden. Marguerite verzehrt sich nach der Musik, die dort entsteht. Diese Musik mochte sie wie eine Woge erfasst haben,
vielleicht wie zwei Jahrhunderte später die Rhythmen der Beatles, der Mythos Woodstock eine ganze Generation ergriff und
veränderte.
Und Marguerite zerbricht sich nicht den Kopf, ob sie für Pascal mehr Liebe empfindet oder für die Kunst des Kochens oder für
diese Musik. Plötzlich ein Bruch. Ihre heile Welt droht unterzugehen - wieder einmal.
Albert Löhner, Landrat des Landkreises Neumarkt i.d.OPf., schreibt über "Marguerites Liebe" und Christoph
Willibald Gluck:
Die großen Schöpfungen des Komponisten Christoph Willibald Gluck gründen auf unbedingter Menschlichkeit. In ihnen werden
Liebe, Freiheit und Leidenschaft offenbar. Und diese Musik lebt, und Gluck lebt in ihr fort. Wie ein roter Faden durchzieht sie
diese Geschichte - ein Sittengemälde vom Vorabend und der Zeit der Französischen Revolution. Dieser Roman geht in der
Musik auf, und die Musik geht in dessen faszinierender Sprache und Handlung auf. Ein in jeder Hinsicht wunderbares Buch.
Christoph Willibald Ritter von Gluck wurde m 2. Juli 1714 in Erasbach geboren. In der Pfarrkirche St. Willibald zu Weidenwang,
das von Erasbach nur einen Steinwurf weit entfernt liegt, empfing er am 4. Juli 1714 die Taufe. Beide Orte sind heute der Stadt
Berching angegliedert. Gluck selbst hat sich 1731 als ein Erasbacher ("Palatinus Erspachensis") an der Karlsuniversität in Prag
immatrikuliert. Als er sich 1750 mit der Wiener Kaufmannstochter Marianne Pergin vermählte, gab er an, aus Neumarkt in der
Oberpfalz zu stammen. Hier in dieser Gegend, an der Schnittstelle zu Franken, die heute im Landkreis Neumarkt i.d. OPf. liegt,
war man sich stets bewusst, dass man weit nach Süden und Norden sowie nach Osten und Westen reisen muss, um an einen
Ort zu gelangen, an dem ein Künstler von Glucks Format das Licht der Welt erblickte. Dieser erntete mit seinen Kompositionen
bereits zu Lebzeiten weltweiten Ruhm. Mit den Bühnenwerken Don Juan, Orpheus und Eurydike, Paris und Helena, Alceste,
Armida, Iphigenie in Aulis und Iphigenie auf Tauris erwarb er sich als Künstler Unsterblichkeit. Im Jahr 2014, wenn Glucks 300.
Geburtstag gefeiert werden kann, wird man ihn vielerorts auf der Welt in besonderer Weise würdigen. Es versteht sich von
selbst, dass sich der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. da einreihen wird, sich am liebsten an die Spitze setzen möchte.
Die Leserin oder der Leser C. Meyer schreibt über "Marguerites Liebe":
Dieses Buch hat wirklich 5 Sterne verdient, denn es ist sehr interessant geschrieben. Durch die ausgesprochen gute
Recherche der geschichtlichen Hintergründe, kann man indirekt sein Wissen wieder auffrischen. Am äußeren Aufbau hat mir
besonders die gewählte Sprache und der lange Satzbau gefallen. Das kann man entfernt mit Thomas Manns Schreibstil
vergleichen. Somit wird man mehr gefordert beim Lesen. Aber das Highlight ist natürlich der Inhalt. Er ist unverblümt,
dramatisch, ergreifend. Ich persönlich musste das Buch binnen Tagen regelrecht verschlingen. Schon lange hatte ich nicht
mehr einen so außergewöhnlichen Roman wie diesen in den Händen.
Leseprobe
Ab Seite 17 in Auszügen aus Kap. 2
Marguerite kochte das Mittagessen, begleitet von Gesang und Musik aus der eigenen Kehle. Sie fiel vom Singen ins
Summen, vom Pfeifen ins Singen, vom Summen ins Pfeifen, wechselte ohne erkennbaren Anlass, einmal abrupt, einmal
fließend von verzehrendem in beiläufigen Gesang, vom trällernden in wehmütiges Pfeifen, vom schmachtenden in
schauerliches Summen.
Der Abbé sah ihr zu; er saß im Reitersitz auf einem Stuhl neben der Tür, die Arme angewinkelt auf der Lehne ruhend.
Marguerite hantierte am Herd und an der Anrichte, flink und geschickt, denn für den Teig war rasches und zupackendes
Handeln geboten. Dieses Formenspiel unter dem langen Arbeitsgewand, diese Dynamik weiblicher Schlankheit waren ihm ein
vertrauter Anblick. Doch seit Montag vor einer Woche kam es ihm nur noch wie ein Trugbild vor. Seitdem war er an ihrer Seite
nicht mehr in den Mittagsschlaf gesunken. Fortan hatte sich zur erwarteten Stunde die Klinke an seiner Schlafkammertür nicht
mehr bewegt, und der Weg zu ihrer Schlafkammer war für ihn seit eh und je an der Tür zu Ende gewesen.
Marguerite schwieg sich darüber aus, nicht einmal ein Achselzucken erübrigte sie, tat so, als ob sie sein Flehen und Winseln
nach ihrem Schoß und Mund nicht hörte. Wie es schien, war sie ganz und gar ihren neuen Liedern und Melodien ergeben.
Lediglich am Sonntag nach der Frühmesse, das Brausen der Orgel, das ihr durch Mark und Bein gefahren war, noch in den
Gliedern, hatte sie dem Abbé erwidert: "Seit wir hier sind, bist du für die Leute in Chabrisonne mein Bruder; nun sollst du es
auch in meinen Augen sein!"
Henri Morrey kochte vor Wut. Im Hochamt missriet ihm, dem weithin bekannten und oftmals gerühmten Prediger, das
sonntägliche Wort an seine Gemeinde. Sein Missgeschick erreichte selbst die unaufmerksamsten und schläfrigsten Besucher
dieser Messe. Man blickte sich an. Dem Abbé entging nicht, dass so mancher Blick auf Marguerite zielte. Seitdem bewegte ihn,
wie er solch ein Luder je hatte begehren können; sie habe ihn, einen Geweihten, einen Mann Gottes, unablässig mit ihren
Bewegungen und ihrer Kochkunst verhext, um ihn schließlich Tag für Tag, unter den Augen Gottes, am helllichten Tag
verführen zu können. "Nein", beschwor er, "ich habe dieses Satansweib nie begehrt! Nie, nie, nie!" Der Abbé fuhr von seinem
Stuhl hoch und stieß ihn gegen die Wand, dass es krachte. Nicht einmal das Soufflé, das Marguerite vor seinen Augen
vorbereitete, konnte ihn besänftigen. Im Gegenteil, die Aussicht auf diese Köstlichkeit, der er nicht würde widerstehen können,
schien seine Wut erst recht angestachelt zu haben. "Du Luder", begann er auf sie einzuschreien, "singst dieselben
vermaledeiten Melodien wie dieser Kretin von einem Organisten sie in der Heiligen Messe zu spielen wagt." Dann stob er zur
Küche hinaus, sein priesterliches Hausgewand flog, und ein Zipfel seines Rockschoßes geriet zwischen Tür und Türstock. Die
eisernen Schöpfkellen, Bratspieße und Siebe über dem Herd schwangen klirrend gegeneinander. Im Nu stand er wieder in der
Küche und baute seine Gestalt, robust wie sie war, den beschädigten Rock in den Händen, vor Marguerite auf. Schnaubend
und geifernd hielt er ihr den Riss unter die Augen. "Da...", stieß er aus, "...nicht nur das hat dein Starrsinn mittlerweile
angerichtet. Du wirst das wieder in Ordnung bringen, bald, sonst...!" Wütend warf er ihr das Kleidungsstück vor die Füße, dann
rumpelte er wieder zur Küche hinaus und wuchtete hinter sich die Tür ins Schloss. Wo dieser Knall im Innern des Hauses an
Türen und Fenster brandete, vibrierte oder klapperte es. Kaum dass Marguerite mit den Vorbereitungen für das Soufflé zu
Ende gekommen war, erschien der Abbé erneut bei ihr. Unbeeindruckt davon machte sie sich an die nächste Tätigkeit und
dachte überhaupt nicht daran, von den Melodien zu lassen. Sie kannte sein Naturell und glaubte, dass er gar nicht anders
konnte, als mit seinem lautstarken Toben fortzufahren, das eins sein würde mit fuchtelnden Händen und weit ausholenden
Schritten. Doch er trat ihr gegenüber, blieb stehen, zähmte seine blindwütige Hast und wandte sich ihr zu. Nun wollte er seine
schwarzen Augen in ihre hellblauen versenken. In leisem Tonfall begann er: "Nicht einmal mehr in die Augen kannst du mir
schauen!" Marguerite öffnete, so weit sie konnte, ihre Augen, ihr Gesang verstummte.
"Jetzt erklärt sich mir vieles...!", zischte der Abbé mit Worten, so kalt und schneidend wie der Ostwind im Winter. "Aber nur Gott
weiß, wie lange du bereits nach den Chorstunden zu diesem Nichtswürdigen von einem Lehrer und Organisten ins Bett
schlüpfst. Oder treibt ihr es gar an geweihtem Ort? Auf der Orgelempore etwa - der Orgelbank oder hinter der Orgel? Von dir
lasse ich mir nichts mehr vormachen; deine ordinäre Singerei, sie hat dich überführt. Ich erwarte dich morgen, vor meinem
Mittagsschlaf, im Beichtstuhl. Solltest du mich versetzen, mich darin schmoren lassen, werde ich dir in der Heiligen Messe vor
aller Augen die Heilige Kommunion verweigern!"
Nach dem Tischgebet, beim Servieren der Vorspeise, spürte Marguerite den murmelnden Atem des Abbés. Sie erwartete,
dass er bald nicht mehr innehalten konnte…
…Marguerite wollte hinaus. Ihre Hände, mit denen sie zum benutzten Geschirr greifen wollte, zog sie wieder zurück.
In ihrer Kammer raffte sie die gegerbte Lammfelldecke, die ihr dort als Bettvorleger diente, zusammen und eilte in den
Garten. Sie tauchte ein in die Grelle, in die Hitze der Mittagssonne. Mit hohen Schritten durchs junge Gras erreichte sie ihr
Lieblingsplätzchen; dort breitete sie die Decke aus. Dieses Fleckchen hatte sie an einem der vorangegangen Tage vom ersten
Frühjahrswuchs befreit, um das sich dann im Stall die beiden Ziegen gerauft hatten. "Hätte ich nicht selbst zur Sichel gegriffen
und auf Léons Sense gewartet, würde mich das gute Gras reuen", murmelte sie dabei vor sich hin. Sie kauerte sich nieder.
Dort auf dem Erdboden glaubte sie vor jedweden Blicken sicher zu sein; deswegen kam ihr auf diesem Rasenstück auch kaum
ein Laut über die Lippen - selbst den Gesang unterließ sie.
Wie eine grüne Mauer waren die getrimmten Buchsbäume in ihrem Rücken. In der Form eines Hufeisens säumten sie dort
den weitläufigen Garten, begrenzte ihn zum tiefer gelegenen Bach hin. Das Blattwerk von zwei Fliederbüschen in Reichweite
von Marguerites Ruheplätzchen verschleierte den Blick ins Vorfeld. Dicken Wollsocken nicht unähnlich der Efeu, so wie er sich
an den armdicken Krummstämmen dieser Sträucher bereits emporgerankt hatte. Einige Schritte davor eine hohe, ausladende
Linde. Beschirmt von diesem Hitzesieb, das deren junges Blattwerk bereitete, hätte Marguerite die Sonne samt ihrer
sengenden Urgewalt verspotten können. Rechts davon in einer Diagonale die Schattenwürfe des Pfarrhauses und des
Kirchturmes; wie Schleier lagen sie über den knöcheltiefen Gräsern.
Halb zur Linken gelangte Marguerites Blick direkt zur Straße. Wer in Chabrisonne in die Nähe des Marktplatzes und der
Kirche kam, musste dieses Wegstück wohl oder übel passieren. Der Zaun schützte Marguerite vor ungebetenen Blicken. Wo
sie aber ruhte, konnte ihr Auge durch das Weidengeflecht finden. Dahinter, so glaubte sie, wären ihre Gemüsebeete,
Blumenreihen, Gewürz- und Heilkräuter vor dem Hausgeflügel sicher. Gänzlich sicher, ja unerschütterlich war in Chabrisonne
ihr Ruf als Köchin, Heil- und Kräuterkundige. Dort auf ihrem Lieblingsplätzchen wurde sie nur von der Katze entdeckt. Die
fleißige Mäuse- und Rattenjägerin strich durch Marguerites hochgestellte Knie, die ein Dreieck bildeten, sie streifte deren
Fesseln, sie drang unter deren Rock hindurch und umkreiste deren Oberschenkel und Rücken. Das alles in enger Tuchfühlung,
begleitet von Marguerites Murmeln, deren Lob, womit die Katze überschüttet wurde.
Marguerite und Pascal
Auf dem Chor, während der Sonntagsmesse, steckte ihm Marguerite ein Billett zu. Und er machte sich daran, das zu tun, was
auf dem Zettel geschrieben stand. Auf dem Weg vor den Ort haderte er noch mit sich, sein Zimmer umsonst geputzt zu haben.
Denn nun hatte sie ihr Kommen widerrufen.
"Zu gern hätte ich diese Arbeit der Hausmagd überlassen wie immer. Die Gute war schier außer sich vor Verwunderung, als
ich noch am Abend selbst Hand angelegt habe." Längst wieder unbehelligt von diesem Gedanken, stieß Pascal auf den
heckengesäumten Weg oberhalb des Baches. Nach Marguerites Notizen würde er auf diesem kaum ausgetretenen grünen
Pfad, über dem sich das Blattwerk der Sträucher und Bäume bereits geschlossen hatte, in den Pfarrgarten gelangen, dort auf
die Bienenstöcke des Abbés stoßen und bald darauf an den Stallungen vorbeikommen. Im Sonnenlicht sah er die Bienen
schwirren. Ihr Brummen lag dezent über der Stille, die dort herrschte, auch über dem Trubel aus dem Ort. Laut war es
gewesen, als er sich auf den Weg gemacht hatte. Auf dem Zettel warnte ihn Marguerite vor diesen Insekten. Vorsichtig,
beinahe den Atem anhaltend, pirschte er sich mit Storchenschritten voran. Ein Beobachter hätte sich angesichts dieses
gebückten Stelzganges eines Schmunzelns oder spöttischen Lachens kaum erwehren können. Doch von Bienen und Spott
unbehelligt, gelangte Pascal hinter die Stallungen. Als er sie passiert hatte, sah er die Tür, die vom Garten in das Pfarrhaus
führte. Durch sie sollte er ohne anzuklopfen eintreten. Damit endeten Marguerites Notizen.
Auf halber Strecke, im spärlichen Schutz der verblühten Obstbäume, vernahm er Marguerites Gesang. "Wie sie dieses alte
Lied singt ... Diese tiefe Stimme: schön, mir fehlen die Worte." Sobald er die Türklinke bewegte, brach Marguerite ab, mitten in
der Strophe. Wortlos und ohne ein Lächeln empfing sie ihn. Als sie den Riegel vorgewuchtet hatte, sagte sie: "Für April
ungewöhnlich warm heute. Marie und Léon waren nicht mehr zu halten - Sonntag und ein solches Wetter, da lässt die Guten
das Treiben auf den Märkten und in den Schänken nicht so schnell wieder los; später Abend wird es wohl werden ... Sogar hier
im Haus hört man noch davon. Ein Wunder, dass ihnen nicht ihr Mittagsmahl auf dem Weg ins Gesindehaus hinüber aus den
Händen geglitten war, so eilig hatten es die beiden." Sie schwieg.
"Wir sind allein heute", sagte sie nach einer Weile…
Marguerites Liebe - Der Gluck-Roman
Roman 2010
Schicksalhafte Begegnung mit Chevalier Christoph Willibald Gluck
276 Seiten; Orte und Zeit: Paris, Wien, Freystadt, Schmidmühle, Erasbach, Weidenwang und Berching, 1774 bis 1794
Textumfang ca. 115.000 Wörter
wek-Verlag Christel Keller, Treuchtlingen - Berlin
ISBN 978-3-934145-76-4; 19,80 €
Wegen der bevorstehenden Geschäftsauflösung des wek-Verlags kann der Roman bis zu einer eventuellen Neuauflage im
Spielberg Verlag Neumarkt direkt beim Autor vor Ort gekauft oder bei ihm bestellt werden - Versand vom Autor mit
Portoaufschlag.
Der Gluck-Roman
Historisches Epos - ein Sittengemälde
Zum Inhalt - 1774, nahe Paris
Marguerite, die Köchin, begegnet Pascal, dem Lehrer und Musikus. Sie wendet sich von ihrem mächtigen Geliebten ab. Dieser
lockt Pascal unter dem Vorwand nach Paris, bei den Musikdirektoren von Notre-Dame studieren zu können. In Wahrheit soll
ihm dort sein Hang zu neuen Melodien ausgetrieben werden, von denen Marguerite vereinnahmt wurde. Doch Pascal erlebt in
der Opéra die Musik von Christoph Willibald Gluck, die das Gegenteil in ihm bewirkt. Auch Marguerite verfällt ihr. Diese Musik
ist eine machtvolle, dramatische Poesie in Tönen, an der sich zunächst die Geister scheiden. Sie ist neu, revolutionär, zutiefst
menschlich wie ein Ruf nach Freiheit - der Herzschlag der Aufklärung. Es ist Marguerites und Pascals Schicksal, dass sie als
Köchin und Haushälterin und er als Notenkopist, Hausknecht und Kutscher bei der Familie Gluck Anstellung und Eingang
finden. Marguerite verzehrt sich nach der Musik, die dort entsteht. Diese Musik mochte sie wie eine Woge erfasst haben,
vielleicht wie zwei Jahrhunderte später die Rhythmen der Beatles, der Mythos Woodstock eine ganze Generation ergriff und
veränderte.
Und Marguerite zerbricht sich nicht den Kopf, ob sie für Pascal mehr Liebe empfindet oder für die Kunst des Kochens oder für
diese Musik. Plötzlich ein Bruch. Ihre heile Welt droht unterzugehen - wieder einmal.
Albert Löhner, Landrat des Landkreises Neumarkt i.d.OPf., schreibt über "Marguerites Liebe" und Christoph
Willibald Gluck:
Die großen Schöpfungen des Komponisten Christoph Willibald Gluck gründen auf unbedingter Menschlichkeit. In ihnen werden
Liebe, Freiheit und Leidenschaft offenbar. Und diese Musik lebt, und Gluck lebt in ihr fort. Wie ein roter Faden durchzieht sie
diese Geschichte - ein Sittengemälde vom Vorabend und der Zeit der Französischen Revolution. Dieser Roman geht in der
Musik auf, und die Musik geht in dessen faszinierender Sprache und Handlung auf. Ein in jeder Hinsicht wunderbares Buch.
Christoph Willibald Ritter von Gluck wurde m 2. Juli 1714 in Erasbach geboren. In der Pfarrkirche St. Willibald zu Weidenwang,
das von Erasbach nur einen Steinwurf weit entfernt liegt, empfing er am 4. Juli 1714 die Taufe. Beide Orte sind heute der Stadt
Berching angegliedert. Gluck selbst hat sich 1731 als ein Erasbacher ("Palatinus Erspachensis") an der Karlsuniversität in Prag
immatrikuliert. Als er sich 1750 mit der Wiener Kaufmannstochter Marianne Pergin vermählte, gab er an, aus Neumarkt in der
Oberpfalz zu stammen. Hier in dieser Gegend, an der Schnittstelle zu Franken, die heute im Landkreis Neumarkt i.d. OPf. liegt,
war man sich stets bewusst, dass man weit nach Süden und Norden sowie nach Osten und Westen reisen muss, um an einen
Ort zu gelangen, an dem ein Künstler von Glucks Format das Licht der Welt erblickte. Dieser erntete mit seinen Kompositionen
bereits zu Lebzeiten weltweiten Ruhm. Mit den Bühnenwerken Don Juan, Orpheus und Eurydike, Paris und Helena, Alceste,
Armida, Iphigenie in Aulis und Iphigenie auf Tauris erwarb er sich als Künstler Unsterblichkeit. Im Jahr 2014, wenn Glucks 300.
Geburtstag gefeiert werden kann, wird man ihn vielerorts auf der Welt in besonderer Weise würdigen. Es versteht sich von
selbst, dass sich der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. da einreihen wird, sich am liebsten an die Spitze setzen möchte.
Die Leserin oder der Leser C. Meyer schreibt über "Marguerites Liebe":
Dieses Buch hat wirklich 5 Sterne verdient, denn es ist sehr interessant geschrieben. Durch die ausgesprochen gute
Recherche der geschichtlichen Hintergründe, kann man indirekt sein Wissen wieder auffrischen. Am äußeren Aufbau hat mir
besonders die gewählte Sprache und der lange Satzbau gefallen. Das kann man entfernt mit Thomas Manns Schreibstil
vergleichen. Somit wird man mehr gefordert beim Lesen. Aber das Highlight ist natürlich der Inhalt. Er ist unverblümt,
dramatisch, ergreifend. Ich persönlich musste das Buch binnen Tagen regelrecht verschlingen. Schon lange hatte ich nicht
mehr einen so außergewöhnlichen Roman wie diesen in den Händen.
Leseprobe
Ab Seite 17 in Auszügen aus Kap. 2
Marguerite kochte das Mittagessen, begleitet von Gesang und Musik aus der eigenen Kehle. Sie fiel vom Singen ins
Summen, vom Pfeifen ins Singen, vom Summen ins Pfeifen, wechselte ohne erkennbaren Anlass, einmal abrupt, einmal
fließend von verzehrendem in beiläufigen Gesang, vom trällernden in wehmütiges Pfeifen, vom schmachtenden in
schauerliches Summen.
Der Abbé sah ihr zu; er saß im Reitersitz auf einem Stuhl neben der Tür, die Arme angewinkelt auf der Lehne ruhend.
Marguerite hantierte am Herd und an der Anrichte, flink und geschickt, denn für den Teig war rasches und zupackendes
Handeln geboten. Dieses Formenspiel unter dem langen Arbeitsgewand, diese Dynamik weiblicher Schlankheit waren ihm ein
vertrauter Anblick. Doch seit Montag vor einer Woche kam es ihm nur noch wie ein Trugbild vor. Seitdem war er an ihrer Seite
nicht mehr in den Mittagsschlaf gesunken. Fortan hatte sich zur erwarteten Stunde die Klinke an seiner Schlafkammertür nicht
mehr bewegt, und der Weg zu ihrer Schlafkammer war für ihn seit eh und je an der Tür zu Ende gewesen.
Marguerite schwieg sich darüber aus, nicht einmal ein Achselzucken erübrigte sie, tat so, als ob sie sein Flehen und Winseln
nach ihrem Schoß und Mund nicht hörte. Wie es schien, war sie ganz und gar ihren neuen Liedern und Melodien ergeben.
Lediglich am Sonntag nach der Frühmesse, das Brausen der Orgel, das ihr durch Mark und Bein gefahren war, noch in den
Gliedern, hatte sie dem Abbé erwidert: "Seit wir hier sind, bist du für die Leute in Chabrisonne mein Bruder; nun sollst du es
auch in meinen Augen sein!"
Henri Morrey kochte vor Wut. Im Hochamt missriet ihm, dem weithin bekannten und oftmals gerühmten Prediger, das
sonntägliche Wort an seine Gemeinde. Sein Missgeschick erreichte selbst die unaufmerksamsten und schläfrigsten Besucher
dieser Messe. Man blickte sich an. Dem Abbé entging nicht, dass so mancher Blick auf Marguerite zielte. Seitdem bewegte ihn,
wie er solch ein Luder je hatte begehren können; sie habe ihn, einen Geweihten, einen Mann Gottes, unablässig mit ihren
Bewegungen und ihrer Kochkunst verhext, um ihn schließlich Tag für Tag, unter den Augen Gottes, am helllichten Tag
verführen zu können. "Nein", beschwor er, "ich habe dieses Satansweib nie begehrt! Nie, nie, nie!" Der Abbé fuhr von seinem
Stuhl hoch und stieß ihn gegen die Wand, dass es krachte. Nicht einmal das Soufflé, das Marguerite vor seinen Augen
vorbereitete, konnte ihn besänftigen. Im Gegenteil, die Aussicht auf diese Köstlichkeit, der er nicht würde widerstehen können,
schien seine Wut erst recht angestachelt zu haben. "Du Luder", begann er auf sie einzuschreien, "singst dieselben
vermaledeiten Melodien wie dieser Kretin von einem Organisten sie in der Heiligen Messe zu spielen wagt." Dann stob er zur
Küche hinaus, sein priesterliches Hausgewand flog, und ein Zipfel seines Rockschoßes geriet zwischen Tür und Türstock. Die
eisernen Schöpfkellen, Bratspieße und Siebe über dem Herd schwangen klirrend gegeneinander. Im Nu stand er wieder in der
Küche und baute seine Gestalt, robust wie sie war, den beschädigten Rock in den Händen, vor Marguerite auf. Schnaubend
und geifernd hielt er ihr den Riss unter die Augen. "Da...", stieß er aus, "...nicht nur das hat dein Starrsinn mittlerweile
angerichtet. Du wirst das wieder in Ordnung bringen, bald, sonst...!" Wütend warf er ihr das Kleidungsstück vor die Füße, dann
rumpelte er wieder zur Küche hinaus und wuchtete hinter sich die Tür ins Schloss. Wo dieser Knall im Innern des Hauses an
Türen und Fenster brandete, vibrierte oder klapperte es. Kaum dass Marguerite mit den Vorbereitungen für das Soufflé zu
Ende gekommen war, erschien der Abbé erneut bei ihr. Unbeeindruckt davon machte sie sich an die nächste Tätigkeit und
dachte überhaupt nicht daran, von den Melodien zu lassen. Sie kannte sein Naturell und glaubte, dass er gar nicht anders
konnte, als mit seinem lautstarken Toben fortzufahren, das eins sein würde mit fuchtelnden Händen und weit ausholenden
Schritten. Doch er trat ihr gegenüber, blieb stehen, zähmte seine blindwütige Hast und wandte sich ihr zu. Nun wollte er seine
schwarzen Augen in ihre hellblauen versenken. In leisem Tonfall begann er: "Nicht einmal mehr in die Augen kannst du mir
schauen!" Marguerite öffnete, so weit sie konnte, ihre Augen, ihr Gesang verstummte.
"Jetzt erklärt sich mir vieles...!", zischte der Abbé mit Worten, so kalt und schneidend wie der Ostwind im Winter. "Aber nur Gott
weiß, wie lange du bereits nach den Chorstunden zu diesem Nichtswürdigen von einem Lehrer und Organisten ins Bett
schlüpfst. Oder treibt ihr es gar an geweihtem Ort? Auf der Orgelempore etwa - der Orgelbank oder hinter der Orgel? Von dir
lasse ich mir nichts mehr vormachen; deine ordinäre Singerei, sie hat dich überführt. Ich erwarte dich morgen, vor meinem
Mittagsschlaf, im Beichtstuhl. Solltest du mich versetzen, mich darin schmoren lassen, werde ich dir in der Heiligen Messe vor
aller Augen die Heilige Kommunion verweigern!"
Nach dem Tischgebet, beim Servieren der Vorspeise, spürte Marguerite den murmelnden Atem des Abbés. Sie erwartete,
dass er bald nicht mehr innehalten konnte…
…Marguerite wollte hinaus. Ihre Hände, mit denen sie zum benutzten Geschirr greifen wollte, zog sie wieder zurück.
In ihrer Kammer raffte sie die gegerbte Lammfelldecke, die ihr dort als Bettvorleger diente, zusammen und eilte in den
Garten. Sie tauchte ein in die Grelle, in die Hitze der Mittagssonne. Mit hohen Schritten durchs junge Gras erreichte sie ihr
Lieblingsplätzchen; dort breitete sie die Decke aus. Dieses Fleckchen hatte sie an einem der vorangegangen Tage vom ersten
Frühjahrswuchs befreit, um das sich dann im Stall die beiden Ziegen gerauft hatten. "Hätte ich nicht selbst zur Sichel gegriffen
und auf Léons Sense gewartet, würde mich das gute Gras reuen", murmelte sie dabei vor sich hin. Sie kauerte sich nieder.
Dort auf dem Erdboden glaubte sie vor jedweden Blicken sicher zu sein; deswegen kam ihr auf diesem Rasenstück auch kaum
ein Laut über die Lippen - selbst den Gesang unterließ sie.
Wie eine grüne Mauer waren die getrimmten Buchsbäume in ihrem Rücken. In der Form eines Hufeisens säumten sie dort
den weitläufigen Garten, begrenzte ihn zum tiefer gelegenen Bach hin. Das Blattwerk von zwei Fliederbüschen in Reichweite
von Marguerites Ruheplätzchen verschleierte den Blick ins Vorfeld. Dicken Wollsocken nicht unähnlich der Efeu, so wie er sich
an den armdicken Krummstämmen dieser Sträucher bereits emporgerankt hatte. Einige Schritte davor eine hohe, ausladende
Linde. Beschirmt von diesem Hitzesieb, das deren junges Blattwerk bereitete, hätte Marguerite die Sonne samt ihrer
sengenden Urgewalt verspotten können. Rechts davon in einer Diagonale die Schattenwürfe des Pfarrhauses und des
Kirchturmes; wie Schleier lagen sie über den knöcheltiefen Gräsern.
Halb zur Linken gelangte Marguerites Blick direkt zur Straße. Wer in Chabrisonne in die Nähe des Marktplatzes und der
Kirche kam, musste dieses Wegstück wohl oder übel passieren. Der Zaun schützte Marguerite vor ungebetenen Blicken. Wo
sie aber ruhte, konnte ihr Auge durch das Weidengeflecht finden. Dahinter, so glaubte sie, wären ihre Gemüsebeete,
Blumenreihen, Gewürz- und Heilkräuter vor dem Hausgeflügel sicher. Gänzlich sicher, ja unerschütterlich war in Chabrisonne
ihr Ruf als Köchin, Heil- und Kräuterkundige. Dort auf ihrem Lieblingsplätzchen wurde sie nur von der Katze entdeckt. Die
fleißige Mäuse- und Rattenjägerin strich durch Marguerites hochgestellte Knie, die ein Dreieck bildeten, sie streifte deren
Fesseln, sie drang unter deren Rock hindurch und umkreiste deren Oberschenkel und Rücken. Das alles in enger Tuchfühlung,
begleitet von Marguerites Murmeln, deren Lob, womit die Katze überschüttet wurde.
Marguerite und Pascal
Auf dem Chor, während der Sonntagsmesse, steckte ihm Marguerite ein Billett zu. Und er machte sich daran, das zu tun, was
auf dem Zettel geschrieben stand. Auf dem Weg vor den Ort haderte er noch mit sich, sein Zimmer umsonst geputzt zu haben.
Denn nun hatte sie ihr Kommen widerrufen.
"Zu gern hätte ich diese Arbeit der Hausmagd überlassen wie immer. Die Gute war schier außer sich vor Verwunderung, als
ich noch am Abend selbst Hand angelegt habe." Längst wieder unbehelligt von diesem Gedanken, stieß Pascal auf den
heckengesäumten Weg oberhalb des Baches. Nach Marguerites Notizen würde er auf diesem kaum ausgetretenen grünen
Pfad, über dem sich das Blattwerk der Sträucher und Bäume bereits geschlossen hatte, in den Pfarrgarten gelangen, dort auf
die Bienenstöcke des Abbés stoßen und bald darauf an den Stallungen vorbeikommen. Im Sonnenlicht sah er die Bienen
schwirren. Ihr Brummen lag dezent über der Stille, die dort herrschte, auch über dem Trubel aus dem Ort. Laut war es
gewesen, als er sich auf den Weg gemacht hatte. Auf dem Zettel warnte ihn Marguerite vor diesen Insekten. Vorsichtig,
beinahe den Atem anhaltend, pirschte er sich mit Storchenschritten voran. Ein Beobachter hätte sich angesichts dieses
gebückten Stelzganges eines Schmunzelns oder spöttischen Lachens kaum erwehren können. Doch von Bienen und Spott
unbehelligt, gelangte Pascal hinter die Stallungen. Als er sie passiert hatte, sah er die Tür, die vom Garten in das Pfarrhaus
führte. Durch sie sollte er ohne anzuklopfen eintreten. Damit endeten Marguerites Notizen.
Auf halber Strecke, im spärlichen Schutz der verblühten Obstbäume, vernahm er Marguerites Gesang. "Wie sie dieses alte
Lied singt ... Diese tiefe Stimme: schön, mir fehlen die Worte." Sobald er die Türklinke bewegte, brach Marguerite ab, mitten in
der Strophe. Wortlos und ohne ein Lächeln empfing sie ihn. Als sie den Riegel vorgewuchtet hatte, sagte sie: "Für April
ungewöhnlich warm heute. Marie und Léon waren nicht mehr zu halten - Sonntag und ein solches Wetter, da lässt die Guten
das Treiben auf den Märkten und in den Schänken nicht so schnell wieder los; später Abend wird es wohl werden ... Sogar hier
im Haus hört man noch davon. Ein Wunder, dass ihnen nicht ihr Mittagsmahl auf dem Weg ins Gesindehaus hinüber aus den
Händen geglitten war, so eilig hatten es die beiden." Sie schwieg.
"Wir sind allein heute", sagte sie nach einer Weile…






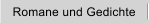
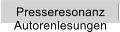



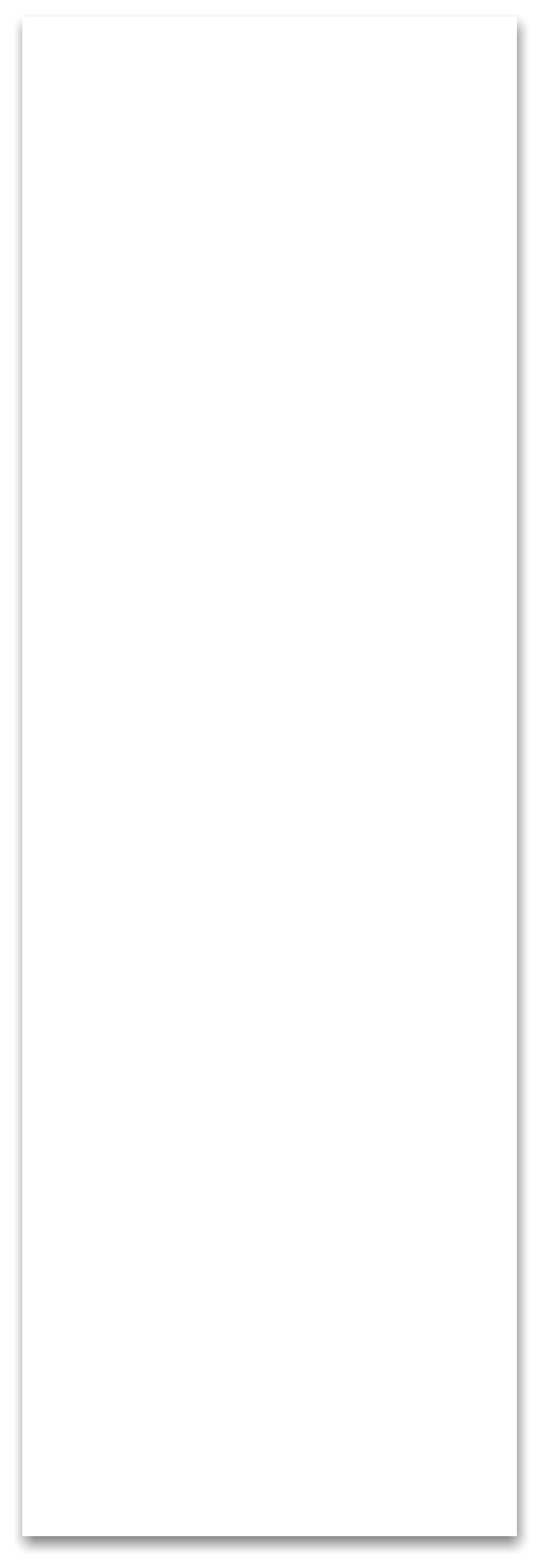
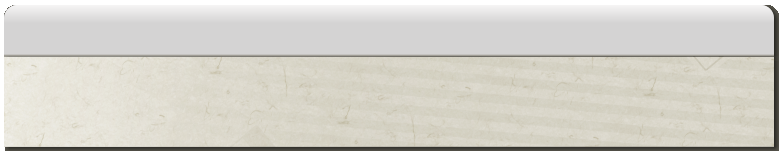


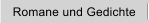
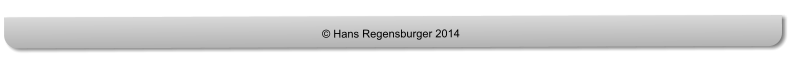
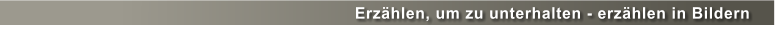 Marguerites Liebe - Der Gluck-Roman
Roman 2010
Schicksalhafte Begegnung mit Chevalier Christoph Willibald Gluck
276 Seiten; Orte und Zeit: Paris, Wien, Freystadt, Schmidmühle, Erasbach, Weidenwang und Berching, 1774 bis 1794
Textumfang ca. 115.000 Wörter
wek-Verlag Christel Keller, Treuchtlingen - Berlin
ISBN 978-3-934145-76-4; 19,80 €
Wegen der bevorstehenden Geschäftsauflösung des wek-Verlags kann der Roman bis zu einer eventuellen Neuauflage im
Spielberg Verlag Neumarkt direkt beim Autor vor Ort gekauft oder bei ihm bestellt werden - Versand vom Autor mit
Portoaufschlag.
Der Gluck-Roman
Historisches Epos - ein Sittengemälde
Zum Inhalt - 1774, nahe Paris
Marguerite, die Köchin, begegnet Pascal, dem Lehrer und Musikus. Sie wendet sich von ihrem mächtigen Geliebten ab. Dieser
lockt Pascal unter dem Vorwand nach Paris, bei den Musikdirektoren von Notre-Dame studieren zu können. In Wahrheit soll
ihm dort sein Hang zu neuen Melodien ausgetrieben werden, von denen Marguerite vereinnahmt wurde. Doch Pascal erlebt in
der Opéra die Musik von Christoph Willibald Gluck, die das Gegenteil in ihm bewirkt. Auch Marguerite verfällt ihr. Diese Musik
ist eine machtvolle, dramatische Poesie in Tönen, an der sich zunächst die Geister scheiden. Sie ist neu, revolutionär, zutiefst
menschlich wie ein Ruf nach Freiheit - der Herzschlag der Aufklärung. Es ist Marguerites und Pascals Schicksal, dass sie als
Köchin und Haushälterin und er als Notenkopist, Hausknecht und Kutscher bei der Familie Gluck Anstellung und Eingang
finden. Marguerite verzehrt sich nach der Musik, die dort entsteht. Diese Musik mochte sie wie eine Woge erfasst haben,
vielleicht wie zwei Jahrhunderte später die Rhythmen der Beatles, der Mythos Woodstock eine ganze Generation ergriff und
veränderte.
Und Marguerite zerbricht sich nicht den Kopf, ob sie für Pascal mehr Liebe empfindet oder für die Kunst des Kochens oder für
diese Musik. Plötzlich ein Bruch. Ihre heile Welt droht unterzugehen - wieder einmal.
Albert Löhner, Landrat des Landkreises Neumarkt i.d.OPf., schreibt über "Marguerites Liebe" und Christoph
Willibald Gluck:
Die großen Schöpfungen des Komponisten Christoph Willibald Gluck gründen auf unbedingter Menschlichkeit. In ihnen werden
Liebe, Freiheit und Leidenschaft offenbar. Und diese Musik lebt, und Gluck lebt in ihr fort. Wie ein roter Faden durchzieht sie
diese Geschichte - ein Sittengemälde vom Vorabend und der Zeit der Französischen Revolution. Dieser Roman geht in der
Musik auf, und die Musik geht in dessen faszinierender Sprache und Handlung auf. Ein in jeder Hinsicht wunderbares Buch.
Christoph Willibald Ritter von Gluck wurde m 2. Juli 1714 in Erasbach geboren. In der Pfarrkirche St. Willibald zu Weidenwang,
das von Erasbach nur einen Steinwurf weit entfernt liegt, empfing er am 4. Juli 1714 die Taufe. Beide Orte sind heute der Stadt
Berching angegliedert. Gluck selbst hat sich 1731 als ein Erasbacher ("Palatinus Erspachensis") an der Karlsuniversität in Prag
immatrikuliert. Als er sich 1750 mit der Wiener Kaufmannstochter Marianne Pergin vermählte, gab er an, aus Neumarkt in der
Oberpfalz zu stammen. Hier in dieser Gegend, an der Schnittstelle zu Franken, die heute im Landkreis Neumarkt i.d. OPf. liegt,
war man sich stets bewusst, dass man weit nach Süden und Norden sowie nach Osten und Westen reisen muss, um an einen
Ort zu gelangen, an dem ein Künstler von Glucks Format das Licht der Welt erblickte. Dieser erntete mit seinen Kompositionen
bereits zu Lebzeiten weltweiten Ruhm. Mit den Bühnenwerken Don Juan, Orpheus und Eurydike, Paris und Helena, Alceste,
Armida, Iphigenie in Aulis und Iphigenie auf Tauris erwarb er sich als Künstler Unsterblichkeit. Im Jahr 2014, wenn Glucks 300.
Geburtstag gefeiert werden kann, wird man ihn vielerorts auf der Welt in besonderer Weise würdigen. Es versteht sich von
selbst, dass sich der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. da einreihen wird, sich am liebsten an die Spitze setzen möchte.
Die Leserin oder der Leser C. Meyer schreibt über "Marguerites Liebe":
Dieses Buch hat wirklich 5 Sterne verdient, denn es ist sehr interessant geschrieben. Durch die ausgesprochen gute
Recherche der geschichtlichen Hintergründe, kann man indirekt sein Wissen wieder auffrischen. Am äußeren Aufbau hat mir
besonders die gewählte Sprache und der lange Satzbau gefallen. Das kann man entfernt mit Thomas Manns Schreibstil
vergleichen. Somit wird man mehr gefordert beim Lesen. Aber das Highlight ist natürlich der Inhalt. Er ist unverblümt,
dramatisch, ergreifend. Ich persönlich musste das Buch binnen Tagen regelrecht verschlingen. Schon lange hatte ich nicht
mehr einen so außergewöhnlichen Roman wie diesen in den Händen.
Leseprobe
Ab Seite 17 in Auszügen aus Kap. 2
Marguerite kochte das Mittagessen, begleitet von Gesang und Musik aus der eigenen Kehle. Sie fiel vom Singen ins
Summen, vom Pfeifen ins Singen, vom Summen ins Pfeifen, wechselte ohne erkennbaren Anlass, einmal abrupt, einmal
fließend von verzehrendem in beiläufigen Gesang, vom trällernden in wehmütiges Pfeifen, vom schmachtenden in
schauerliches Summen.
Der Abbé sah ihr zu; er saß im Reitersitz auf einem Stuhl neben der Tür, die Arme angewinkelt auf der Lehne ruhend.
Marguerite hantierte am Herd und an der Anrichte, flink und geschickt, denn für den Teig war rasches und zupackendes
Handeln geboten. Dieses Formenspiel unter dem langen Arbeitsgewand, diese Dynamik weiblicher Schlankheit waren ihm ein
vertrauter Anblick. Doch seit Montag vor einer Woche kam es ihm nur noch wie ein Trugbild vor. Seitdem war er an ihrer Seite
nicht mehr in den Mittagsschlaf gesunken. Fortan hatte sich zur erwarteten Stunde die Klinke an seiner Schlafkammertür nicht
mehr bewegt, und der Weg zu ihrer Schlafkammer war für ihn seit eh und je an der Tür zu Ende gewesen.
Marguerite schwieg sich darüber aus, nicht einmal ein Achselzucken erübrigte sie, tat so, als ob sie sein Flehen und Winseln
nach ihrem Schoß und Mund nicht hörte. Wie es schien, war sie ganz und gar ihren neuen Liedern und Melodien ergeben.
Lediglich am Sonntag nach der Frühmesse, das Brausen der Orgel, das ihr durch Mark und Bein gefahren war, noch in den
Gliedern, hatte sie dem Abbé erwidert: "Seit wir hier sind, bist du für die Leute in Chabrisonne mein Bruder; nun sollst du es
auch in meinen Augen sein!"
Henri Morrey kochte vor Wut. Im Hochamt missriet ihm, dem weithin bekannten und oftmals gerühmten Prediger, das
sonntägliche Wort an seine Gemeinde. Sein Missgeschick erreichte selbst die unaufmerksamsten und schläfrigsten Besucher
dieser Messe. Man blickte sich an. Dem Abbé entging nicht, dass so mancher Blick auf Marguerite zielte. Seitdem bewegte ihn,
wie er solch ein Luder je hatte begehren können; sie habe ihn, einen Geweihten, einen Mann Gottes, unablässig mit ihren
Bewegungen und ihrer Kochkunst verhext, um ihn schließlich Tag für Tag, unter den Augen Gottes, am helllichten Tag
verführen zu können. "Nein", beschwor er, "ich habe dieses Satansweib nie begehrt! Nie, nie, nie!" Der Abbé fuhr von seinem
Stuhl hoch und stieß ihn gegen die Wand, dass es krachte. Nicht einmal das Soufflé, das Marguerite vor seinen Augen
vorbereitete, konnte ihn besänftigen. Im Gegenteil, die Aussicht auf diese Köstlichkeit, der er nicht würde widerstehen können,
schien seine Wut erst recht angestachelt zu haben. "Du Luder", begann er auf sie einzuschreien, "singst dieselben
vermaledeiten Melodien wie dieser Kretin von einem Organisten sie in der Heiligen Messe zu spielen wagt." Dann stob er zur
Küche hinaus, sein priesterliches Hausgewand flog, und ein Zipfel seines Rockschoßes geriet zwischen Tür und Türstock. Die
eisernen Schöpfkellen, Bratspieße und Siebe über dem Herd schwangen klirrend gegeneinander. Im Nu stand er wieder in der
Küche und baute seine Gestalt, robust wie sie war, den beschädigten Rock in den Händen, vor Marguerite auf. Schnaubend
und geifernd hielt er ihr den Riss unter die Augen. "Da...", stieß er aus, "...nicht nur das hat dein Starrsinn mittlerweile
angerichtet. Du wirst das wieder in Ordnung bringen, bald, sonst...!" Wütend warf er ihr das Kleidungsstück vor die Füße, dann
rumpelte er wieder zur Küche hinaus und wuchtete hinter sich die Tür ins Schloss. Wo dieser Knall im Innern des Hauses an
Türen und Fenster brandete, vibrierte oder klapperte es. Kaum dass Marguerite mit den Vorbereitungen für das Soufflé zu
Ende gekommen war, erschien der Abbé erneut bei ihr. Unbeeindruckt davon machte sie sich an die nächste Tätigkeit und
dachte überhaupt nicht daran, von den Melodien zu lassen. Sie kannte sein Naturell und glaubte, dass er gar nicht anders
konnte, als mit seinem lautstarken Toben fortzufahren, das eins sein würde mit fuchtelnden Händen und weit ausholenden
Schritten. Doch er trat ihr gegenüber, blieb stehen, zähmte seine blindwütige Hast und wandte sich ihr zu. Nun wollte er seine
schwarzen Augen in ihre hellblauen versenken. In leisem Tonfall begann er: "Nicht einmal mehr in die Augen kannst du mir
schauen!" Marguerite öffnete, so weit sie konnte, ihre Augen, ihr Gesang verstummte.
"Jetzt erklärt sich mir vieles...!", zischte der Abbé mit Worten, so kalt und schneidend wie der Ostwind im Winter. "Aber nur Gott
weiß, wie lange du bereits nach den Chorstunden zu diesem Nichtswürdigen von einem Lehrer und Organisten ins Bett
schlüpfst. Oder treibt ihr es gar an geweihtem Ort? Auf der Orgelempore etwa - der Orgelbank oder hinter der Orgel? Von dir
lasse ich mir nichts mehr vormachen; deine ordinäre Singerei, sie hat dich überführt. Ich erwarte dich morgen, vor meinem
Mittagsschlaf, im Beichtstuhl. Solltest du mich versetzen, mich darin schmoren lassen, werde ich dir in der Heiligen Messe vor
aller Augen die Heilige Kommunion verweigern!"
Nach dem Tischgebet, beim Servieren der Vorspeise, spürte Marguerite den murmelnden Atem des Abbés. Sie erwartete,
dass er bald nicht mehr innehalten konnte…
…Marguerite wollte hinaus. Ihre Hände, mit denen sie zum benutzten Geschirr greifen wollte, zog sie wieder zurück.
In ihrer Kammer raffte sie die gegerbte Lammfelldecke, die ihr dort als Bettvorleger diente, zusammen und eilte in den
Garten. Sie tauchte ein in die Grelle, in die Hitze der Mittagssonne. Mit hohen Schritten durchs junge Gras erreichte sie ihr
Lieblingsplätzchen; dort breitete sie die Decke aus. Dieses Fleckchen hatte sie an einem der vorangegangen Tage vom ersten
Frühjahrswuchs befreit, um das sich dann im Stall die beiden Ziegen gerauft hatten. "Hätte ich nicht selbst zur Sichel gegriffen
und auf Léons Sense gewartet, würde mich das gute Gras reuen", murmelte sie dabei vor sich hin. Sie kauerte sich nieder.
Dort auf dem Erdboden glaubte sie vor jedweden Blicken sicher zu sein; deswegen kam ihr auf diesem Rasenstück auch kaum
ein Laut über die Lippen - selbst den Gesang unterließ sie.
Wie eine grüne Mauer waren die getrimmten Buchsbäume in ihrem Rücken. In der Form eines Hufeisens säumten sie dort
den weitläufigen Garten, begrenzte ihn zum tiefer gelegenen Bach hin. Das Blattwerk von zwei Fliederbüschen in Reichweite
von Marguerites Ruheplätzchen verschleierte den Blick ins Vorfeld. Dicken Wollsocken nicht unähnlich der Efeu, so wie er sich
an den armdicken Krummstämmen dieser Sträucher bereits emporgerankt hatte. Einige Schritte davor eine hohe, ausladende
Linde. Beschirmt von diesem Hitzesieb, das deren junges Blattwerk bereitete, hätte Marguerite die Sonne samt ihrer
sengenden Urgewalt verspotten können. Rechts davon in einer Diagonale die Schattenwürfe des Pfarrhauses und des
Kirchturmes; wie Schleier lagen sie über den knöcheltiefen Gräsern.
Halb zur Linken gelangte Marguerites Blick direkt zur Straße. Wer in Chabrisonne in die Nähe des Marktplatzes und der
Kirche kam, musste dieses Wegstück wohl oder übel passieren. Der Zaun schützte Marguerite vor ungebetenen Blicken. Wo
sie aber ruhte, konnte ihr Auge durch das Weidengeflecht finden. Dahinter, so glaubte sie, wären ihre Gemüsebeete,
Blumenreihen, Gewürz- und Heilkräuter vor dem Hausgeflügel sicher. Gänzlich sicher, ja unerschütterlich war in Chabrisonne
ihr Ruf als Köchin, Heil- und Kräuterkundige. Dort auf ihrem Lieblingsplätzchen wurde sie nur von der Katze entdeckt. Die
fleißige Mäuse- und Rattenjägerin strich durch Marguerites hochgestellte Knie, die ein Dreieck bildeten, sie streifte deren
Fesseln, sie drang unter deren Rock hindurch und umkreiste deren Oberschenkel und Rücken. Das alles in enger Tuchfühlung,
begleitet von Marguerites Murmeln, deren Lob, womit die Katze überschüttet wurde.
Marguerite und Pascal
Auf dem Chor, während der Sonntagsmesse, steckte ihm Marguerite ein Billett zu. Und er machte sich daran, das zu tun, was
auf dem Zettel geschrieben stand. Auf dem Weg vor den Ort haderte er noch mit sich, sein Zimmer umsonst geputzt zu haben.
Denn nun hatte sie ihr Kommen widerrufen.
"Zu gern hätte ich diese Arbeit der Hausmagd überlassen wie immer. Die Gute war schier außer sich vor Verwunderung, als
ich noch am Abend selbst Hand angelegt habe." Längst wieder unbehelligt von diesem Gedanken, stieß Pascal auf den
heckengesäumten Weg oberhalb des Baches. Nach Marguerites Notizen würde er auf diesem kaum ausgetretenen grünen
Pfad, über dem sich das Blattwerk der Sträucher und Bäume bereits geschlossen hatte, in den Pfarrgarten gelangen, dort auf
die Bienenstöcke des Abbés stoßen und bald darauf an den Stallungen vorbeikommen. Im Sonnenlicht sah er die Bienen
schwirren. Ihr Brummen lag dezent über der Stille, die dort herrschte, auch über dem Trubel aus dem Ort. Laut war es
gewesen, als er sich auf den Weg gemacht hatte. Auf dem Zettel warnte ihn Marguerite vor diesen Insekten. Vorsichtig,
beinahe den Atem anhaltend, pirschte er sich mit Storchenschritten voran. Ein Beobachter hätte sich angesichts dieses
gebückten Stelzganges eines Schmunzelns oder spöttischen Lachens kaum erwehren können. Doch von Bienen und Spott
unbehelligt, gelangte Pascal hinter die Stallungen. Als er sie passiert hatte, sah er die Tür, die vom Garten in das Pfarrhaus
führte. Durch sie sollte er ohne anzuklopfen eintreten. Damit endeten Marguerites Notizen.
Auf halber Strecke, im spärlichen Schutz der verblühten Obstbäume, vernahm er Marguerites Gesang. "Wie sie dieses alte
Lied singt ... Diese tiefe Stimme: schön, mir fehlen die Worte." Sobald er die Türklinke bewegte, brach Marguerite ab, mitten in
der Strophe. Wortlos und ohne ein Lächeln empfing sie ihn. Als sie den Riegel vorgewuchtet hatte, sagte sie: "Für April
ungewöhnlich warm heute. Marie und Léon waren nicht mehr zu halten - Sonntag und ein solches Wetter, da lässt die Guten
das Treiben auf den Märkten und in den Schänken nicht so schnell wieder los; später Abend wird es wohl werden ... Sogar hier
im Haus hört man noch davon. Ein Wunder, dass ihnen nicht ihr Mittagsmahl auf dem Weg ins Gesindehaus hinüber aus den
Händen geglitten war, so eilig hatten es die beiden." Sie schwieg.
"Wir sind allein heute", sagte sie nach einer Weile…
Marguerites Liebe - Der Gluck-Roman
Roman 2010
Schicksalhafte Begegnung mit Chevalier Christoph Willibald Gluck
276 Seiten; Orte und Zeit: Paris, Wien, Freystadt, Schmidmühle, Erasbach, Weidenwang und Berching, 1774 bis 1794
Textumfang ca. 115.000 Wörter
wek-Verlag Christel Keller, Treuchtlingen - Berlin
ISBN 978-3-934145-76-4; 19,80 €
Wegen der bevorstehenden Geschäftsauflösung des wek-Verlags kann der Roman bis zu einer eventuellen Neuauflage im
Spielberg Verlag Neumarkt direkt beim Autor vor Ort gekauft oder bei ihm bestellt werden - Versand vom Autor mit
Portoaufschlag.
Der Gluck-Roman
Historisches Epos - ein Sittengemälde
Zum Inhalt - 1774, nahe Paris
Marguerite, die Köchin, begegnet Pascal, dem Lehrer und Musikus. Sie wendet sich von ihrem mächtigen Geliebten ab. Dieser
lockt Pascal unter dem Vorwand nach Paris, bei den Musikdirektoren von Notre-Dame studieren zu können. In Wahrheit soll
ihm dort sein Hang zu neuen Melodien ausgetrieben werden, von denen Marguerite vereinnahmt wurde. Doch Pascal erlebt in
der Opéra die Musik von Christoph Willibald Gluck, die das Gegenteil in ihm bewirkt. Auch Marguerite verfällt ihr. Diese Musik
ist eine machtvolle, dramatische Poesie in Tönen, an der sich zunächst die Geister scheiden. Sie ist neu, revolutionär, zutiefst
menschlich wie ein Ruf nach Freiheit - der Herzschlag der Aufklärung. Es ist Marguerites und Pascals Schicksal, dass sie als
Köchin und Haushälterin und er als Notenkopist, Hausknecht und Kutscher bei der Familie Gluck Anstellung und Eingang
finden. Marguerite verzehrt sich nach der Musik, die dort entsteht. Diese Musik mochte sie wie eine Woge erfasst haben,
vielleicht wie zwei Jahrhunderte später die Rhythmen der Beatles, der Mythos Woodstock eine ganze Generation ergriff und
veränderte.
Und Marguerite zerbricht sich nicht den Kopf, ob sie für Pascal mehr Liebe empfindet oder für die Kunst des Kochens oder für
diese Musik. Plötzlich ein Bruch. Ihre heile Welt droht unterzugehen - wieder einmal.
Albert Löhner, Landrat des Landkreises Neumarkt i.d.OPf., schreibt über "Marguerites Liebe" und Christoph
Willibald Gluck:
Die großen Schöpfungen des Komponisten Christoph Willibald Gluck gründen auf unbedingter Menschlichkeit. In ihnen werden
Liebe, Freiheit und Leidenschaft offenbar. Und diese Musik lebt, und Gluck lebt in ihr fort. Wie ein roter Faden durchzieht sie
diese Geschichte - ein Sittengemälde vom Vorabend und der Zeit der Französischen Revolution. Dieser Roman geht in der
Musik auf, und die Musik geht in dessen faszinierender Sprache und Handlung auf. Ein in jeder Hinsicht wunderbares Buch.
Christoph Willibald Ritter von Gluck wurde m 2. Juli 1714 in Erasbach geboren. In der Pfarrkirche St. Willibald zu Weidenwang,
das von Erasbach nur einen Steinwurf weit entfernt liegt, empfing er am 4. Juli 1714 die Taufe. Beide Orte sind heute der Stadt
Berching angegliedert. Gluck selbst hat sich 1731 als ein Erasbacher ("Palatinus Erspachensis") an der Karlsuniversität in Prag
immatrikuliert. Als er sich 1750 mit der Wiener Kaufmannstochter Marianne Pergin vermählte, gab er an, aus Neumarkt in der
Oberpfalz zu stammen. Hier in dieser Gegend, an der Schnittstelle zu Franken, die heute im Landkreis Neumarkt i.d. OPf. liegt,
war man sich stets bewusst, dass man weit nach Süden und Norden sowie nach Osten und Westen reisen muss, um an einen
Ort zu gelangen, an dem ein Künstler von Glucks Format das Licht der Welt erblickte. Dieser erntete mit seinen Kompositionen
bereits zu Lebzeiten weltweiten Ruhm. Mit den Bühnenwerken Don Juan, Orpheus und Eurydike, Paris und Helena, Alceste,
Armida, Iphigenie in Aulis und Iphigenie auf Tauris erwarb er sich als Künstler Unsterblichkeit. Im Jahr 2014, wenn Glucks 300.
Geburtstag gefeiert werden kann, wird man ihn vielerorts auf der Welt in besonderer Weise würdigen. Es versteht sich von
selbst, dass sich der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. da einreihen wird, sich am liebsten an die Spitze setzen möchte.
Die Leserin oder der Leser C. Meyer schreibt über "Marguerites Liebe":
Dieses Buch hat wirklich 5 Sterne verdient, denn es ist sehr interessant geschrieben. Durch die ausgesprochen gute
Recherche der geschichtlichen Hintergründe, kann man indirekt sein Wissen wieder auffrischen. Am äußeren Aufbau hat mir
besonders die gewählte Sprache und der lange Satzbau gefallen. Das kann man entfernt mit Thomas Manns Schreibstil
vergleichen. Somit wird man mehr gefordert beim Lesen. Aber das Highlight ist natürlich der Inhalt. Er ist unverblümt,
dramatisch, ergreifend. Ich persönlich musste das Buch binnen Tagen regelrecht verschlingen. Schon lange hatte ich nicht
mehr einen so außergewöhnlichen Roman wie diesen in den Händen.
Leseprobe
Ab Seite 17 in Auszügen aus Kap. 2
Marguerite kochte das Mittagessen, begleitet von Gesang und Musik aus der eigenen Kehle. Sie fiel vom Singen ins
Summen, vom Pfeifen ins Singen, vom Summen ins Pfeifen, wechselte ohne erkennbaren Anlass, einmal abrupt, einmal
fließend von verzehrendem in beiläufigen Gesang, vom trällernden in wehmütiges Pfeifen, vom schmachtenden in
schauerliches Summen.
Der Abbé sah ihr zu; er saß im Reitersitz auf einem Stuhl neben der Tür, die Arme angewinkelt auf der Lehne ruhend.
Marguerite hantierte am Herd und an der Anrichte, flink und geschickt, denn für den Teig war rasches und zupackendes
Handeln geboten. Dieses Formenspiel unter dem langen Arbeitsgewand, diese Dynamik weiblicher Schlankheit waren ihm ein
vertrauter Anblick. Doch seit Montag vor einer Woche kam es ihm nur noch wie ein Trugbild vor. Seitdem war er an ihrer Seite
nicht mehr in den Mittagsschlaf gesunken. Fortan hatte sich zur erwarteten Stunde die Klinke an seiner Schlafkammertür nicht
mehr bewegt, und der Weg zu ihrer Schlafkammer war für ihn seit eh und je an der Tür zu Ende gewesen.
Marguerite schwieg sich darüber aus, nicht einmal ein Achselzucken erübrigte sie, tat so, als ob sie sein Flehen und Winseln
nach ihrem Schoß und Mund nicht hörte. Wie es schien, war sie ganz und gar ihren neuen Liedern und Melodien ergeben.
Lediglich am Sonntag nach der Frühmesse, das Brausen der Orgel, das ihr durch Mark und Bein gefahren war, noch in den
Gliedern, hatte sie dem Abbé erwidert: "Seit wir hier sind, bist du für die Leute in Chabrisonne mein Bruder; nun sollst du es
auch in meinen Augen sein!"
Henri Morrey kochte vor Wut. Im Hochamt missriet ihm, dem weithin bekannten und oftmals gerühmten Prediger, das
sonntägliche Wort an seine Gemeinde. Sein Missgeschick erreichte selbst die unaufmerksamsten und schläfrigsten Besucher
dieser Messe. Man blickte sich an. Dem Abbé entging nicht, dass so mancher Blick auf Marguerite zielte. Seitdem bewegte ihn,
wie er solch ein Luder je hatte begehren können; sie habe ihn, einen Geweihten, einen Mann Gottes, unablässig mit ihren
Bewegungen und ihrer Kochkunst verhext, um ihn schließlich Tag für Tag, unter den Augen Gottes, am helllichten Tag
verführen zu können. "Nein", beschwor er, "ich habe dieses Satansweib nie begehrt! Nie, nie, nie!" Der Abbé fuhr von seinem
Stuhl hoch und stieß ihn gegen die Wand, dass es krachte. Nicht einmal das Soufflé, das Marguerite vor seinen Augen
vorbereitete, konnte ihn besänftigen. Im Gegenteil, die Aussicht auf diese Köstlichkeit, der er nicht würde widerstehen können,
schien seine Wut erst recht angestachelt zu haben. "Du Luder", begann er auf sie einzuschreien, "singst dieselben
vermaledeiten Melodien wie dieser Kretin von einem Organisten sie in der Heiligen Messe zu spielen wagt." Dann stob er zur
Küche hinaus, sein priesterliches Hausgewand flog, und ein Zipfel seines Rockschoßes geriet zwischen Tür und Türstock. Die
eisernen Schöpfkellen, Bratspieße und Siebe über dem Herd schwangen klirrend gegeneinander. Im Nu stand er wieder in der
Küche und baute seine Gestalt, robust wie sie war, den beschädigten Rock in den Händen, vor Marguerite auf. Schnaubend
und geifernd hielt er ihr den Riss unter die Augen. "Da...", stieß er aus, "...nicht nur das hat dein Starrsinn mittlerweile
angerichtet. Du wirst das wieder in Ordnung bringen, bald, sonst...!" Wütend warf er ihr das Kleidungsstück vor die Füße, dann
rumpelte er wieder zur Küche hinaus und wuchtete hinter sich die Tür ins Schloss. Wo dieser Knall im Innern des Hauses an
Türen und Fenster brandete, vibrierte oder klapperte es. Kaum dass Marguerite mit den Vorbereitungen für das Soufflé zu
Ende gekommen war, erschien der Abbé erneut bei ihr. Unbeeindruckt davon machte sie sich an die nächste Tätigkeit und
dachte überhaupt nicht daran, von den Melodien zu lassen. Sie kannte sein Naturell und glaubte, dass er gar nicht anders
konnte, als mit seinem lautstarken Toben fortzufahren, das eins sein würde mit fuchtelnden Händen und weit ausholenden
Schritten. Doch er trat ihr gegenüber, blieb stehen, zähmte seine blindwütige Hast und wandte sich ihr zu. Nun wollte er seine
schwarzen Augen in ihre hellblauen versenken. In leisem Tonfall begann er: "Nicht einmal mehr in die Augen kannst du mir
schauen!" Marguerite öffnete, so weit sie konnte, ihre Augen, ihr Gesang verstummte.
"Jetzt erklärt sich mir vieles...!", zischte der Abbé mit Worten, so kalt und schneidend wie der Ostwind im Winter. "Aber nur Gott
weiß, wie lange du bereits nach den Chorstunden zu diesem Nichtswürdigen von einem Lehrer und Organisten ins Bett
schlüpfst. Oder treibt ihr es gar an geweihtem Ort? Auf der Orgelempore etwa - der Orgelbank oder hinter der Orgel? Von dir
lasse ich mir nichts mehr vormachen; deine ordinäre Singerei, sie hat dich überführt. Ich erwarte dich morgen, vor meinem
Mittagsschlaf, im Beichtstuhl. Solltest du mich versetzen, mich darin schmoren lassen, werde ich dir in der Heiligen Messe vor
aller Augen die Heilige Kommunion verweigern!"
Nach dem Tischgebet, beim Servieren der Vorspeise, spürte Marguerite den murmelnden Atem des Abbés. Sie erwartete,
dass er bald nicht mehr innehalten konnte…
…Marguerite wollte hinaus. Ihre Hände, mit denen sie zum benutzten Geschirr greifen wollte, zog sie wieder zurück.
In ihrer Kammer raffte sie die gegerbte Lammfelldecke, die ihr dort als Bettvorleger diente, zusammen und eilte in den
Garten. Sie tauchte ein in die Grelle, in die Hitze der Mittagssonne. Mit hohen Schritten durchs junge Gras erreichte sie ihr
Lieblingsplätzchen; dort breitete sie die Decke aus. Dieses Fleckchen hatte sie an einem der vorangegangen Tage vom ersten
Frühjahrswuchs befreit, um das sich dann im Stall die beiden Ziegen gerauft hatten. "Hätte ich nicht selbst zur Sichel gegriffen
und auf Léons Sense gewartet, würde mich das gute Gras reuen", murmelte sie dabei vor sich hin. Sie kauerte sich nieder.
Dort auf dem Erdboden glaubte sie vor jedweden Blicken sicher zu sein; deswegen kam ihr auf diesem Rasenstück auch kaum
ein Laut über die Lippen - selbst den Gesang unterließ sie.
Wie eine grüne Mauer waren die getrimmten Buchsbäume in ihrem Rücken. In der Form eines Hufeisens säumten sie dort
den weitläufigen Garten, begrenzte ihn zum tiefer gelegenen Bach hin. Das Blattwerk von zwei Fliederbüschen in Reichweite
von Marguerites Ruheplätzchen verschleierte den Blick ins Vorfeld. Dicken Wollsocken nicht unähnlich der Efeu, so wie er sich
an den armdicken Krummstämmen dieser Sträucher bereits emporgerankt hatte. Einige Schritte davor eine hohe, ausladende
Linde. Beschirmt von diesem Hitzesieb, das deren junges Blattwerk bereitete, hätte Marguerite die Sonne samt ihrer
sengenden Urgewalt verspotten können. Rechts davon in einer Diagonale die Schattenwürfe des Pfarrhauses und des
Kirchturmes; wie Schleier lagen sie über den knöcheltiefen Gräsern.
Halb zur Linken gelangte Marguerites Blick direkt zur Straße. Wer in Chabrisonne in die Nähe des Marktplatzes und der
Kirche kam, musste dieses Wegstück wohl oder übel passieren. Der Zaun schützte Marguerite vor ungebetenen Blicken. Wo
sie aber ruhte, konnte ihr Auge durch das Weidengeflecht finden. Dahinter, so glaubte sie, wären ihre Gemüsebeete,
Blumenreihen, Gewürz- und Heilkräuter vor dem Hausgeflügel sicher. Gänzlich sicher, ja unerschütterlich war in Chabrisonne
ihr Ruf als Köchin, Heil- und Kräuterkundige. Dort auf ihrem Lieblingsplätzchen wurde sie nur von der Katze entdeckt. Die
fleißige Mäuse- und Rattenjägerin strich durch Marguerites hochgestellte Knie, die ein Dreieck bildeten, sie streifte deren
Fesseln, sie drang unter deren Rock hindurch und umkreiste deren Oberschenkel und Rücken. Das alles in enger Tuchfühlung,
begleitet von Marguerites Murmeln, deren Lob, womit die Katze überschüttet wurde.
Marguerite und Pascal
Auf dem Chor, während der Sonntagsmesse, steckte ihm Marguerite ein Billett zu. Und er machte sich daran, das zu tun, was
auf dem Zettel geschrieben stand. Auf dem Weg vor den Ort haderte er noch mit sich, sein Zimmer umsonst geputzt zu haben.
Denn nun hatte sie ihr Kommen widerrufen.
"Zu gern hätte ich diese Arbeit der Hausmagd überlassen wie immer. Die Gute war schier außer sich vor Verwunderung, als
ich noch am Abend selbst Hand angelegt habe." Längst wieder unbehelligt von diesem Gedanken, stieß Pascal auf den
heckengesäumten Weg oberhalb des Baches. Nach Marguerites Notizen würde er auf diesem kaum ausgetretenen grünen
Pfad, über dem sich das Blattwerk der Sträucher und Bäume bereits geschlossen hatte, in den Pfarrgarten gelangen, dort auf
die Bienenstöcke des Abbés stoßen und bald darauf an den Stallungen vorbeikommen. Im Sonnenlicht sah er die Bienen
schwirren. Ihr Brummen lag dezent über der Stille, die dort herrschte, auch über dem Trubel aus dem Ort. Laut war es
gewesen, als er sich auf den Weg gemacht hatte. Auf dem Zettel warnte ihn Marguerite vor diesen Insekten. Vorsichtig,
beinahe den Atem anhaltend, pirschte er sich mit Storchenschritten voran. Ein Beobachter hätte sich angesichts dieses
gebückten Stelzganges eines Schmunzelns oder spöttischen Lachens kaum erwehren können. Doch von Bienen und Spott
unbehelligt, gelangte Pascal hinter die Stallungen. Als er sie passiert hatte, sah er die Tür, die vom Garten in das Pfarrhaus
führte. Durch sie sollte er ohne anzuklopfen eintreten. Damit endeten Marguerites Notizen.
Auf halber Strecke, im spärlichen Schutz der verblühten Obstbäume, vernahm er Marguerites Gesang. "Wie sie dieses alte
Lied singt ... Diese tiefe Stimme: schön, mir fehlen die Worte." Sobald er die Türklinke bewegte, brach Marguerite ab, mitten in
der Strophe. Wortlos und ohne ein Lächeln empfing sie ihn. Als sie den Riegel vorgewuchtet hatte, sagte sie: "Für April
ungewöhnlich warm heute. Marie und Léon waren nicht mehr zu halten - Sonntag und ein solches Wetter, da lässt die Guten
das Treiben auf den Märkten und in den Schänken nicht so schnell wieder los; später Abend wird es wohl werden ... Sogar hier
im Haus hört man noch davon. Ein Wunder, dass ihnen nicht ihr Mittagsmahl auf dem Weg ins Gesindehaus hinüber aus den
Händen geglitten war, so eilig hatten es die beiden." Sie schwieg.
"Wir sind allein heute", sagte sie nach einer Weile…