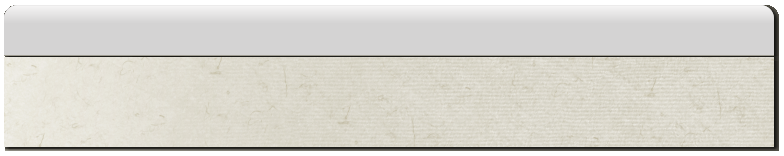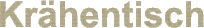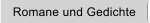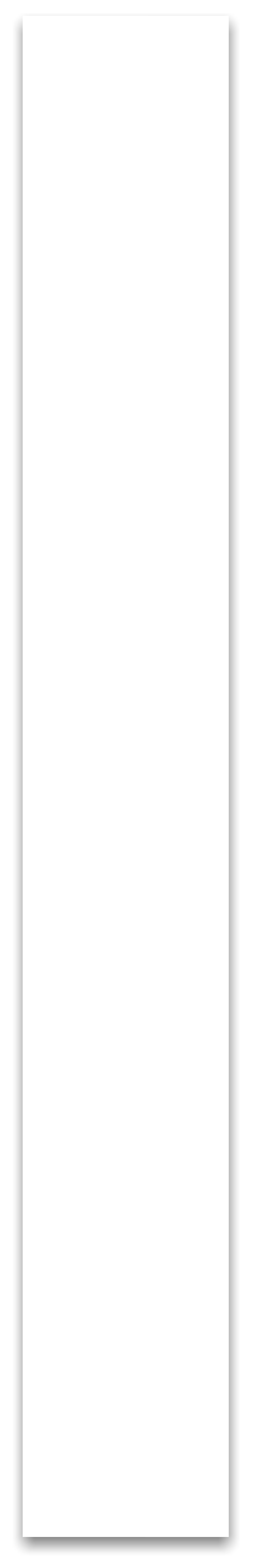
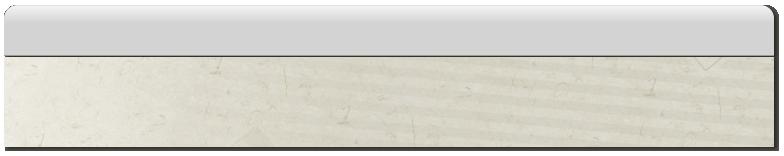


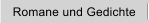

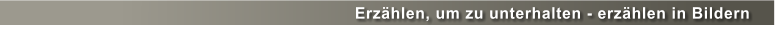 Krähentisch - Kriminalroman 2015
Der Roman erschien am 29. Mai 2015 im Spielberg Verlag Regensburg
Buch, ISBN 978-3-95452-680-2 9,90 Euro 150 Seiten, Textumfang ca. 27500 Wörter
eBook, erschienen am 21.07.2015, ISBN 978-3-95452-070-1 3,99 Euro
Zeit und Orte: Ende Juni bis Mitte August 2014
Freystadt und Umgebung, Sulzbürg, Buch, Neumarkt, Regensburg, Nürnberg
Der Roman kann in jeder Buchhandlung erhalten oder bei mehreren Internetanbietern bezogen werden
oder direkt beim Autor vor Ort gekauft oder bestellt werden - Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Die Hausbrauerei Katzerer in Sondersfeld bietet zum Roman ein Krimibier an.
Inhalt
Im Oberpfälzer Jura überschlagen sich die Ereignisse. Unfall oder Mord? Im Nu ist nichts mehr wie es war.
Verdächtigungen werden gestreut. Was einige Frauen wahrzunehmen glauben, steht im Widerspruch zu den
Fakten. Dennoch will sich Frieser, der ermittelnde Kriminalbeamte, auch damit befassen. Doch plötzlich ist
Eile geboten. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Der Krähentisch rückt in den Brennpunkt…
Inspiriert von einer wahren Begebenheit
Hoch über dem Felsplateau nahe der Burg Wolfstein sind Krähen am Himmel. Ihre kehligen Schreie
Krähentisch - Kriminalroman 2015
Der Roman erschien am 29. Mai 2015 im Spielberg Verlag Regensburg
Buch, ISBN 978-3-95452-680-2 9,90 Euro 150 Seiten, Textumfang ca. 27500 Wörter
eBook, erschienen am 21.07.2015, ISBN 978-3-95452-070-1 3,99 Euro
Zeit und Orte: Ende Juni bis Mitte August 2014
Freystadt und Umgebung, Sulzbürg, Buch, Neumarkt, Regensburg, Nürnberg
Der Roman kann in jeder Buchhandlung erhalten oder bei mehreren Internetanbietern bezogen werden
oder direkt beim Autor vor Ort gekauft oder bestellt werden - Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Die Hausbrauerei Katzerer in Sondersfeld bietet zum Roman ein Krimibier an.
Inhalt
Im Oberpfälzer Jura überschlagen sich die Ereignisse. Unfall oder Mord? Im Nu ist nichts mehr wie es war.
Verdächtigungen werden gestreut. Was einige Frauen wahrzunehmen glauben, steht im Widerspruch zu den
Fakten. Dennoch will sich Frieser, der ermittelnde Kriminalbeamte, auch damit befassen. Doch plötzlich ist
Eile geboten. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Der Krähentisch rückt in den Brennpunkt…
Inspiriert von einer wahren Begebenheit
Hoch über dem Felsplateau nahe der Burg Wolfstein sind Krähen am Himmel. Ihre kehligen Schreie verhallen im Tal…
Siehe Rubrik Aktuelles: Laudatio des Juristen Florian Schübel anlässlich der Vorstellung von
Krähentisch
Februar/März 2017 - Realschule Neutraubling: Krähentisch ist im Deutschunterricht der
9. Jahrgangstufe Thema einer Projektschulaufgabe
Wolfgang Fellner, Lokalredakteur der Neumarkter Nachrichten, schreibt über den Roman anlässlich der Lesung vom
10. Dezember 2013 im Rahmen von "Freystadt liest":
Spannend:
"Krähentisch" lockt viele Gäste
FREYSTADT - Vor vollem Haus gab es die letzte Lesung von Freystadt liest vor Weihnachten: Über 30 begeisterte
Literatur-Fans waren da, um Hans Regensburger zu lauschen, der eine Werkprobe aus seinem ersten Krimi gab. Das
Café im historischen Spitalstadl war übervoll, als der bekannte Mörsdorfer zu den ersten Seiten seines derzeit im
entstehen begriffenen Buches griff. "Haben Sie denn keinen Krimi im Angebot", sei er in letzter Zeit immer wieder von
Verlegern gefragt worden. Habe er nicht, sagte Regensburger, weil er sich für dieses Genre eigentlich nicht so
erwärme.
Umso spannender dann das, was sich in "Krähentisch" abspielt. Regensburger überzeugt auf den ersten Seiten durch
große Beobachtungsgabe, stellt seine Figuren geschickt vor und hat vor allem einen grausigen Plot gefunden. Als es
richtig spannend wurde, war Schluss. Die Auflösung, sagt er nach viel Applaus, gebe es vielleicht im kommenden
Herbst.
Leseprobe
1.
Der Wetterbericht versprach, dass sich auch dieser Montagvormittag zu einem ähnlich heißen Sommertag entfalten
verhallen im Tal…
Siehe Rubrik Aktuelles: Laudatio des Juristen Florian Schübel anlässlich der Vorstellung von
Krähentisch
Februar/März 2017 - Realschule Neutraubling: Krähentisch ist im Deutschunterricht der
9. Jahrgangstufe Thema einer Projektschulaufgabe
Wolfgang Fellner, Lokalredakteur der Neumarkter Nachrichten, schreibt über den Roman anlässlich der Lesung vom
10. Dezember 2013 im Rahmen von "Freystadt liest":
Spannend:
"Krähentisch" lockt viele Gäste
FREYSTADT - Vor vollem Haus gab es die letzte Lesung von Freystadt liest vor Weihnachten: Über 30 begeisterte
Literatur-Fans waren da, um Hans Regensburger zu lauschen, der eine Werkprobe aus seinem ersten Krimi gab. Das
Café im historischen Spitalstadl war übervoll, als der bekannte Mörsdorfer zu den ersten Seiten seines derzeit im
entstehen begriffenen Buches griff. "Haben Sie denn keinen Krimi im Angebot", sei er in letzter Zeit immer wieder von
Verlegern gefragt worden. Habe er nicht, sagte Regensburger, weil er sich für dieses Genre eigentlich nicht so
erwärme.
Umso spannender dann das, was sich in "Krähentisch" abspielt. Regensburger überzeugt auf den ersten Seiten durch
große Beobachtungsgabe, stellt seine Figuren geschickt vor und hat vor allem einen grausigen Plot gefunden. Als es
richtig spannend wurde, war Schluss. Die Auflösung, sagt er nach viel Applaus, gebe es vielleicht im kommenden
Herbst.
Leseprobe
1.
Der Wetterbericht versprach, dass sich auch dieser Montagvormittag zu einem ähnlich heißen Sommertag entfalten würde wie die Tage zuvor – für Zimmerer am Bau tausendmal besser als Regen, Wind und Kälte. Zwei von ihnen setzten
am Rande von Freystadt dem Neubau eines Wohnhauses den Dachstuhl auf.
Es war unvermeidlich, dass deren Werkeln auch in die unmittelbare Umgebung dieser Baustelle drang. Jenseits dieses
würde wie die Tage zuvor – für Zimmerer am Bau tausendmal besser als Regen, Wind und Kälte. Zwei von ihnen setzten
am Rande von Freystadt dem Neubau eines Wohnhauses den Dachstuhl auf.
Es war unvermeidlich, dass deren Werkeln auch in die unmittelbare Umgebung dieser Baustelle drang. Jenseits dieses Zirkels lag im Westen die Straße nach Neumarkt, im Norden der Fohlenhof, im Osten die Marienvorstadt und im Süden
die Wallfahrtskirche. Wenngleich das Hantieren dieser Handwerker von den Leuten in der Nähe kaum überhört worden
sein konnte, dürften sie ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Einerlei, ob das helltönende Hämmern
ab und an im Takt erklang, eintönig eine Kreissäge kreischte oder eine Motorsäge knatterte oder heulte. Wer wollte wegen
solcher Geräusche und Töne, die zweifelsohne in völliger Übereinstimmung mit dem Anblick dieser Arbeiten hoch auf
Zirkels lag im Westen die Straße nach Neumarkt, im Norden der Fohlenhof, im Osten die Marienvorstadt und im Süden
die Wallfahrtskirche. Wenngleich das Hantieren dieser Handwerker von den Leuten in der Nähe kaum überhört worden
sein konnte, dürften sie ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Einerlei, ob das helltönende Hämmern
ab und an im Takt erklang, eintönig eine Kreissäge kreischte oder eine Motorsäge knatterte oder heulte. Wer wollte wegen
solcher Geräusche und Töne, die zweifelsohne in völliger Übereinstimmung mit dem Anblick dieser Arbeiten hoch auf einem werdenden Dach waren, vom Fahrrad absteigen, bei der Gartenarbeit aufschauen, auf dem Weg zum Einkaufen
einem werdenden Dach waren, vom Fahrrad absteigen, bei der Gartenarbeit aufschauen, auf dem Weg zum Einkaufen innehalten, einen Arzttermin absagen…?
Das wäre an diesem Montagvormittag viel eher jenen Worten aus dem Mund der beiden Zimmerer zugekommen, die
innehalten, einen Arzttermin absagen…?
Das wäre an diesem Montagvormittag viel eher jenen Worten aus dem Mund der beiden Zimmerer zugekommen, die ihnen scharf und schneidend wie das Jaulen einer Peitsche entfuhren. Davon wären die meisten Leute sicherlich hellhörig
geworden und einigen unter ihnen wäre gewiss der Schrecken unter die Haut gefahren. In ihrer blinden Wut mochten die
beiden Zimmerer sich einen Dreck darum geschert haben, dass ihre Kraftausdrücke über die Baustelle hinausdrangen
ihnen scharf und schneidend wie das Jaulen einer Peitsche entfuhren. Davon wären die meisten Leute sicherlich hellhörig
geworden und einigen unter ihnen wäre gewiss der Schrecken unter die Haut gefahren. In ihrer blinden Wut mochten die
beiden Zimmerer sich einen Dreck darum geschert haben, dass ihre Kraftausdrücke über die Baustelle hinausdrangen und nicht unter ihnen blieben wie das Surren des Baukrans, den Kevin führte. Dennoch war es unwahrscheinlich, dass zu
dieser geschäftigen Tages- und Jahreszeit ihr lauthalsiger Schlagabtausch ins Ohr Dritter fand.
Robert, der 50-Jährige, war bis aufs Blut gereizt. Immer wieder regte er sich über Kevin auf. Dieser blonde, langhaarige
und nicht unter ihnen blieben wie das Surren des Baukrans, den Kevin führte. Dennoch war es unwahrscheinlich, dass zu
dieser geschäftigen Tages- und Jahreszeit ihr lauthalsiger Schlagabtausch ins Ohr Dritter fand.
Robert, der 50-Jährige, war bis aufs Blut gereizt. Immer wieder regte er sich über Kevin auf. Dieser blonde, langhaarige 20-Jährige war bereits seit dem frühen Morgen der Anlass und das Ziel seiner Wut. Noch war es zwi-schen ihnen nicht
20-Jährige war bereits seit dem frühen Morgen der Anlass und das Ziel seiner Wut. Noch war es zwi-schen ihnen nicht zum Streit gekommen; doch er lag längst in der Luft. Stundenlang hatte Kevin Roberts Nörgeln und Schimpfen ohne ein
Wort der Entgegnung über sich ergehen lassen.
Bereits in der Frühe, beim Beladen des Lasters in der Zimmerei in Niederstob, hatte Sepp, der Chef, ihn vor den Kopf
gestoßen. Nicht wie gewohnt wurde ihm Rainer zugeteilt, sondern Kevin. Schon am Sonntag hätte er diesen erwürgen
zum Streit gekommen; doch er lag längst in der Luft. Stundenlang hatte Kevin Roberts Nörgeln und Schimpfen ohne ein
Wort der Entgegnung über sich ergehen lassen.
Bereits in der Frühe, beim Beladen des Lasters in der Zimmerei in Niederstob, hatte Sepp, der Chef, ihn vor den Kopf
gestoßen. Nicht wie gewohnt wurde ihm Rainer zugeteilt, sondern Kevin. Schon am Sonntag hätte er diesen erwürgen können und den Trainer ohrfeigen wollen. Dieser hatte nicht seinen Sohn in der ersten Mannschaft aufgestellt, sondern
können und den Trainer ohrfeigen wollen. Dieser hatte nicht seinen Sohn in der ersten Mannschaft aufgestellt, sondern erneut diesen ballverliebten Dribbler. Doch nur, weil er vor einigen Monaten beim Auswärtsspiel in Freystadt einen 3:0
Pausenrückstand noch in einen 4:3 Sieg für den FC Oberstob verwandelt hatte. Es wurmte Robert, dass Kevin von
erneut diesen ballverliebten Dribbler. Doch nur, weil er vor einigen Monaten beim Auswärtsspiel in Freystadt einen 3:0
Pausenrückstand noch in einen 4:3 Sieg für den FC Oberstob verwandelt hatte. Es wurmte Robert, dass Kevin von solchen Einzelleistungen monatelang zehren konnte. Sein Sohn jedoch, der mannschaftsdienlich und gradlinig Fußball
solchen Einzelleistungen monatelang zehren konnte. Sein Sohn jedoch, der mannschaftsdienlich und gradlinig Fußball spielte wie kein Zweiter, wurde von diesem Trainer wie schon so oft in die Reservemannschaft verbannt, oder er ließ ihn
als Auswechselspieler auf der Bank schmoren. Was müsse auf dem Fußballplatz noch alles geschehen, dass das auch
spielte wie kein Zweiter, wurde von diesem Trainer wie schon so oft in die Reservemannschaft verbannt, oder er ließ ihn
als Auswechselspieler auf der Bank schmoren. Was müsse auf dem Fußballplatz noch alles geschehen, dass das auch einmal diesem Kevin widerfahre, hatte sich Robert nach dem Auswärtsspiel am Sonntag in Woffenbach nicht zum ersten
Mal gefragt.
Dreimal war Kevin mit dem Ball am Fuß alleine vors Tor gekommen und kein einziges Mal hatten auf dem Platz die
einmal diesem Kevin widerfahre, hatte sich Robert nach dem Auswärtsspiel am Sonntag in Woffenbach nicht zum ersten
Mal gefragt.
Dreimal war Kevin mit dem Ball am Fuß alleine vors Tor gekommen und kein einziges Mal hatten auf dem Platz die Spieler des FC Oberstob und draußen dessen Fans jubeln können. Es kam, wie es kommen musste: Nach dem
Spieler des FC Oberstob und draußen dessen Fans jubeln können. Es kam, wie es kommen musste: Nach dem Schlusspfiff verließen die Woffenbacher als glückliche Sieger den Platz, mit einem 1:0, das ihnen indirekt Kevin
Schlusspfiff verließen die Woffenbacher als glückliche Sieger den Platz, mit einem 1:0, das ihnen indirekt Kevin gescheckt hatte.
Mit diesem Versager, der beim Beladen des Lasters noch nach Alkohol roch, musste er auf die Baustelle. Noch
gescheckt hatte.
Mit diesem Versager, der beim Beladen des Lasters noch nach Alkohol roch, musste er auf die Baustelle. Noch schlimmer, er musste ans Steuer des Lasters. Wussten der Chef und jedermann in der Zimmerei nicht längst, dass er seit
einiger Zeit lieber auf dem Beifahrersitz Platz nahm? So gerne er sich früher selbst ans Steuer eines LKWs gesetzt hatte,
so ungern fuhr er seit einigen Jahren selbst.
Bereits der erste Sparren, den am Laster ste-hend Kevin angegurtet, an den Haken des Krans gehängt hatte und den
schlimmer, er musste ans Steuer des Lasters. Wussten der Chef und jedermann in der Zimmerei nicht längst, dass er seit
einiger Zeit lieber auf dem Beifahrersitz Platz nahm? So gerne er sich früher selbst ans Steuer eines LKWs gesetzt hatte,
so ungern fuhr er seit einigen Jahren selbst.
Bereits der erste Sparren, den am Laster ste-hend Kevin angegurtet, an den Haken des Krans gehängt hatte und den Robert oben am Bau ergreifen sollte, hätte diesen beinahe von dort heruntergefegt. »Wie nur hast du Depp das Holz
Robert oben am Bau ergreifen sollte, hätte diesen beinahe von dort heruntergefegt. »Wie nur hast du Depp das Holz anghängt? Ich glaub´s nicht! – Total aus der Waag und verdreht.« Robert hatte es gleich gewusst, dass mit solch einem
anghängt? Ich glaub´s nicht! – Total aus der Waag und verdreht.« Robert hatte es gleich gewusst, dass mit solch einem Mann auf der Bau-stelle der Ärger vorprogrammiert war.
»Hast das Holz am Blei?«, rief Robert zu Kevin hinunter, der am Schwellenholz stehend den Sparren er-wartet und mit
beiden Händen entgegengenommen hatte und ihn dort linksbündig an den dicken Bleistift-strich drücken und dann
Mann auf der Bau-stelle der Ärger vorprogrammiert war.
»Hast das Holz am Blei?«, rief Robert zu Kevin hinunter, der am Schwellenholz stehend den Sparren er-wartet und mit
beiden Händen entgegengenommen hatte und ihn dort linksbündig an den dicken Bleistift-strich drücken und dann festnageln sollte. Als Robert Kevins »Ja!«, vernahm, hämmerte er mit seinem Zim-mer-mannsbeil den Sparren an der
festnageln sollte. Als Robert Kevins »Ja!«, vernahm, hämmerte er mit seinem Zim-mer-mannsbeil den Sparren an der Pfette fest, und Kevin nagelte ihn ans Schwellenholz. Dann quälte sich der ruhige Typ, der technisch versierte Fußballer,
den sie Bernd riefen – sein Aussehen, seine Statur und Spielweise erinnerten an den Blonden Engel, an den großen Bernd
Schuster –, langsam die Leiter hinunter und über-gab sich an der Ziegelmauer des Rohbaus. Wie einen Pullover hatte er
sich der Funksteuerung des Baukrans entledigt, die vor seinem Bauch hing. Das an Hosenträgergurten befestigte
Pfette fest, und Kevin nagelte ihn ans Schwellenholz. Dann quälte sich der ruhige Typ, der technisch versierte Fußballer,
den sie Bernd riefen – sein Aussehen, seine Statur und Spielweise erinnerten an den Blonden Engel, an den großen Bernd
Schuster –, langsam die Leiter hinunter und über-gab sich an der Ziegelmauer des Rohbaus. Wie einen Pullover hatte er
sich der Funksteuerung des Baukrans entledigt, die vor seinem Bauch hing. Das an Hosenträgergurten befestigte Kästchen hatte er so im letzten Augenblick vor seinem Mageninhalt in Sicherheit bringen können. Nun kommentierte
Kästchen hatte er so im letzten Augenblick vor seinem Mageninhalt in Sicherheit bringen können. Nun kommentierte Robert oben auf einer Pfette stehend das, was seinen Blicken entzogen war: »Gscheit sollst dich rumhaun – gescheit! So
hört sich also ein blonder Engel an, wenn er kotzt; von wegen Engel – Reiher.« Roberts spöttische Lacher erreichten Kevin
nicht.
Nachdem er mithilfe einer Schaufel das Gespiene mit Erde abgedeckt und sich die Funksteuerung wieder übergestreift
hatte, stieg er auf den Laster und befestigte am Haken des Baukrans den nächsten Sparren. Erneut begann Robert zu
Robert oben auf einer Pfette stehend das, was seinen Blicken entzogen war: »Gscheit sollst dich rumhaun – gescheit! So
hört sich also ein blonder Engel an, wenn er kotzt; von wegen Engel – Reiher.« Roberts spöttische Lacher erreichten Kevin
nicht.
Nachdem er mithilfe einer Schaufel das Gespiene mit Erde abgedeckt und sich die Funksteuerung wieder übergestreift
hatte, stieg er auf den Laster und befestigte am Haken des Baukrans den nächsten Sparren. Erneut begann Robert zu schimpfen: »Hättst den Ball ins Tor reinghaut und nicht so viel gesoffen gestern, wenn du´s nicht verträgst, du Depp, du
Idiot, du blöder Hund, du blöder! Wenn von deiner Kotzerei der Chef was spannt oder der Bauherr … O Gott? – Schon
am Abend ist Richtfest …« Als Robert nach dem Balken griff, der am Kranhaken zu ihm herunterschwebte, hielt er inne.
Kaum drei Minuten später hatte er auch diesen Sparren an der Pfette festgenagelt. Robert hörte und sah, dass Kevin
schimpfen: »Hättst den Ball ins Tor reinghaut und nicht so viel gesoffen gestern, wenn du´s nicht verträgst, du Depp, du
Idiot, du blöder Hund, du blöder! Wenn von deiner Kotzerei der Chef was spannt oder der Bauherr … O Gott? – Schon
am Abend ist Richtfest …« Als Robert nach dem Balken griff, der am Kranhaken zu ihm herunterschwebte, hielt er inne.
Kaum drei Minuten später hatte er auch diesen Sparren an der Pfette festgenagelt. Robert hörte und sah, dass Kevin unten an der Mauerschwelle noch immer hämmerte. Erst zur Hälfte hatte er den Nagel ins Holz getrieben. Sein nächster
Schlag ging daneben und mit dem übernächsten schlug er den Nagel krumm. Es dauerte einige Minuten, bis er den
unten an der Mauerschwelle noch immer hämmerte. Erst zur Hälfte hatte er den Nagel ins Holz getrieben. Sein nächster
Schlag ging daneben und mit dem übernächsten schlug er den Nagel krumm. Es dauerte einige Minuten, bis er den langen, dicken Zimmermannsnagel herausgezogen und an seiner Stelle einen neuen im Holz versenkt hatte. »Wenn das
langen, dicken Zimmermannsnagel herausgezogen und an seiner Stelle einen neuen im Holz versenkt hatte. »Wenn das in dem Tempo so weitergeht, dann können wir vom Chef was erleben…! Und wer ist schuld …?«, schrie Robert aus
in dem Tempo so weitergeht, dann können wir vom Chef was erleben…! Und wer ist schuld …?«, schrie Robert aus Leibeskräften und mit unerbittlichem Ernst in der Stimme. Nach einiger Zeit spürte Robert die Sonne im Rücken und
Leibeskräften und mit unerbittlichem Ernst in der Stimme. Nach einiger Zeit spürte Robert die Sonne im Rücken und blickte auf die Uhr. Es war zehn. Die Uhrzeit, die Robert nannte, war das erste und einzige Wort an diesem halben
blickte auf die Uhr. Es war zehn. Die Uhrzeit, die Robert nannte, war das erste und einzige Wort an diesem halben Vormittag, das er nicht im Zorn von sich gegeben hatte. Während die Glocke der Stadtpfarrkirche zehn Uhr schlug,
Vormittag, das er nicht im Zorn von sich gegeben hatte. Während die Glocke der Stadtpfarrkirche zehn Uhr schlug, schwebte am Haken des Krans jener Sparren, mit dem eine Seite des Dachstuhls vervollständigt werden sollte. Davon war
er etwas später ein fester Bestandteil. Robert stieg auf diesen Sparren und ging zu Kevin hinunter.
Gehalten und geführt von seinen Händen, die er auf die Sparren links und rechts neben sich setzte, ließ er sich dann
schwebte am Haken des Krans jener Sparren, mit dem eine Seite des Dachstuhls vervollständigt werden sollte. Davon war
er etwas später ein fester Bestandteil. Robert stieg auf diesen Sparren und ging zu Kevin hinunter.
Gehalten und geführt von seinen Händen, die er auf die Sparren links und rechts neben sich setzte, ließ er sich dann wie ein Turner am Barren mit den Füßen voraus aufs Schutzgerüst gleiten. Von dort aus überprüfte er mit
wie ein Turner am Barren mit den Füßen voraus aufs Schutzgerüst gleiten. Von dort aus überprüfte er mit fachmännischen Blicken die Arbeit der vergangenen Stunden – aus mehreren Blickwinkeln die Front der Sparrenreihung.
Er nickte mit mürrischem Blick. Es schien, er wollte dahinter seine Zufriedenheit verstecken. Nun kletterte er zurück auf
den halbfertigen Dachstuhl, griff nach seinem Beil, das er dort nach dem Herabsteigen abgelegt hatte, und stieg von
fachmännischen Blicken die Arbeit der vergangenen Stunden – aus mehreren Blickwinkeln die Front der Sparrenreihung.
Er nickte mit mürrischem Blick. Es schien, er wollte dahinter seine Zufriedenheit verstecken. Nun kletterte er zurück auf
den halbfertigen Dachstuhl, griff nach seinem Beil, das er dort nach dem Herabsteigen abgelegt hatte, und stieg von einem Sparren zum andern; dabei begutachtete er Kevins Arbeit. Sein Ziel war der Westgiebel. »Ich glaub, ich spinn!«,
einem Sparren zum andern; dabei begutachtete er Kevins Arbeit. Sein Ziel war der Westgiebel. »Ich glaub, ich spinn!«, entrüstete er sich plötzlich auf der Hälfte seines Weges. »Du Depp, hast ab da immer wieder einmal einen Sparren fast
entrüstete er sich plötzlich auf der Hälfte seines Weges. »Du Depp, hast ab da immer wieder einmal einen Sparren fast einen Zentimeter daneben genagelt. Bist du noch zu retten?« Kevin brachte keinen Laut über die Lippen; er zuckte mit
einen Zentimeter daneben genagelt. Bist du noch zu retten?« Kevin brachte keinen Laut über die Lippen; er zuckte mit den Achseln. Robert musterte ihn und schrie: »Du bist genauso blöd wie deine Alten. Da kann ich von Glück reden, dass
ich damals deiner Mutter den Laufpass gegeben hab!« Kevin hob seinen Blick und starrte Robert an. Er war den Tränen
nahe, bewegte seinen Mund als ob er etwas sagen würde, doch er konnte sich nicht aus den Fängen seiner Verstummung
befreien. Erst als seine Tränen flossen, flossen auch seine Worte. Mit ihnen bezichtigte er Robert der Lüge. Er bebte:
den Achseln. Robert musterte ihn und schrie: »Du bist genauso blöd wie deine Alten. Da kann ich von Glück reden, dass
ich damals deiner Mutter den Laufpass gegeben hab!« Kevin hob seinen Blick und starrte Robert an. Er war den Tränen
nahe, bewegte seinen Mund als ob er etwas sagen würde, doch er konnte sich nicht aus den Fängen seiner Verstummung
befreien. Erst als seine Tränen flossen, flossen auch seine Worte. Mit ihnen bezichtigte er Robert der Lüge. Er bebte: »Meine Mama hätte einen wie dich nicht einmal mit der Beißzange angfasst. Du bist ein ganz hundsgemeiner
»Meine Mama hätte einen wie dich nicht einmal mit der Beißzange angfasst. Du bist ein ganz hundsgemeiner Sprüchbeutel und ein Arschloch, sonst nichts! Ein richtiges Arschloch bist du! Dass du´s nur weißt!« Doch Robert trieb
seinen Spott auf die Spitze und behauptete: »Gvögelt ho is deij Muhda, und wij!«
»Du Sau, du lijchade!«, schrie Kevin aus Leibeskräften.
»Halt dein Maul, sonst kannst was erleben!«, drohte Robert.
»Halt du dein Maul!«, konterte Kevin. »Wie seid ihr daheim mit deinem Bruder umgangen, dem Jimmy? Davonghaut
Sprüchbeutel und ein Arschloch, sonst nichts! Ein richtiges Arschloch bist du! Dass du´s nur weißt!« Doch Robert trieb
seinen Spott auf die Spitze und behauptete: »Gvögelt ho is deij Muhda, und wij!«
»Du Sau, du lijchade!«, schrie Kevin aus Leibeskräften.
»Halt dein Maul, sonst kannst was erleben!«, drohte Robert.
»Halt du dein Maul!«, konterte Kevin. »Wie seid ihr daheim mit deinem Bruder umgangen, dem Jimmy? Davonghaut hab ihr ihn und um sein Erbe betrogen – du und deine schöne Mutter, kaum dass dein Vater unter der Erde war!«
»Noch ein Wort und ich vergess mich!«, plärrte Robert, dass seine Stirnadern schwollen; dabei schwang er sein Beil.
»Hör ruhig an, was dein eigener Bruder sagt«, schrie Kevin zurück und wischte sich mit der flachen Hand seine Tränen
von den Wangen; er weinte nicht mehr. »Ich treff ihn oft im Oberen Ganskeller in Neumarkt und unterhalt mich mit
hab ihr ihn und um sein Erbe betrogen – du und deine schöne Mutter, kaum dass dein Vater unter der Erde war!«
»Noch ein Wort und ich vergess mich!«, plärrte Robert, dass seine Stirnadern schwollen; dabei schwang er sein Beil.
»Hör ruhig an, was dein eigener Bruder sagt«, schrie Kevin zurück und wischte sich mit der flachen Hand seine Tränen
von den Wangen; er weinte nicht mehr. »Ich treff ihn oft im Oberen Ganskeller in Neumarkt und unterhalt mich mit ihm«, erzählte Kevin und wiederholte, dass Roberts älterer Halbbruder von diesem und dessen Mutter vor Jahren
ihm«, erzählte Kevin und wiederholte, dass Roberts älterer Halbbruder von diesem und dessen Mutter vor Jahren geschlagen und vom Hof verjagt worden sei, um sich dessen Erbe unter den Nagel zu reißen. Dabei versuchte ihm
geschlagen und vom Hof verjagt worden sei, um sich dessen Erbe unter den Nagel zu reißen. Dabei versuchte ihm Robert einige Male ins Wort zu fallen und aufzutragen, er solle an diesen arbeitsscheuen Suffkopf und Taugenichts von
»Stiefbruder« ausrichten, wenn er nochmals bei ihm am Hof, im Stall und in der Scheune herumschleiche, werde ihn sein
Hund zerfleischen. Doch das hatte Kevins Redefluss nicht ein einziges Mal ins Stocken gebracht. Im Gegenteil: er hatte
Roberts Störfeuer den Garaus gemacht. »Das aber willst nicht hörn, ja. Du grausamer Mensch, du!«, behauptete Kevin
Robert einige Male ins Wort zu fallen und aufzutragen, er solle an diesen arbeitsscheuen Suffkopf und Taugenichts von
»Stiefbruder« ausrichten, wenn er nochmals bei ihm am Hof, im Stall und in der Scheune herumschleiche, werde ihn sein
Hund zerfleischen. Doch das hatte Kevins Redefluss nicht ein einziges Mal ins Stocken gebracht. Im Gegenteil: er hatte
Roberts Störfeuer den Garaus gemacht. »Das aber willst nicht hörn, ja. Du grausamer Mensch, du!«, behauptete Kevin und warf ihm mit einem herausfordernden Lächeln und Blick vor: »Stiefbruder sagst, obwohl er dein Halbbruder ist.
und warf ihm mit einem herausfordernden Lächeln und Blick vor: »Stiefbruder sagst, obwohl er dein Halbbruder ist. Schäm dich doch, du scheinheiliger Lump, du! Du Pharisäer, du! Du Wichser, du!« In diesem Augenblick warf Robert sein
Beil nach ihm. Es verfehlte Kevin. Dieser erbleichte. Robert stieg auf den nächstbesten Sparren und lief quer über die
Schäm dich doch, du scheinheiliger Lump, du! Du Pharisäer, du! Du Wichser, du!« In diesem Augenblick warf Robert sein
Beil nach ihm. Es verfehlte Kevin. Dieser erbleichte. Robert stieg auf den nächstbesten Sparren und lief quer über die anderen zu Kevin hinüber, der am Ostgiebel noch immer wie angewurzelt dastand. Nun jedoch ergriff er die Flucht;
anderen zu Kevin hinüber, der am Ostgiebel noch immer wie angewurzelt dastand. Nun jedoch ergriff er die Flucht; schwang sich, gestützt auf seine Linke, mit einem Hüftsprung um sie herum über einige Sparrenköpfe. Sein Ziel war das
Schutzgerüst des zweigeschossigen Rohbaus, das wie ein Balkon dort oben hing. Jene Diele, auf die Kevin mit beiden
schwang sich, gestützt auf seine Linke, mit einem Hüftsprung um sie herum über einige Sparrenköpfe. Sein Ziel war das
Schutzgerüst des zweigeschossigen Rohbaus, das wie ein Balkon dort oben hing. Jene Diele, auf die Kevin mit beiden Füßen voraus und der Wucht und Fallgeschwindigkeit seines Körpers landete, gab nach und schnellte am anderen Ende
in die Höhe. Kevin entfuhr ein Schrei und stürzte durch die Lücke, die sich im Nu unter ihm aufgetan hatte, in die Tiefe.
Dort lagen Amiereisen. Sein Oberkörper wurde von einigen Winkeln durchstoßen, die mit einem Schenkel wie rostige
Füßen voraus und der Wucht und Fallgeschwindigkeit seines Körpers landete, gab nach und schnellte am anderen Ende
in die Höhe. Kevin entfuhr ein Schrei und stürzte durch die Lücke, die sich im Nu unter ihm aufgetan hatte, in die Tiefe.
Dort lagen Amiereisen. Sein Oberkörper wurde von einigen Winkeln durchstoßen, die mit einem Schenkel wie rostige Spieße senkrecht aus dem etwa drei Meter breiten und fünf Meter langen Eisenpaket ragten. Auf dem Dach war Robert
mittlerweile am Ostgiebel angekommen, wo er Kevin hatte verfolgen oder stellen wollen. Nun stand er dort oben und
Spieße senkrecht aus dem etwa drei Meter breiten und fünf Meter langen Eisenpaket ragten. Auf dem Dach war Robert
mittlerweile am Ostgiebel angekommen, wo er Kevin hatte verfolgen oder stellen wollen. Nun stand er dort oben und schaute nach unten. Durch die Lücke im Gerüstboden sah er Kevin liegen. Er rührte sich nicht mehr. Die Diele, die
schaute nach unten. Durch die Lücke im Gerüstboden sah er Kevin liegen. Er rührte sich nicht mehr. Die Diele, die unter ihm wie eine Wippschaukel nachgegeben hatte, ohne jedoch in der Abwärtsbewegung gestoppt worden zu sein,
unter ihm wie eine Wippschaukel nachgegeben hatte, ohne jedoch in der Abwärtsbewegung gestoppt worden zu sein, war ihm senkrecht hinterhergefallen und mit der Kante voraus auf seinen Hals gestoßen. Einige Augenblicke stand
war ihm senkrecht hinterhergefallen und mit der Kante voraus auf seinen Hals gestoßen. Einige Augenblicke stand dieses fünf Meter lange Brett kerzengerade in der Luft, bevor es umstürzte und einige Handbreiten hinter Kevins Kopf
dieses fünf Meter lange Brett kerzengerade in der Luft, bevor es umstürzte und einige Handbreiten hinter Kevins Kopf auf das Amiereisenpaket donnerte. Robert stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. »Das wollte ich nicht!«,
auf das Amiereisenpaket donnerte. Robert stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. »Das wollte ich nicht!«, stammelte er vor Schreck. »Das wollte ich nicht! Nein!«
Er erstarrte, wollte wegschauen und konnte dennoch seinen Blick nicht abwenden. Er presste sich eine Hand vor die
stammelte er vor Schreck. »Das wollte ich nicht! Nein!«
Er erstarrte, wollte wegschauen und konnte dennoch seinen Blick nicht abwenden. Er presste sich eine Hand vor die Augen, um nicht länger die Enden der beiden Amiereisenwinkel sehen zu müssen, die wie Stilette durch Kevins Bauch
Augen, um nicht länger die Enden der beiden Amiereisenwinkel sehen zu müssen, die wie Stilette durch Kevins Bauch und Brust gedrungen waren. Ihr Rost konnte unter dem Blutfilm, der sich auf ihnen gebildet hatte, nur mehr vermutet
und Brust gedrungen waren. Ihr Rost konnte unter dem Blutfilm, der sich auf ihnen gebildet hatte, nur mehr vermutet werden. Robert blickte um sich: Nirgends war jemand zu sehen; selbst die Straßen und Wege waren leer. Er wusste nicht,
ob er zuerst zu seinem Handy greifen oder sich um Kevin kümmern sollte. Schließlich zitterte er es aus der Tasche und
werden. Robert blickte um sich: Nirgends war jemand zu sehen; selbst die Straßen und Wege waren leer. Er wusste nicht,
ob er zuerst zu seinem Handy greifen oder sich um Kevin kümmern sollte. Schließlich zitterte er es aus der Tasche und  tippte die 112.
2.
Frieser war mit sich uneins. Sollte er sich endlich dazu aufraffen, an der unerledigten Sache zu arbeiten und sie beenden
oder Feierabend machen? Schon seit eini-ger Zeit fand er kaum noch Gefallen an seiner Arbeit, wenngleich noch
tippte die 112.
2.
Frieser war mit sich uneins. Sollte er sich endlich dazu aufraffen, an der unerledigten Sache zu arbeiten und sie beenden
oder Feierabend machen? Schon seit eini-ger Zeit fand er kaum noch Gefallen an seiner Arbeit, wenngleich noch weniger am Feierabendmachen. Sie hatte sich im Laufe seiner fast 40 Dienstjahre eigentlich nicht verändert. Doch wie
weniger am Feierabendmachen. Sie hatte sich im Laufe seiner fast 40 Dienstjahre eigentlich nicht verändert. Doch wie ein ermittelnder Kripobe-amter seinen Dienst ausführen sollte, damit fremdelte er nach jeder Einweisung in ein neues
ein ermittelnder Kripobe-amter seinen Dienst ausführen sollte, damit fremdelte er nach jeder Einweisung in ein neues Computerprogramm und nach jeder Fortbildung ein wenig mehr. Dennoch hatte er sich keiner einzigen Neuerung
Computerprogramm und nach jeder Fortbildung ein wenig mehr. Dennoch hatte er sich keiner einzigen Neuerung ver-schlossen. Einerseits war er froh, dass er in einigen Wochen in Pension gehen würde, andererseits ängstigte er sich ein
wenig davor, seine tägliche Ordnung einzubüßen. Das Kaffeetrinken in der Frühe und am Nachmittag, das längst zum
ver-schlossen. Einerseits war er froh, dass er in einigen Wochen in Pension gehen würde, andererseits ängstigte er sich ein
wenig davor, seine tägliche Ordnung einzubüßen. Das Kaffeetrinken in der Frühe und am Nachmittag, das längst zum Ritual geworden war, genauso wie das Brotzeitmachen bei der Arbeit am Computer, den Plausch mit Kolleginnen und
Ritual geworden war, genauso wie das Brotzeitmachen bei der Arbeit am Computer, den Plausch mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ihm gegenseitige Sympathie verband. Er hoffte, dass er in keine Sonderkommission mehr berufen
Kollegen, mit denen ihm gegenseitige Sympathie verband. Er hoffte, dass er in keine Sonderkommission mehr berufen werden würde, wo er doch nur ein Rädchen im Getriebe wäre. Alleine hätte er sich selbst an seinem letzten Tag im Amt
noch in den rätselhaftesten Todesfall verbissen. Doch im Team machte ihm die Arbeit bereits seit vielen Jahren keine
werden würde, wo er doch nur ein Rädchen im Getriebe wäre. Alleine hätte er sich selbst an seinem letzten Tag im Amt
noch in den rätselhaftesten Todesfall verbissen. Doch im Team machte ihm die Arbeit bereits seit vielen Jahren keine Freude mehr. Teamarbeit und Dokumentation wurden jedoch mehr denn je vom Ministerium gewünscht und nicht selten
auch angeordnet. Jeder Federstrich, jedes Wort sollte nachvollziehbar sein, im Team sollte das beste Konzept gefunden
und auch vollzogen werden. Meist eine Plattform für manche Kolleginnen und Kollegen, um sich in Szene zu setzen, wie
Frieser fand.
Ihm, dem Einzelgänger, der Katzen liebte und dem Hunde nicht geheuer waren, fiel das schwer; Beförderungen
Freude mehr. Teamarbeit und Dokumentation wurden jedoch mehr denn je vom Ministerium gewünscht und nicht selten
auch angeordnet. Jeder Federstrich, jedes Wort sollte nachvollziehbar sein, im Team sollte das beste Konzept gefunden
und auch vollzogen werden. Meist eine Plattform für manche Kolleginnen und Kollegen, um sich in Szene zu setzen, wie
Frieser fand.
Ihm, dem Einzelgänger, der Katzen liebte und dem Hunde nicht geheuer waren, fiel das schwer; Beförderungen verspäteten sich. Daheim stellte man unangenehme Fragen, auf die er seit Jahren nur noch mit einem Achselzucken
verspäteten sich. Daheim stellte man unangenehme Fragen, auf die er seit Jahren nur noch mit einem Achselzucken reagierte. Wieder wurde ein Kollege mit weniger Dienst- und Lebensjahren sowie gelösten Fällen vor ihm befördert. Der
Leberkäse und der Sekt, die es bei der kleinen Feier gegeben hatte, stießen ihm auf. Ihm graute, nach Hause zu kommen.
Einst war ihm dieser Zustand fremd – gänzlich fremd, nicht zuletzt, weil seine Frau noch nie so unerbittlich wie jüngst
reagierte. Wieder wurde ein Kollege mit weniger Dienst- und Lebensjahren sowie gelösten Fällen vor ihm befördert. Der
Leberkäse und der Sekt, die es bei der kleinen Feier gegeben hatte, stießen ihm auf. Ihm graute, nach Hause zu kommen.
Einst war ihm dieser Zustand fremd – gänzlich fremd, nicht zuletzt, weil seine Frau noch nie so unerbittlich wie jüngst ihm angekündigt hatte: »Früher oder später werde ich dich verlassen!« Längst hegte er keine Hoffnung mehr, sich mit
ihm angekündigt hatte: »Früher oder später werde ich dich verlassen!« Längst hegte er keine Hoffnung mehr, sich mit einem Fall ganz alleine befassen zu können. Dazu gehörte auch, dass er ihn erst in den Computer tippte, wenn er ihn
einem Fall ganz alleine befassen zu können. Dazu gehörte auch, dass er ihn erst in den Computer tippte, wenn er ihn gelöst hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er ohnehin alles im Kopf und in Stichworten in seinem Notizbuch. Diese
gelöst hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er ohnehin alles im Kopf und in Stichworten in seinem Notizbuch. Diese Arbeitsweise quittierte man in seiner Dienststelle nur noch mit Kopfschütteln. Es zählte nicht mehr, dass er alleine am
Arbeitsweise quittierte man in seiner Dienststelle nur noch mit Kopfschütteln. Es zählte nicht mehr, dass er alleine am erfolgreichsten war. Doch er erntete nicht Anerkennung, sondern er fühlte sich gemobbt und zurückgesetzt. Er stritt ja
erfolgreichsten war. Doch er erntete nicht Anerkennung, sondern er fühlte sich gemobbt und zurückgesetzt. Er stritt ja nicht ab, dass er nicht besonders fleißig und höchstens ein wenig überdurchschnittlich intelligent war. Doch er glaubte, er
sei kreativ wie niemand sonst in den K-Gruppen, in der Spurensicherung, in der Gerichtsmedizin und in den
nicht ab, dass er nicht besonders fleißig und höchstens ein wenig überdurchschnittlich intelligent war. Doch er glaubte, er
sei kreativ wie niemand sonst in den K-Gruppen, in der Spurensicherung, in der Gerichtsmedizin und in den zuständigen Staatsanwaltschaften. Davon war er überzeugt. Doch von der neuen Staatsanwältin, die bei ihm zunächst
zuständigen Staatsanwaltschaften. Davon war er überzeugt. Doch von der neuen Staatsanwältin, die bei ihm zunächst einen guten Eindruck hinterlassen hatte, konnte er weder Verständnis noch Rückendeckung für seine Art des Ermittelns
und Sachbearbeitens erwarten, von seinem Vorgesetzten im Amt sowieso nicht. »Kreativität ist in der Kriminalistik nicht
mehr gefragt«, trauerte Frieser alten Zeiten nach und fuhr den Computer herunter. Er hatte ihn vor zwei Stunden
einen guten Eindruck hinterlassen hatte, konnte er weder Verständnis noch Rückendeckung für seine Art des Ermittelns
und Sachbearbeitens erwarten, von seinem Vorgesetzten im Amt sowieso nicht. »Kreativität ist in der Kriminalistik nicht
mehr gefragt«, trauerte Frieser alten Zeiten nach und fuhr den Computer herunter. Er hatte ihn vor zwei Stunden hochgefahren, weil er seine Arbeit der letzten Tage als Rädchen im Getriebe einer Sonderkommission dokumentieren
hochgefahren, weil er seine Arbeit der letzten Tage als Rädchen im Getriebe einer Sonderkommission dokumentieren sollte. Keine Frage, es hätte ihn vor keine technischen und intellektuellen Probleme gestellt, doch nicht einmal einen ein-
zigen Buchstaben hatte er in die Datei zu tippen vermocht. Sie befanden sich noch immer in seinem Kopf und
sollte. Keine Frage, es hätte ihn vor keine technischen und intellektuellen Probleme gestellt, doch nicht einmal einen ein-
zigen Buchstaben hatte er in die Datei zu tippen vermocht. Sie befanden sich noch immer in seinem Kopf und Notizbuch. Eine junge Frau, die seit langem vermisst wurde, sollte endlich gefunden werden. In Nürnberg hatte er nach
den strikten Vorgaben der Ermittlungsspitze Adressen überprüft, Personen befragt, Zugverbindungen verifiziert. Die
Notizbuch. Eine junge Frau, die seit langem vermisst wurde, sollte endlich gefunden werden. In Nürnberg hatte er nach
den strikten Vorgaben der Ermittlungsspitze Adressen überprüft, Personen befragt, Zugverbindungen verifiziert. Die Liste war abgearbeitet, und seine Ergebnisse sollte er morgen während der Lagebesprechung der Sonderkommission
Liste war abgearbeitet, und seine Ergebnisse sollte er morgen während der Lagebesprechung der Sonderkommission  vortragen und in Schriftform zu den Akten geben. Bevor er sich endlich daran machte, sie zu erstellen, wollte er sich
vortragen und in Schriftform zu den Akten geben. Bevor er sich endlich daran machte, sie zu erstellen, wollte er sich noch einen Kaffee holen. Er hoffte, dass Renate, die drei Töchter hatte und im Betrieb ihres Mannes das Büro schmiss,
Christine, die die gute Seele der ganzen Gruppe war, und Anne Kathrin, die vom großen Glück mit ihrem Neuen
noch einen Kaffee holen. Er hoffte, dass Renate, die drei Töchter hatte und im Betrieb ihres Mannes das Büro schmiss,
Christine, die die gute Seele der ganzen Gruppe war, und Anne Kathrin, die vom großen Glück mit ihrem Neuen schwärmte und dennoch bezweifelte, endlich den Richtigen gefunden zu haben, noch drüben seien – wenigstens eine
schwärmte und dennoch bezweifelte, endlich den Richtigen gefunden zu haben, noch drüben seien – wenigstens eine von ihnen. Frieser hatte keine Zweifel, dass ihm jede von ihnen sofort ansehen würde, was ihm in diesem Augenblick auf
dem Herzen lag. Längst hatte er sich ohne den Rest eines Grolls damit abgefunden, dass er in den Augen keiner dieser
von ihnen. Frieser hatte keine Zweifel, dass ihm jede von ihnen sofort ansehen würde, was ihm in diesem Augenblick auf
dem Herzen lag. Längst hatte er sich ohne den Rest eines Grolls damit abgefunden, dass er in den Augen keiner dieser Schönheiten als Mann ihr Typ war. Mit den Jahren hatte er auch akzeptiert, dass er überhaupt nicht das war, was man
Schönheiten als Mann ihr Typ war. Mit den Jahren hatte er auch akzeptiert, dass er überhaupt nicht das war, was man unter einem Frauentypen verstand. Vielleicht war er ein Frauenversteher, wenngleich nicht zu Hause. Wie auch immer, der
Geschmack und die Vorlieben der Frauen waren ihm ein Rätsel geblieben. Seit Jahr und Tag war er schlank und hatte
unter einem Frauentypen verstand. Vielleicht war er ein Frauenversteher, wenngleich nicht zu Hause. Wie auch immer, der
Geschmack und die Vorlieben der Frauen waren ihm ein Rätsel geblieben. Seit Jahr und Tag war er schlank und hatte selbst als Fastpensionist noch ein fast jungenhaftes Gesicht, einen Fastadoniskörper und fast noch keine grauen Haare am
Kopf. Doch deswegen glaubte er bei den Frauen nicht höher im Kurs zu stehen wie als 20-Jähriger. Vielleicht lag es auch
daran, dass er sich nicht besonders schick kleiden wollte, kein Aftershave benutzte, sich nur mit Kernseife wusch, nicht
jeden Tag duschte, keinen Dreitagebart trug, dieselben Geschichten und Witze immer wieder erzählte, Pointen vergaß…
Die drei Damen waren schon gegangen und die Kaffeemaschine war ausgesteckt. Unverrichteter Dinge kehrte Frieser in
sein Büro zurück. Sein Mund war trocken, sein Magen flau. In sauren Bratwürsten, neubackenem Schwarzbrot und in ein,
zwei, drei Pilsbieren wusste er dafür die einzig wirksamen Gegenmittel. Doch die Aussicht auf diese Medizin, diese
selbst als Fastpensionist noch ein fast jungenhaftes Gesicht, einen Fastadoniskörper und fast noch keine grauen Haare am
Kopf. Doch deswegen glaubte er bei den Frauen nicht höher im Kurs zu stehen wie als 20-Jähriger. Vielleicht lag es auch
daran, dass er sich nicht besonders schick kleiden wollte, kein Aftershave benutzte, sich nur mit Kernseife wusch, nicht
jeden Tag duschte, keinen Dreitagebart trug, dieselben Geschichten und Witze immer wieder erzählte, Pointen vergaß…
Die drei Damen waren schon gegangen und die Kaffeemaschine war ausgesteckt. Unverrichteter Dinge kehrte Frieser in
sein Büro zurück. Sein Mund war trocken, sein Magen flau. In sauren Bratwürsten, neubackenem Schwarzbrot und in ein,
zwei, drei Pilsbieren wusste er dafür die einzig wirksamen Gegenmittel. Doch die Aussicht auf diese Medizin, diese Genüsse waren ihm in diesem Augenblick so fern wie die Gunst einer schönen Frau. Dabei hätte er sich in diesen
Genüsse waren ihm in diesem Augenblick so fern wie die Gunst einer schönen Frau. Dabei hätte er sich in diesen Sekunden sogar mit einem Lächeln begnügt. Frieser war sich sicher, dass es ihm dann leichter fallen würde, den Computer
erneut hochzufahren, um endlich seine Recherchen niederzuschreiben. Er erinnerte sich an seine Kinderzeit. Als kleiner
Bub ertappte er sich oft in der Haut eines anderen. Wehmut überkam ihn. Stunden- wenn nicht tagelang weidete er sich
an der Vorstellung, Winnetou, Pelé oder Siegfried der Drachentöter zu sein.
Das Telefon klingelte. Sollte er abheben oder den Computer einschalten? Er überlegte, obschon er wusste, dass er
Sekunden sogar mit einem Lächeln begnügt. Frieser war sich sicher, dass es ihm dann leichter fallen würde, den Computer
erneut hochzufahren, um endlich seine Recherchen niederzuschreiben. Er erinnerte sich an seine Kinderzeit. Als kleiner
Bub ertappte er sich oft in der Haut eines anderen. Wehmut überkam ihn. Stunden- wenn nicht tagelang weidete er sich
an der Vorstellung, Winnetou, Pelé oder Siegfried der Drachentöter zu sein.
Das Telefon klingelte. Sollte er abheben oder den Computer einschalten? Er überlegte, obschon er wusste, dass er früher oder später abheben würde. Den Hörer am Ohr sagte er entgegen seiner Gewohnheit »Ja!«, obwohl er seinen
früher oder später abheben würde. Den Hörer am Ohr sagte er entgegen seiner Gewohnheit »Ja!«, obwohl er seinen Namen nennen wollte. Die Staatsanwältin befand sich am anderen Ende der Leitung. Außergewöhnlich. Bei bislang jeder
Begegnung mit ihr hatte ihn das Gefühl beschlichen, sie würde auf ihn herabschauen. Nicht zuletzt, so glaubte er, weil
Namen nennen wollte. Die Staatsanwältin befand sich am anderen Ende der Leitung. Außergewöhnlich. Bei bislang jeder
Begegnung mit ihr hatte ihn das Gefühl beschlichen, sie würde auf ihn herabschauen. Nicht zuletzt, so glaubte er, weil sie wegen des Größenunterschieds, den selbst ihre hohen Hacken nicht ganz zu egalisieren vermochten, zu ihm, dem
sie wegen des Größenunterschieds, den selbst ihre hohen Hacken nicht ganz zu egalisieren vermochten, zu ihm, dem  Fasteinsachtzigathleten aufschauen musste, und er sagte sich: »Die würde ich nicht einmal dann…, wenn nach einem
Fasteinsachtzigathleten aufschauen musste, und er sagte sich: »Die würde ich nicht einmal dann…, wenn nach einem gigantischen Meteoriteneinschlag nur sie und ich übrigblieben.«
»Wer ist am Apparat?«
»Frieser!«
»Ist niemand sonst von den Ermittlern Ihrer K-Gruppe da?«
»Nein, nur ich! Ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen zu dieser späten Stunde mit mir vorliebnehmen!«, sagte Frieser.
»Was tun Sie so lange im Amt?«
»Kaffee trinken und saure Bratwürste essen!«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
»Das würde ich mir nie erlauben, Frau Staatsanwältin!«, gab Frieser todernst von sich und hörte, wie die Frau schluckte
und ausatmete. »Irgendwie ist die Polizeiinspektion Neumarkt direkt bei mir gelandet«, hob sie nach einer Atempause an.
»Diese Verirrungen der Amtswege, o Gott. Wie auch immer, letztendlich zuständig wäre ich ohnehin«, verhehlte sie ihre
Wichtigkeit nicht und kicherte. Die Frau hatte eine hohe Stimme. Frieser empfand sie süßlich – unangenehm.
»Was Sie nicht sagen, Frau Staatsanwältin«, meinte er. Dabei war sein Tonfall von verhaltenem Spott durchweht.
»Hören Sie, Herr Frieser, die Polizeiinspektion Neumarkt wurde zu einem Todesfall gerufen, bei dem auch die Kripo
gigantischen Meteoriteneinschlag nur sie und ich übrigblieben.«
»Wer ist am Apparat?«
»Frieser!«
»Ist niemand sonst von den Ermittlern Ihrer K-Gruppe da?«
»Nein, nur ich! Ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen zu dieser späten Stunde mit mir vorliebnehmen!«, sagte Frieser.
»Was tun Sie so lange im Amt?«
»Kaffee trinken und saure Bratwürste essen!«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
»Das würde ich mir nie erlauben, Frau Staatsanwältin!«, gab Frieser todernst von sich und hörte, wie die Frau schluckte
und ausatmete. »Irgendwie ist die Polizeiinspektion Neumarkt direkt bei mir gelandet«, hob sie nach einer Atempause an.
»Diese Verirrungen der Amtswege, o Gott. Wie auch immer, letztendlich zuständig wäre ich ohnehin«, verhehlte sie ihre
Wichtigkeit nicht und kicherte. Die Frau hatte eine hohe Stimme. Frieser empfand sie süßlich – unangenehm.
»Was Sie nicht sagen, Frau Staatsanwältin«, meinte er. Dabei war sein Tonfall von verhaltenem Spott durchweht.
»Hören Sie, Herr Frieser, die Polizeiinspektion Neumarkt wurde zu einem Todesfall gerufen, bei dem auch die Kripo gefragt ist. In dem Ort Oberstob fand ein Landwirt seine hochbetagte Mutter tot in der Scheune. Vielleicht ein
gefragt ist. In dem Ort Oberstob fand ein Landwirt seine hochbetagte Mutter tot in der Scheune. Vielleicht ein landwirtschaftlicher Unfall. Der Notarzt stellte eine unnatürliche Todesursache fest. Sehen Sie sich mit der
landwirtschaftlicher Unfall. Der Notarzt stellte eine unnatürliche Todesursache fest. Sehen Sie sich mit der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin dort einmal um. Schön wäre, wenn die Kripo doch mit zwei Ermittlern vor
Spurensicherung und der Gerichtsmedizin dort einmal um. Schön wäre, wenn die Kripo doch mit zwei Ermittlern vor Ort aufkreuzen würde«, sagte die Staatsanwältin.
»Ich weiß, was Sie meinen, Frau Staatsanwältin!«, erwiderte Frieser. Er musste schlucken und dachte: »Du blöde Kuh!«
»Dann sind wir uns ja einig. Doch ich denke, mit diesem Fall würden Sie zur Not auch alleine zurechtkommen«, räumte
die etwa 40-Jährige am anderen Ende der Leitung ein. »Alleine zu ermitteln, davor fürchte ich mich nicht – davor habe
Ort aufkreuzen würde«, sagte die Staatsanwältin.
»Ich weiß, was Sie meinen, Frau Staatsanwältin!«, erwiderte Frieser. Er musste schlucken und dachte: »Du blöde Kuh!«
»Dann sind wir uns ja einig. Doch ich denke, mit diesem Fall würden Sie zur Not auch alleine zurechtkommen«, räumte
die etwa 40-Jährige am anderen Ende der Leitung ein. »Alleine zu ermitteln, davor fürchte ich mich nicht – davor habe ich mich noch nie gefürchtet, im Gegenteil …«, betonte Frieser.
»Übrigens, bereits in dieser Woche – am Montag-vormittag – stürzte in Freystadt ein junger Zimmerer vom Dach, und
der Ort Oberstob liegt meines Wissens zwischen Freystadt und Neumarkt«, berichtete die Staatsanwältin, ohne auf
ich mich noch nie gefürchtet, im Gegenteil …«, betonte Frieser.
»Übrigens, bereits in dieser Woche – am Montag-vormittag – stürzte in Freystadt ein junger Zimmerer vom Dach, und
der Ort Oberstob liegt meines Wissens zwischen Freystadt und Neumarkt«, berichtete die Staatsanwältin, ohne auf Friesers Bemerkung auch nur mit einem Wort eingegangen zu sein, und fragte: »Drang das im Amt nicht bis zu ihnen
Friesers Bemerkung auch nur mit einem Wort eingegangen zu sein, und fragte: »Drang das im Amt nicht bis zu ihnen durch?«
»Nein!«, antwortete Frieser und meinte: »Möglicherweise waren die Kollegen Spontl und Neum vor Ort.«
durch?«
»Nein!«, antwortete Frieser und meinte: »Möglicherweise waren die Kollegen Spontl und Neum vor Ort.« Währenddessen wurde die Tür geöffnet. Frieser blickte zur Seite und sah Bachmann. »Frau Staatsanwältin, Sie können
Währenddessen wurde die Tür geöffnet. Frieser blickte zur Seite und sah Bachmann. »Frau Staatsanwältin, Sie können beruhigt schlafen, der Kollege Bachmann steht in der Tür.«
»Bitte, geben Sie ihn mir!«
»Wie Sie wünschen, Frau Staatsanwältin!«
3.
Bachmann setzte sich ans Steuer. Darüber war Frieser froh. Nach der Erledigung ihrer Ermittlungen in Oberstob wollte
er ihm vorschlagen, auf dem Weg zurück nach Regensburg beim Baptist in Sülzbürg einzukehren. Denn dessen Frau
beruhigt schlafen, der Kollege Bachmann steht in der Tür.«
»Bitte, geben Sie ihn mir!«
»Wie Sie wünschen, Frau Staatsanwältin!«
3.
Bachmann setzte sich ans Steuer. Darüber war Frieser froh. Nach der Erledigung ihrer Ermittlungen in Oberstob wollte
er ihm vorschlagen, auf dem Weg zurück nach Regensburg beim Baptist in Sülzbürg einzukehren. Denn dessen Frau hatte jeden Donnerstag saure Bratwürste auf dem Herd. Und Frieser konnte sich dazu ein, zwei, drei oder vier Pilschen
genehmigen, während Bachmann mit Alkoholfreiem vorlieb nehmen musste.
Bei seinen Radtouren entlang des Main-Donau-Kanals und des Ludwig-Donau-Main-Kanals hatte er vor einigen Jahren
zufällig dieses alte Wirtshaus entdeckt. Es sollte im Laufe der Zeit auch halten, was seine Fachwerkfassade, sein
hatte jeden Donnerstag saure Bratwürste auf dem Herd. Und Frieser konnte sich dazu ein, zwei, drei oder vier Pilschen
genehmigen, während Bachmann mit Alkoholfreiem vorlieb nehmen musste.
Bei seinen Radtouren entlang des Main-Donau-Kanals und des Ludwig-Donau-Main-Kanals hatte er vor einigen Jahren
zufällig dieses alte Wirtshaus entdeckt. Es sollte im Laufe der Zeit auch halten, was seine Fachwerkfassade, sein schattiger Biergarten, seine holzvertäfelte Wirtsstube und sein ergrauter und doch junggebliebener Wirt, der die Musik
schattiger Biergarten, seine holzvertäfelte Wirtsstube und sein ergrauter und doch junggebliebener Wirt, der die Musik und die Literatur liebte, Frieser versprochen hatten.
Es war auf Mittag zugegangen. Im teilweise von hohen Linden und Kastanien beschatteten Biergarten saßen
und die Literatur liebte, Frieser versprochen hatten.
Es war auf Mittag zugegangen. Im teilweise von hohen Linden und Kastanien beschatteten Biergarten saßen Einheimische beim Frühschoppen. Sie diskutierten über Fußball, schimpften über die Geldgier der Oberen, grantelten
Einheimische beim Frühschoppen. Sie diskutierten über Fußball, schimpften über die Geldgier der Oberen, grantelten  über die Dürftigkeit des Daseins und belustigten sich über die Missgeschicke und die Dummheiten von lebenden und
über die Dürftigkeit des Daseins und belustigten sich über die Missgeschicke und die Dummheiten von lebenden und toten Zeitgenossen.
Frieser hatte sich an den Nebentisch zu einem anderen Radfahrer gesetzt und sich ein großes Wasser bestellt. Dieser
toten Zeitgenossen.
Frieser hatte sich an den Nebentisch zu einem anderen Radfahrer gesetzt und sich ein großes Wasser bestellt. Dieser bedauerte, dort leider mit der prallen Sonne vorliebnehmen zu müssen. Bei ihnen am Tisch sei Platz und Schatten mehr
als genug, lud sie ein etwas untersetzter Mann von Mitte 60, dessen Haupthaar etwas zurückgewichen war, mit einem
bedauerte, dort leider mit der prallen Sonne vorliebnehmen zu müssen. Bei ihnen am Tisch sei Platz und Schatten mehr
als genug, lud sie ein etwas untersetzter Mann von Mitte 60, dessen Haupthaar etwas zurückgewichen war, mit einem gewinnenden Lächeln ein. Sein etwas älterer Tischnachbar zu seiner Linken nickte. Trotzdem senkte er seinen Kopf,
gewinnenden Lächeln ein. Sein etwas älterer Tischnachbar zu seiner Linken nickte. Trotzdem senkte er seinen Kopf, klappte seine Augenlider hoch und beäugte misstrauisch die beiden Neuen am Tisch; dabei glitt seine Rechte über sein
klappte seine Augenlider hoch und beäugte misstrauisch die beiden Neuen am Tisch; dabei glitt seine Rechte über sein silbergraues Haupt. Als der Wirt mit Friesers großem Was-ser an den Tisch zurückkehrte, brachte er diesem schlanken
silbergraues Haupt. Als der Wirt mit Friesers großem Was-ser an den Tisch zurückkehrte, brachte er diesem schlanken Mann ein irdenes Schnupftabaksgefäß. Es hatte die Form einer kleinen Vase oder eines Bocksbeutels und war mit
Mann ein irdenes Schnupftabaksgefäß. Es hatte die Form einer kleinen Vase oder eines Bocksbeutels und war mit Edelweiß bemalt. Damit klopfte er sich eine Prise auf seinen linken Handrücken und schnupfte. »Wollen Sie auch eine?«,
hieß er an diesem heißen Sommertag Frieser und den anderen willkommen. Beide bedankten sich und lächelten. »Ihr
Edelweiß bemalt. Damit klopfte er sich eine Prise auf seinen linken Handrücken und schnupfte. »Wollen Sie auch eine?«,
hieß er an diesem heißen Sommertag Frieser und den anderen willkommen. Beide bedankten sich und lächelten. »Ihr wisst nicht, was gut ist!«
Ohne ein Wort zu sagen, amüsierte sich sein schmächtiger Altersgenosse, der links neben ihm beim Bier saß, über die
Ablehnung des Angebots. Sein lebhaftes Lächeln war unverkennbar ein Ausdruck dessen. Doch plötzlich, als wollte er
wisst nicht, was gut ist!«
Ohne ein Wort zu sagen, amüsierte sich sein schmächtiger Altersgenosse, der links neben ihm beim Bier saß, über die
Ablehnung des Angebots. Sein lebhaftes Lächeln war unverkennbar ein Ausdruck dessen. Doch plötzlich, als wollte er sich für seine Schadenfreude entschuldigen, streckte er den Handrücken seiner Linken zu seinem Nebenmann hinüber.
sich für seine Schadenfreude entschuldigen, streckte er den Handrücken seiner Linken zu seinem Nebenmann hinüber. Er nickte und lächelte, als ihm eine Prise aufgeladen wurde.
Frieser hoffte, diese Männer, die er danach näher kennen- und schätzen gelernt hatte, an diesem Abend zu treffen.
Er nickte und lächelte, als ihm eine Prise aufgeladen wurde.
Frieser hoffte, diese Männer, die er danach näher kennen- und schätzen gelernt hatte, an diesem Abend zu treffen. »Schorsch, was hältst du davon, auf der Rückfahrt nach Regensburg am Sulzbürg einzukehren?«, schlug Frieser vor,
»Schorsch, was hältst du davon, auf der Rückfahrt nach Regensburg am Sulzbürg einzukehren?«, schlug Frieser vor, »Dort gibt es jeden Donnerstagabend saure Bratwürste und eine gute Unterhaltung.« Bachmann wiegte mit dem Kopf.
»Dort gibt es jeden Donnerstagabend saure Bratwürste und eine gute Unterhaltung.« Bachmann wiegte mit dem Kopf. »Na gut, dann eben nicht«, machte Frieser einen Rückzieher und deutete nach rechts. Seit einigen Minuten befanden sie
sich auf der Straße von Mühlhausen nach Freystadt und ließen nun Sulzbürg rechts liegen. In etwa 500 Meter
»Na gut, dann eben nicht«, machte Frieser einen Rückzieher und deutete nach rechts. Seit einigen Minuten befanden sie
sich auf der Straße von Mühlhausen nach Freystadt und ließen nun Sulzbürg rechts liegen. In etwa 500 Meter Entfernung erstreckte sich dieser Ort an einem Berg, flankiert von zwei vorgelagerten Hügeln. Ganz oben ragten zwei
Entfernung erstreckte sich dieser Ort an einem Berg, flankiert von zwei vorgelagerten Hügeln. Ganz oben ragten zwei Kirchtürme aus dem dichten Schwarzgrün des Walds, der wie eine Haube den Berg bedeckte. Weiter unten waren einige
helle Häuser mit roten Dächern erkenn-bar. »Dort oben ist auch dieses Wirtshaus«, merkte Frieser an.
»Ich bin gespannt, was uns in Oberstob erwartet«, meinte Bachmann.
»Ein Bauer fand seine Mutter tot in der Scheune«, so Frieser.
»Sicherlich ein Unfall«, meinte Bachmann. Nachdem sie durch einige Dörfer gefahren waren, erstrahlte im versinkenden
Rot der untergehenden Sonne plötzlich eine grünspangrüne Barockkuppel. »Die Wallfahrtskirche von Freystadt«, erklärte
Frieser. »Ich kenne sie von meinen Radtouren.«
Kirchtürme aus dem dichten Schwarzgrün des Walds, der wie eine Haube den Berg bedeckte. Weiter unten waren einige
helle Häuser mit roten Dächern erkenn-bar. »Dort oben ist auch dieses Wirtshaus«, merkte Frieser an.
»Ich bin gespannt, was uns in Oberstob erwartet«, meinte Bachmann.
»Ein Bauer fand seine Mutter tot in der Scheune«, so Frieser.
»Sicherlich ein Unfall«, meinte Bachmann. Nachdem sie durch einige Dörfer gefahren waren, erstrahlte im versinkenden
Rot der untergehenden Sonne plötzlich eine grünspangrüne Barockkuppel. »Die Wallfahrtskirche von Freystadt«, erklärte
Frieser. »Ich kenne sie von meinen Radtouren.«
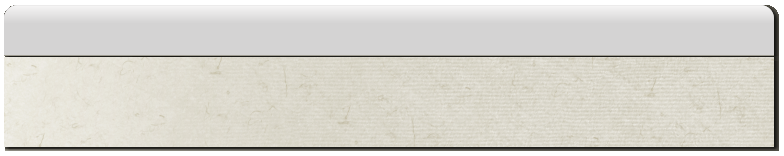

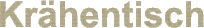



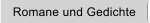




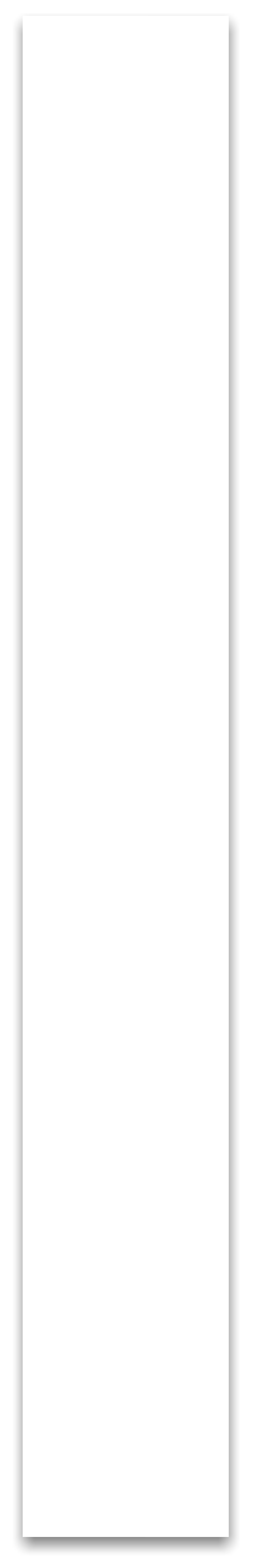
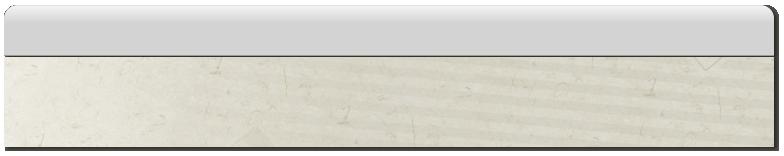


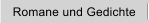

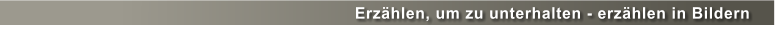 Krähentisch - Kriminalroman 2015
Der Roman erschien am 29. Mai 2015 im Spielberg Verlag Regensburg
Buch, ISBN 978-3-95452-680-2 9,90 Euro 150 Seiten, Textumfang ca. 27500 Wörter
eBook, erschienen am 21.07.2015, ISBN 978-3-95452-070-1 3,99 Euro
Zeit und Orte: Ende Juni bis Mitte August 2014
Freystadt und Umgebung, Sulzbürg, Buch, Neumarkt, Regensburg, Nürnberg
Der Roman kann in jeder Buchhandlung erhalten oder bei mehreren Internetanbietern bezogen werden
oder direkt beim Autor vor Ort gekauft oder bestellt werden - Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Die Hausbrauerei Katzerer in Sondersfeld bietet zum Roman ein Krimibier an.
Inhalt
Im Oberpfälzer Jura überschlagen sich die Ereignisse. Unfall oder Mord? Im Nu ist nichts mehr wie es war.
Verdächtigungen werden gestreut. Was einige Frauen wahrzunehmen glauben, steht im Widerspruch zu den
Fakten. Dennoch will sich Frieser, der ermittelnde Kriminalbeamte, auch damit befassen. Doch plötzlich ist
Eile geboten. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Der Krähentisch rückt in den Brennpunkt…
Inspiriert von einer wahren Begebenheit
Hoch über dem Felsplateau nahe der Burg Wolfstein sind Krähen am Himmel. Ihre kehligen Schreie
Krähentisch - Kriminalroman 2015
Der Roman erschien am 29. Mai 2015 im Spielberg Verlag Regensburg
Buch, ISBN 978-3-95452-680-2 9,90 Euro 150 Seiten, Textumfang ca. 27500 Wörter
eBook, erschienen am 21.07.2015, ISBN 978-3-95452-070-1 3,99 Euro
Zeit und Orte: Ende Juni bis Mitte August 2014
Freystadt und Umgebung, Sulzbürg, Buch, Neumarkt, Regensburg, Nürnberg
Der Roman kann in jeder Buchhandlung erhalten oder bei mehreren Internetanbietern bezogen werden
oder direkt beim Autor vor Ort gekauft oder bestellt werden - Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Die Hausbrauerei Katzerer in Sondersfeld bietet zum Roman ein Krimibier an.
Inhalt
Im Oberpfälzer Jura überschlagen sich die Ereignisse. Unfall oder Mord? Im Nu ist nichts mehr wie es war.
Verdächtigungen werden gestreut. Was einige Frauen wahrzunehmen glauben, steht im Widerspruch zu den
Fakten. Dennoch will sich Frieser, der ermittelnde Kriminalbeamte, auch damit befassen. Doch plötzlich ist
Eile geboten. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Der Krähentisch rückt in den Brennpunkt…
Inspiriert von einer wahren Begebenheit
Hoch über dem Felsplateau nahe der Burg Wolfstein sind Krähen am Himmel. Ihre kehligen Schreie verhallen im Tal…
Siehe Rubrik Aktuelles: Laudatio des Juristen Florian Schübel anlässlich der Vorstellung von
Krähentisch
Februar/März 2017 - Realschule Neutraubling: Krähentisch ist im Deutschunterricht der
9. Jahrgangstufe Thema einer Projektschulaufgabe
Wolfgang Fellner, Lokalredakteur der Neumarkter Nachrichten, schreibt über den Roman anlässlich der Lesung vom
10. Dezember 2013 im Rahmen von "Freystadt liest":
Spannend:
"Krähentisch" lockt viele Gäste
FREYSTADT - Vor vollem Haus gab es die letzte Lesung von Freystadt liest vor Weihnachten: Über 30 begeisterte
Literatur-Fans waren da, um Hans Regensburger zu lauschen, der eine Werkprobe aus seinem ersten Krimi gab. Das
Café im historischen Spitalstadl war übervoll, als der bekannte Mörsdorfer zu den ersten Seiten seines derzeit im
entstehen begriffenen Buches griff. "Haben Sie denn keinen Krimi im Angebot", sei er in letzter Zeit immer wieder von
Verlegern gefragt worden. Habe er nicht, sagte Regensburger, weil er sich für dieses Genre eigentlich nicht so
erwärme.
Umso spannender dann das, was sich in "Krähentisch" abspielt. Regensburger überzeugt auf den ersten Seiten durch
große Beobachtungsgabe, stellt seine Figuren geschickt vor und hat vor allem einen grausigen Plot gefunden. Als es
richtig spannend wurde, war Schluss. Die Auflösung, sagt er nach viel Applaus, gebe es vielleicht im kommenden
Herbst.
Leseprobe
1.
Der Wetterbericht versprach, dass sich auch dieser Montagvormittag zu einem ähnlich heißen Sommertag entfalten
verhallen im Tal…
Siehe Rubrik Aktuelles: Laudatio des Juristen Florian Schübel anlässlich der Vorstellung von
Krähentisch
Februar/März 2017 - Realschule Neutraubling: Krähentisch ist im Deutschunterricht der
9. Jahrgangstufe Thema einer Projektschulaufgabe
Wolfgang Fellner, Lokalredakteur der Neumarkter Nachrichten, schreibt über den Roman anlässlich der Lesung vom
10. Dezember 2013 im Rahmen von "Freystadt liest":
Spannend:
"Krähentisch" lockt viele Gäste
FREYSTADT - Vor vollem Haus gab es die letzte Lesung von Freystadt liest vor Weihnachten: Über 30 begeisterte
Literatur-Fans waren da, um Hans Regensburger zu lauschen, der eine Werkprobe aus seinem ersten Krimi gab. Das
Café im historischen Spitalstadl war übervoll, als der bekannte Mörsdorfer zu den ersten Seiten seines derzeit im
entstehen begriffenen Buches griff. "Haben Sie denn keinen Krimi im Angebot", sei er in letzter Zeit immer wieder von
Verlegern gefragt worden. Habe er nicht, sagte Regensburger, weil er sich für dieses Genre eigentlich nicht so
erwärme.
Umso spannender dann das, was sich in "Krähentisch" abspielt. Regensburger überzeugt auf den ersten Seiten durch
große Beobachtungsgabe, stellt seine Figuren geschickt vor und hat vor allem einen grausigen Plot gefunden. Als es
richtig spannend wurde, war Schluss. Die Auflösung, sagt er nach viel Applaus, gebe es vielleicht im kommenden
Herbst.
Leseprobe
1.
Der Wetterbericht versprach, dass sich auch dieser Montagvormittag zu einem ähnlich heißen Sommertag entfalten würde wie die Tage zuvor – für Zimmerer am Bau tausendmal besser als Regen, Wind und Kälte. Zwei von ihnen setzten
am Rande von Freystadt dem Neubau eines Wohnhauses den Dachstuhl auf.
Es war unvermeidlich, dass deren Werkeln auch in die unmittelbare Umgebung dieser Baustelle drang. Jenseits dieses
würde wie die Tage zuvor – für Zimmerer am Bau tausendmal besser als Regen, Wind und Kälte. Zwei von ihnen setzten
am Rande von Freystadt dem Neubau eines Wohnhauses den Dachstuhl auf.
Es war unvermeidlich, dass deren Werkeln auch in die unmittelbare Umgebung dieser Baustelle drang. Jenseits dieses Zirkels lag im Westen die Straße nach Neumarkt, im Norden der Fohlenhof, im Osten die Marienvorstadt und im Süden
die Wallfahrtskirche. Wenngleich das Hantieren dieser Handwerker von den Leuten in der Nähe kaum überhört worden
sein konnte, dürften sie ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Einerlei, ob das helltönende Hämmern
ab und an im Takt erklang, eintönig eine Kreissäge kreischte oder eine Motorsäge knatterte oder heulte. Wer wollte wegen
solcher Geräusche und Töne, die zweifelsohne in völliger Übereinstimmung mit dem Anblick dieser Arbeiten hoch auf
Zirkels lag im Westen die Straße nach Neumarkt, im Norden der Fohlenhof, im Osten die Marienvorstadt und im Süden
die Wallfahrtskirche. Wenngleich das Hantieren dieser Handwerker von den Leuten in der Nähe kaum überhört worden
sein konnte, dürften sie ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Einerlei, ob das helltönende Hämmern
ab und an im Takt erklang, eintönig eine Kreissäge kreischte oder eine Motorsäge knatterte oder heulte. Wer wollte wegen
solcher Geräusche und Töne, die zweifelsohne in völliger Übereinstimmung mit dem Anblick dieser Arbeiten hoch auf einem werdenden Dach waren, vom Fahrrad absteigen, bei der Gartenarbeit aufschauen, auf dem Weg zum Einkaufen
einem werdenden Dach waren, vom Fahrrad absteigen, bei der Gartenarbeit aufschauen, auf dem Weg zum Einkaufen innehalten, einen Arzttermin absagen…?
Das wäre an diesem Montagvormittag viel eher jenen Worten aus dem Mund der beiden Zimmerer zugekommen, die
innehalten, einen Arzttermin absagen…?
Das wäre an diesem Montagvormittag viel eher jenen Worten aus dem Mund der beiden Zimmerer zugekommen, die ihnen scharf und schneidend wie das Jaulen einer Peitsche entfuhren. Davon wären die meisten Leute sicherlich hellhörig
geworden und einigen unter ihnen wäre gewiss der Schrecken unter die Haut gefahren. In ihrer blinden Wut mochten die
beiden Zimmerer sich einen Dreck darum geschert haben, dass ihre Kraftausdrücke über die Baustelle hinausdrangen
ihnen scharf und schneidend wie das Jaulen einer Peitsche entfuhren. Davon wären die meisten Leute sicherlich hellhörig
geworden und einigen unter ihnen wäre gewiss der Schrecken unter die Haut gefahren. In ihrer blinden Wut mochten die
beiden Zimmerer sich einen Dreck darum geschert haben, dass ihre Kraftausdrücke über die Baustelle hinausdrangen und nicht unter ihnen blieben wie das Surren des Baukrans, den Kevin führte. Dennoch war es unwahrscheinlich, dass zu
dieser geschäftigen Tages- und Jahreszeit ihr lauthalsiger Schlagabtausch ins Ohr Dritter fand.
Robert, der 50-Jährige, war bis aufs Blut gereizt. Immer wieder regte er sich über Kevin auf. Dieser blonde, langhaarige
und nicht unter ihnen blieben wie das Surren des Baukrans, den Kevin führte. Dennoch war es unwahrscheinlich, dass zu
dieser geschäftigen Tages- und Jahreszeit ihr lauthalsiger Schlagabtausch ins Ohr Dritter fand.
Robert, der 50-Jährige, war bis aufs Blut gereizt. Immer wieder regte er sich über Kevin auf. Dieser blonde, langhaarige 20-Jährige war bereits seit dem frühen Morgen der Anlass und das Ziel seiner Wut. Noch war es zwi-schen ihnen nicht
20-Jährige war bereits seit dem frühen Morgen der Anlass und das Ziel seiner Wut. Noch war es zwi-schen ihnen nicht zum Streit gekommen; doch er lag längst in der Luft. Stundenlang hatte Kevin Roberts Nörgeln und Schimpfen ohne ein
Wort der Entgegnung über sich ergehen lassen.
Bereits in der Frühe, beim Beladen des Lasters in der Zimmerei in Niederstob, hatte Sepp, der Chef, ihn vor den Kopf
gestoßen. Nicht wie gewohnt wurde ihm Rainer zugeteilt, sondern Kevin. Schon am Sonntag hätte er diesen erwürgen
zum Streit gekommen; doch er lag längst in der Luft. Stundenlang hatte Kevin Roberts Nörgeln und Schimpfen ohne ein
Wort der Entgegnung über sich ergehen lassen.
Bereits in der Frühe, beim Beladen des Lasters in der Zimmerei in Niederstob, hatte Sepp, der Chef, ihn vor den Kopf
gestoßen. Nicht wie gewohnt wurde ihm Rainer zugeteilt, sondern Kevin. Schon am Sonntag hätte er diesen erwürgen können und den Trainer ohrfeigen wollen. Dieser hatte nicht seinen Sohn in der ersten Mannschaft aufgestellt, sondern
können und den Trainer ohrfeigen wollen. Dieser hatte nicht seinen Sohn in der ersten Mannschaft aufgestellt, sondern erneut diesen ballverliebten Dribbler. Doch nur, weil er vor einigen Monaten beim Auswärtsspiel in Freystadt einen 3:0
Pausenrückstand noch in einen 4:3 Sieg für den FC Oberstob verwandelt hatte. Es wurmte Robert, dass Kevin von
erneut diesen ballverliebten Dribbler. Doch nur, weil er vor einigen Monaten beim Auswärtsspiel in Freystadt einen 3:0
Pausenrückstand noch in einen 4:3 Sieg für den FC Oberstob verwandelt hatte. Es wurmte Robert, dass Kevin von solchen Einzelleistungen monatelang zehren konnte. Sein Sohn jedoch, der mannschaftsdienlich und gradlinig Fußball
solchen Einzelleistungen monatelang zehren konnte. Sein Sohn jedoch, der mannschaftsdienlich und gradlinig Fußball spielte wie kein Zweiter, wurde von diesem Trainer wie schon so oft in die Reservemannschaft verbannt, oder er ließ ihn
als Auswechselspieler auf der Bank schmoren. Was müsse auf dem Fußballplatz noch alles geschehen, dass das auch
spielte wie kein Zweiter, wurde von diesem Trainer wie schon so oft in die Reservemannschaft verbannt, oder er ließ ihn
als Auswechselspieler auf der Bank schmoren. Was müsse auf dem Fußballplatz noch alles geschehen, dass das auch einmal diesem Kevin widerfahre, hatte sich Robert nach dem Auswärtsspiel am Sonntag in Woffenbach nicht zum ersten
Mal gefragt.
Dreimal war Kevin mit dem Ball am Fuß alleine vors Tor gekommen und kein einziges Mal hatten auf dem Platz die
einmal diesem Kevin widerfahre, hatte sich Robert nach dem Auswärtsspiel am Sonntag in Woffenbach nicht zum ersten
Mal gefragt.
Dreimal war Kevin mit dem Ball am Fuß alleine vors Tor gekommen und kein einziges Mal hatten auf dem Platz die Spieler des FC Oberstob und draußen dessen Fans jubeln können. Es kam, wie es kommen musste: Nach dem
Spieler des FC Oberstob und draußen dessen Fans jubeln können. Es kam, wie es kommen musste: Nach dem Schlusspfiff verließen die Woffenbacher als glückliche Sieger den Platz, mit einem 1:0, das ihnen indirekt Kevin
Schlusspfiff verließen die Woffenbacher als glückliche Sieger den Platz, mit einem 1:0, das ihnen indirekt Kevin gescheckt hatte.
Mit diesem Versager, der beim Beladen des Lasters noch nach Alkohol roch, musste er auf die Baustelle. Noch
gescheckt hatte.
Mit diesem Versager, der beim Beladen des Lasters noch nach Alkohol roch, musste er auf die Baustelle. Noch schlimmer, er musste ans Steuer des Lasters. Wussten der Chef und jedermann in der Zimmerei nicht längst, dass er seit
einiger Zeit lieber auf dem Beifahrersitz Platz nahm? So gerne er sich früher selbst ans Steuer eines LKWs gesetzt hatte,
so ungern fuhr er seit einigen Jahren selbst.
Bereits der erste Sparren, den am Laster ste-hend Kevin angegurtet, an den Haken des Krans gehängt hatte und den
schlimmer, er musste ans Steuer des Lasters. Wussten der Chef und jedermann in der Zimmerei nicht längst, dass er seit
einiger Zeit lieber auf dem Beifahrersitz Platz nahm? So gerne er sich früher selbst ans Steuer eines LKWs gesetzt hatte,
so ungern fuhr er seit einigen Jahren selbst.
Bereits der erste Sparren, den am Laster ste-hend Kevin angegurtet, an den Haken des Krans gehängt hatte und den Robert oben am Bau ergreifen sollte, hätte diesen beinahe von dort heruntergefegt. »Wie nur hast du Depp das Holz
Robert oben am Bau ergreifen sollte, hätte diesen beinahe von dort heruntergefegt. »Wie nur hast du Depp das Holz anghängt? Ich glaub´s nicht! – Total aus der Waag und verdreht.« Robert hatte es gleich gewusst, dass mit solch einem
anghängt? Ich glaub´s nicht! – Total aus der Waag und verdreht.« Robert hatte es gleich gewusst, dass mit solch einem Mann auf der Bau-stelle der Ärger vorprogrammiert war.
»Hast das Holz am Blei?«, rief Robert zu Kevin hinunter, der am Schwellenholz stehend den Sparren er-wartet und mit
beiden Händen entgegengenommen hatte und ihn dort linksbündig an den dicken Bleistift-strich drücken und dann
Mann auf der Bau-stelle der Ärger vorprogrammiert war.
»Hast das Holz am Blei?«, rief Robert zu Kevin hinunter, der am Schwellenholz stehend den Sparren er-wartet und mit
beiden Händen entgegengenommen hatte und ihn dort linksbündig an den dicken Bleistift-strich drücken und dann festnageln sollte. Als Robert Kevins »Ja!«, vernahm, hämmerte er mit seinem Zim-mer-mannsbeil den Sparren an der
festnageln sollte. Als Robert Kevins »Ja!«, vernahm, hämmerte er mit seinem Zim-mer-mannsbeil den Sparren an der Pfette fest, und Kevin nagelte ihn ans Schwellenholz. Dann quälte sich der ruhige Typ, der technisch versierte Fußballer,
den sie Bernd riefen – sein Aussehen, seine Statur und Spielweise erinnerten an den Blonden Engel, an den großen Bernd
Schuster –, langsam die Leiter hinunter und über-gab sich an der Ziegelmauer des Rohbaus. Wie einen Pullover hatte er
sich der Funksteuerung des Baukrans entledigt, die vor seinem Bauch hing. Das an Hosenträgergurten befestigte
Pfette fest, und Kevin nagelte ihn ans Schwellenholz. Dann quälte sich der ruhige Typ, der technisch versierte Fußballer,
den sie Bernd riefen – sein Aussehen, seine Statur und Spielweise erinnerten an den Blonden Engel, an den großen Bernd
Schuster –, langsam die Leiter hinunter und über-gab sich an der Ziegelmauer des Rohbaus. Wie einen Pullover hatte er
sich der Funksteuerung des Baukrans entledigt, die vor seinem Bauch hing. Das an Hosenträgergurten befestigte Kästchen hatte er so im letzten Augenblick vor seinem Mageninhalt in Sicherheit bringen können. Nun kommentierte
Kästchen hatte er so im letzten Augenblick vor seinem Mageninhalt in Sicherheit bringen können. Nun kommentierte Robert oben auf einer Pfette stehend das, was seinen Blicken entzogen war: »Gscheit sollst dich rumhaun – gescheit! So
hört sich also ein blonder Engel an, wenn er kotzt; von wegen Engel – Reiher.« Roberts spöttische Lacher erreichten Kevin
nicht.
Nachdem er mithilfe einer Schaufel das Gespiene mit Erde abgedeckt und sich die Funksteuerung wieder übergestreift
hatte, stieg er auf den Laster und befestigte am Haken des Baukrans den nächsten Sparren. Erneut begann Robert zu
Robert oben auf einer Pfette stehend das, was seinen Blicken entzogen war: »Gscheit sollst dich rumhaun – gescheit! So
hört sich also ein blonder Engel an, wenn er kotzt; von wegen Engel – Reiher.« Roberts spöttische Lacher erreichten Kevin
nicht.
Nachdem er mithilfe einer Schaufel das Gespiene mit Erde abgedeckt und sich die Funksteuerung wieder übergestreift
hatte, stieg er auf den Laster und befestigte am Haken des Baukrans den nächsten Sparren. Erneut begann Robert zu schimpfen: »Hättst den Ball ins Tor reinghaut und nicht so viel gesoffen gestern, wenn du´s nicht verträgst, du Depp, du
Idiot, du blöder Hund, du blöder! Wenn von deiner Kotzerei der Chef was spannt oder der Bauherr … O Gott? – Schon
am Abend ist Richtfest …« Als Robert nach dem Balken griff, der am Kranhaken zu ihm herunterschwebte, hielt er inne.
Kaum drei Minuten später hatte er auch diesen Sparren an der Pfette festgenagelt. Robert hörte und sah, dass Kevin
schimpfen: »Hättst den Ball ins Tor reinghaut und nicht so viel gesoffen gestern, wenn du´s nicht verträgst, du Depp, du
Idiot, du blöder Hund, du blöder! Wenn von deiner Kotzerei der Chef was spannt oder der Bauherr … O Gott? – Schon
am Abend ist Richtfest …« Als Robert nach dem Balken griff, der am Kranhaken zu ihm herunterschwebte, hielt er inne.
Kaum drei Minuten später hatte er auch diesen Sparren an der Pfette festgenagelt. Robert hörte und sah, dass Kevin unten an der Mauerschwelle noch immer hämmerte. Erst zur Hälfte hatte er den Nagel ins Holz getrieben. Sein nächster
Schlag ging daneben und mit dem übernächsten schlug er den Nagel krumm. Es dauerte einige Minuten, bis er den
unten an der Mauerschwelle noch immer hämmerte. Erst zur Hälfte hatte er den Nagel ins Holz getrieben. Sein nächster
Schlag ging daneben und mit dem übernächsten schlug er den Nagel krumm. Es dauerte einige Minuten, bis er den langen, dicken Zimmermannsnagel herausgezogen und an seiner Stelle einen neuen im Holz versenkt hatte. »Wenn das
langen, dicken Zimmermannsnagel herausgezogen und an seiner Stelle einen neuen im Holz versenkt hatte. »Wenn das in dem Tempo so weitergeht, dann können wir vom Chef was erleben…! Und wer ist schuld …?«, schrie Robert aus
in dem Tempo so weitergeht, dann können wir vom Chef was erleben…! Und wer ist schuld …?«, schrie Robert aus Leibeskräften und mit unerbittlichem Ernst in der Stimme. Nach einiger Zeit spürte Robert die Sonne im Rücken und
Leibeskräften und mit unerbittlichem Ernst in der Stimme. Nach einiger Zeit spürte Robert die Sonne im Rücken und blickte auf die Uhr. Es war zehn. Die Uhrzeit, die Robert nannte, war das erste und einzige Wort an diesem halben
blickte auf die Uhr. Es war zehn. Die Uhrzeit, die Robert nannte, war das erste und einzige Wort an diesem halben Vormittag, das er nicht im Zorn von sich gegeben hatte. Während die Glocke der Stadtpfarrkirche zehn Uhr schlug,
Vormittag, das er nicht im Zorn von sich gegeben hatte. Während die Glocke der Stadtpfarrkirche zehn Uhr schlug, schwebte am Haken des Krans jener Sparren, mit dem eine Seite des Dachstuhls vervollständigt werden sollte. Davon war
er etwas später ein fester Bestandteil. Robert stieg auf diesen Sparren und ging zu Kevin hinunter.
Gehalten und geführt von seinen Händen, die er auf die Sparren links und rechts neben sich setzte, ließ er sich dann
schwebte am Haken des Krans jener Sparren, mit dem eine Seite des Dachstuhls vervollständigt werden sollte. Davon war
er etwas später ein fester Bestandteil. Robert stieg auf diesen Sparren und ging zu Kevin hinunter.
Gehalten und geführt von seinen Händen, die er auf die Sparren links und rechts neben sich setzte, ließ er sich dann wie ein Turner am Barren mit den Füßen voraus aufs Schutzgerüst gleiten. Von dort aus überprüfte er mit
wie ein Turner am Barren mit den Füßen voraus aufs Schutzgerüst gleiten. Von dort aus überprüfte er mit fachmännischen Blicken die Arbeit der vergangenen Stunden – aus mehreren Blickwinkeln die Front der Sparrenreihung.
Er nickte mit mürrischem Blick. Es schien, er wollte dahinter seine Zufriedenheit verstecken. Nun kletterte er zurück auf
den halbfertigen Dachstuhl, griff nach seinem Beil, das er dort nach dem Herabsteigen abgelegt hatte, und stieg von
fachmännischen Blicken die Arbeit der vergangenen Stunden – aus mehreren Blickwinkeln die Front der Sparrenreihung.
Er nickte mit mürrischem Blick. Es schien, er wollte dahinter seine Zufriedenheit verstecken. Nun kletterte er zurück auf
den halbfertigen Dachstuhl, griff nach seinem Beil, das er dort nach dem Herabsteigen abgelegt hatte, und stieg von einem Sparren zum andern; dabei begutachtete er Kevins Arbeit. Sein Ziel war der Westgiebel. »Ich glaub, ich spinn!«,
einem Sparren zum andern; dabei begutachtete er Kevins Arbeit. Sein Ziel war der Westgiebel. »Ich glaub, ich spinn!«, entrüstete er sich plötzlich auf der Hälfte seines Weges. »Du Depp, hast ab da immer wieder einmal einen Sparren fast
entrüstete er sich plötzlich auf der Hälfte seines Weges. »Du Depp, hast ab da immer wieder einmal einen Sparren fast einen Zentimeter daneben genagelt. Bist du noch zu retten?« Kevin brachte keinen Laut über die Lippen; er zuckte mit
einen Zentimeter daneben genagelt. Bist du noch zu retten?« Kevin brachte keinen Laut über die Lippen; er zuckte mit den Achseln. Robert musterte ihn und schrie: »Du bist genauso blöd wie deine Alten. Da kann ich von Glück reden, dass
ich damals deiner Mutter den Laufpass gegeben hab!« Kevin hob seinen Blick und starrte Robert an. Er war den Tränen
nahe, bewegte seinen Mund als ob er etwas sagen würde, doch er konnte sich nicht aus den Fängen seiner Verstummung
befreien. Erst als seine Tränen flossen, flossen auch seine Worte. Mit ihnen bezichtigte er Robert der Lüge. Er bebte:
den Achseln. Robert musterte ihn und schrie: »Du bist genauso blöd wie deine Alten. Da kann ich von Glück reden, dass
ich damals deiner Mutter den Laufpass gegeben hab!« Kevin hob seinen Blick und starrte Robert an. Er war den Tränen
nahe, bewegte seinen Mund als ob er etwas sagen würde, doch er konnte sich nicht aus den Fängen seiner Verstummung
befreien. Erst als seine Tränen flossen, flossen auch seine Worte. Mit ihnen bezichtigte er Robert der Lüge. Er bebte: »Meine Mama hätte einen wie dich nicht einmal mit der Beißzange angfasst. Du bist ein ganz hundsgemeiner
»Meine Mama hätte einen wie dich nicht einmal mit der Beißzange angfasst. Du bist ein ganz hundsgemeiner Sprüchbeutel und ein Arschloch, sonst nichts! Ein richtiges Arschloch bist du! Dass du´s nur weißt!« Doch Robert trieb
seinen Spott auf die Spitze und behauptete: »Gvögelt ho is deij Muhda, und wij!«
»Du Sau, du lijchade!«, schrie Kevin aus Leibeskräften.
»Halt dein Maul, sonst kannst was erleben!«, drohte Robert.
»Halt du dein Maul!«, konterte Kevin. »Wie seid ihr daheim mit deinem Bruder umgangen, dem Jimmy? Davonghaut
Sprüchbeutel und ein Arschloch, sonst nichts! Ein richtiges Arschloch bist du! Dass du´s nur weißt!« Doch Robert trieb
seinen Spott auf die Spitze und behauptete: »Gvögelt ho is deij Muhda, und wij!«
»Du Sau, du lijchade!«, schrie Kevin aus Leibeskräften.
»Halt dein Maul, sonst kannst was erleben!«, drohte Robert.
»Halt du dein Maul!«, konterte Kevin. »Wie seid ihr daheim mit deinem Bruder umgangen, dem Jimmy? Davonghaut hab ihr ihn und um sein Erbe betrogen – du und deine schöne Mutter, kaum dass dein Vater unter der Erde war!«
»Noch ein Wort und ich vergess mich!«, plärrte Robert, dass seine Stirnadern schwollen; dabei schwang er sein Beil.
»Hör ruhig an, was dein eigener Bruder sagt«, schrie Kevin zurück und wischte sich mit der flachen Hand seine Tränen
von den Wangen; er weinte nicht mehr. »Ich treff ihn oft im Oberen Ganskeller in Neumarkt und unterhalt mich mit
hab ihr ihn und um sein Erbe betrogen – du und deine schöne Mutter, kaum dass dein Vater unter der Erde war!«
»Noch ein Wort und ich vergess mich!«, plärrte Robert, dass seine Stirnadern schwollen; dabei schwang er sein Beil.
»Hör ruhig an, was dein eigener Bruder sagt«, schrie Kevin zurück und wischte sich mit der flachen Hand seine Tränen
von den Wangen; er weinte nicht mehr. »Ich treff ihn oft im Oberen Ganskeller in Neumarkt und unterhalt mich mit ihm«, erzählte Kevin und wiederholte, dass Roberts älterer Halbbruder von diesem und dessen Mutter vor Jahren
ihm«, erzählte Kevin und wiederholte, dass Roberts älterer Halbbruder von diesem und dessen Mutter vor Jahren geschlagen und vom Hof verjagt worden sei, um sich dessen Erbe unter den Nagel zu reißen. Dabei versuchte ihm
geschlagen und vom Hof verjagt worden sei, um sich dessen Erbe unter den Nagel zu reißen. Dabei versuchte ihm Robert einige Male ins Wort zu fallen und aufzutragen, er solle an diesen arbeitsscheuen Suffkopf und Taugenichts von
»Stiefbruder« ausrichten, wenn er nochmals bei ihm am Hof, im Stall und in der Scheune herumschleiche, werde ihn sein
Hund zerfleischen. Doch das hatte Kevins Redefluss nicht ein einziges Mal ins Stocken gebracht. Im Gegenteil: er hatte
Roberts Störfeuer den Garaus gemacht. »Das aber willst nicht hörn, ja. Du grausamer Mensch, du!«, behauptete Kevin
Robert einige Male ins Wort zu fallen und aufzutragen, er solle an diesen arbeitsscheuen Suffkopf und Taugenichts von
»Stiefbruder« ausrichten, wenn er nochmals bei ihm am Hof, im Stall und in der Scheune herumschleiche, werde ihn sein
Hund zerfleischen. Doch das hatte Kevins Redefluss nicht ein einziges Mal ins Stocken gebracht. Im Gegenteil: er hatte
Roberts Störfeuer den Garaus gemacht. »Das aber willst nicht hörn, ja. Du grausamer Mensch, du!«, behauptete Kevin und warf ihm mit einem herausfordernden Lächeln und Blick vor: »Stiefbruder sagst, obwohl er dein Halbbruder ist.
und warf ihm mit einem herausfordernden Lächeln und Blick vor: »Stiefbruder sagst, obwohl er dein Halbbruder ist. Schäm dich doch, du scheinheiliger Lump, du! Du Pharisäer, du! Du Wichser, du!« In diesem Augenblick warf Robert sein
Beil nach ihm. Es verfehlte Kevin. Dieser erbleichte. Robert stieg auf den nächstbesten Sparren und lief quer über die
Schäm dich doch, du scheinheiliger Lump, du! Du Pharisäer, du! Du Wichser, du!« In diesem Augenblick warf Robert sein
Beil nach ihm. Es verfehlte Kevin. Dieser erbleichte. Robert stieg auf den nächstbesten Sparren und lief quer über die anderen zu Kevin hinüber, der am Ostgiebel noch immer wie angewurzelt dastand. Nun jedoch ergriff er die Flucht;
anderen zu Kevin hinüber, der am Ostgiebel noch immer wie angewurzelt dastand. Nun jedoch ergriff er die Flucht; schwang sich, gestützt auf seine Linke, mit einem Hüftsprung um sie herum über einige Sparrenköpfe. Sein Ziel war das
Schutzgerüst des zweigeschossigen Rohbaus, das wie ein Balkon dort oben hing. Jene Diele, auf die Kevin mit beiden
schwang sich, gestützt auf seine Linke, mit einem Hüftsprung um sie herum über einige Sparrenköpfe. Sein Ziel war das
Schutzgerüst des zweigeschossigen Rohbaus, das wie ein Balkon dort oben hing. Jene Diele, auf die Kevin mit beiden Füßen voraus und der Wucht und Fallgeschwindigkeit seines Körpers landete, gab nach und schnellte am anderen Ende
in die Höhe. Kevin entfuhr ein Schrei und stürzte durch die Lücke, die sich im Nu unter ihm aufgetan hatte, in die Tiefe.
Dort lagen Amiereisen. Sein Oberkörper wurde von einigen Winkeln durchstoßen, die mit einem Schenkel wie rostige
Füßen voraus und der Wucht und Fallgeschwindigkeit seines Körpers landete, gab nach und schnellte am anderen Ende
in die Höhe. Kevin entfuhr ein Schrei und stürzte durch die Lücke, die sich im Nu unter ihm aufgetan hatte, in die Tiefe.
Dort lagen Amiereisen. Sein Oberkörper wurde von einigen Winkeln durchstoßen, die mit einem Schenkel wie rostige Spieße senkrecht aus dem etwa drei Meter breiten und fünf Meter langen Eisenpaket ragten. Auf dem Dach war Robert
mittlerweile am Ostgiebel angekommen, wo er Kevin hatte verfolgen oder stellen wollen. Nun stand er dort oben und
Spieße senkrecht aus dem etwa drei Meter breiten und fünf Meter langen Eisenpaket ragten. Auf dem Dach war Robert
mittlerweile am Ostgiebel angekommen, wo er Kevin hatte verfolgen oder stellen wollen. Nun stand er dort oben und schaute nach unten. Durch die Lücke im Gerüstboden sah er Kevin liegen. Er rührte sich nicht mehr. Die Diele, die
schaute nach unten. Durch die Lücke im Gerüstboden sah er Kevin liegen. Er rührte sich nicht mehr. Die Diele, die unter ihm wie eine Wippschaukel nachgegeben hatte, ohne jedoch in der Abwärtsbewegung gestoppt worden zu sein,
unter ihm wie eine Wippschaukel nachgegeben hatte, ohne jedoch in der Abwärtsbewegung gestoppt worden zu sein, war ihm senkrecht hinterhergefallen und mit der Kante voraus auf seinen Hals gestoßen. Einige Augenblicke stand
war ihm senkrecht hinterhergefallen und mit der Kante voraus auf seinen Hals gestoßen. Einige Augenblicke stand dieses fünf Meter lange Brett kerzengerade in der Luft, bevor es umstürzte und einige Handbreiten hinter Kevins Kopf
dieses fünf Meter lange Brett kerzengerade in der Luft, bevor es umstürzte und einige Handbreiten hinter Kevins Kopf auf das Amiereisenpaket donnerte. Robert stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. »Das wollte ich nicht!«,
auf das Amiereisenpaket donnerte. Robert stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. »Das wollte ich nicht!«, stammelte er vor Schreck. »Das wollte ich nicht! Nein!«
Er erstarrte, wollte wegschauen und konnte dennoch seinen Blick nicht abwenden. Er presste sich eine Hand vor die
stammelte er vor Schreck. »Das wollte ich nicht! Nein!«
Er erstarrte, wollte wegschauen und konnte dennoch seinen Blick nicht abwenden. Er presste sich eine Hand vor die Augen, um nicht länger die Enden der beiden Amiereisenwinkel sehen zu müssen, die wie Stilette durch Kevins Bauch
Augen, um nicht länger die Enden der beiden Amiereisenwinkel sehen zu müssen, die wie Stilette durch Kevins Bauch und Brust gedrungen waren. Ihr Rost konnte unter dem Blutfilm, der sich auf ihnen gebildet hatte, nur mehr vermutet
und Brust gedrungen waren. Ihr Rost konnte unter dem Blutfilm, der sich auf ihnen gebildet hatte, nur mehr vermutet werden. Robert blickte um sich: Nirgends war jemand zu sehen; selbst die Straßen und Wege waren leer. Er wusste nicht,
ob er zuerst zu seinem Handy greifen oder sich um Kevin kümmern sollte. Schließlich zitterte er es aus der Tasche und
werden. Robert blickte um sich: Nirgends war jemand zu sehen; selbst die Straßen und Wege waren leer. Er wusste nicht,
ob er zuerst zu seinem Handy greifen oder sich um Kevin kümmern sollte. Schließlich zitterte er es aus der Tasche und  tippte die 112.
2.
Frieser war mit sich uneins. Sollte er sich endlich dazu aufraffen, an der unerledigten Sache zu arbeiten und sie beenden
oder Feierabend machen? Schon seit eini-ger Zeit fand er kaum noch Gefallen an seiner Arbeit, wenngleich noch
tippte die 112.
2.
Frieser war mit sich uneins. Sollte er sich endlich dazu aufraffen, an der unerledigten Sache zu arbeiten und sie beenden
oder Feierabend machen? Schon seit eini-ger Zeit fand er kaum noch Gefallen an seiner Arbeit, wenngleich noch weniger am Feierabendmachen. Sie hatte sich im Laufe seiner fast 40 Dienstjahre eigentlich nicht verändert. Doch wie
weniger am Feierabendmachen. Sie hatte sich im Laufe seiner fast 40 Dienstjahre eigentlich nicht verändert. Doch wie ein ermittelnder Kripobe-amter seinen Dienst ausführen sollte, damit fremdelte er nach jeder Einweisung in ein neues
ein ermittelnder Kripobe-amter seinen Dienst ausführen sollte, damit fremdelte er nach jeder Einweisung in ein neues Computerprogramm und nach jeder Fortbildung ein wenig mehr. Dennoch hatte er sich keiner einzigen Neuerung
Computerprogramm und nach jeder Fortbildung ein wenig mehr. Dennoch hatte er sich keiner einzigen Neuerung ver-schlossen. Einerseits war er froh, dass er in einigen Wochen in Pension gehen würde, andererseits ängstigte er sich ein
wenig davor, seine tägliche Ordnung einzubüßen. Das Kaffeetrinken in der Frühe und am Nachmittag, das längst zum
ver-schlossen. Einerseits war er froh, dass er in einigen Wochen in Pension gehen würde, andererseits ängstigte er sich ein
wenig davor, seine tägliche Ordnung einzubüßen. Das Kaffeetrinken in der Frühe und am Nachmittag, das längst zum Ritual geworden war, genauso wie das Brotzeitmachen bei der Arbeit am Computer, den Plausch mit Kolleginnen und
Ritual geworden war, genauso wie das Brotzeitmachen bei der Arbeit am Computer, den Plausch mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ihm gegenseitige Sympathie verband. Er hoffte, dass er in keine Sonderkommission mehr berufen
Kollegen, mit denen ihm gegenseitige Sympathie verband. Er hoffte, dass er in keine Sonderkommission mehr berufen werden würde, wo er doch nur ein Rädchen im Getriebe wäre. Alleine hätte er sich selbst an seinem letzten Tag im Amt
noch in den rätselhaftesten Todesfall verbissen. Doch im Team machte ihm die Arbeit bereits seit vielen Jahren keine
werden würde, wo er doch nur ein Rädchen im Getriebe wäre. Alleine hätte er sich selbst an seinem letzten Tag im Amt
noch in den rätselhaftesten Todesfall verbissen. Doch im Team machte ihm die Arbeit bereits seit vielen Jahren keine Freude mehr. Teamarbeit und Dokumentation wurden jedoch mehr denn je vom Ministerium gewünscht und nicht selten
auch angeordnet. Jeder Federstrich, jedes Wort sollte nachvollziehbar sein, im Team sollte das beste Konzept gefunden
und auch vollzogen werden. Meist eine Plattform für manche Kolleginnen und Kollegen, um sich in Szene zu setzen, wie
Frieser fand.
Ihm, dem Einzelgänger, der Katzen liebte und dem Hunde nicht geheuer waren, fiel das schwer; Beförderungen
Freude mehr. Teamarbeit und Dokumentation wurden jedoch mehr denn je vom Ministerium gewünscht und nicht selten
auch angeordnet. Jeder Federstrich, jedes Wort sollte nachvollziehbar sein, im Team sollte das beste Konzept gefunden
und auch vollzogen werden. Meist eine Plattform für manche Kolleginnen und Kollegen, um sich in Szene zu setzen, wie
Frieser fand.
Ihm, dem Einzelgänger, der Katzen liebte und dem Hunde nicht geheuer waren, fiel das schwer; Beförderungen verspäteten sich. Daheim stellte man unangenehme Fragen, auf die er seit Jahren nur noch mit einem Achselzucken
verspäteten sich. Daheim stellte man unangenehme Fragen, auf die er seit Jahren nur noch mit einem Achselzucken reagierte. Wieder wurde ein Kollege mit weniger Dienst- und Lebensjahren sowie gelösten Fällen vor ihm befördert. Der
Leberkäse und der Sekt, die es bei der kleinen Feier gegeben hatte, stießen ihm auf. Ihm graute, nach Hause zu kommen.
Einst war ihm dieser Zustand fremd – gänzlich fremd, nicht zuletzt, weil seine Frau noch nie so unerbittlich wie jüngst
reagierte. Wieder wurde ein Kollege mit weniger Dienst- und Lebensjahren sowie gelösten Fällen vor ihm befördert. Der
Leberkäse und der Sekt, die es bei der kleinen Feier gegeben hatte, stießen ihm auf. Ihm graute, nach Hause zu kommen.
Einst war ihm dieser Zustand fremd – gänzlich fremd, nicht zuletzt, weil seine Frau noch nie so unerbittlich wie jüngst ihm angekündigt hatte: »Früher oder später werde ich dich verlassen!« Längst hegte er keine Hoffnung mehr, sich mit
ihm angekündigt hatte: »Früher oder später werde ich dich verlassen!« Längst hegte er keine Hoffnung mehr, sich mit einem Fall ganz alleine befassen zu können. Dazu gehörte auch, dass er ihn erst in den Computer tippte, wenn er ihn
einem Fall ganz alleine befassen zu können. Dazu gehörte auch, dass er ihn erst in den Computer tippte, wenn er ihn gelöst hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er ohnehin alles im Kopf und in Stichworten in seinem Notizbuch. Diese
gelöst hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er ohnehin alles im Kopf und in Stichworten in seinem Notizbuch. Diese Arbeitsweise quittierte man in seiner Dienststelle nur noch mit Kopfschütteln. Es zählte nicht mehr, dass er alleine am
Arbeitsweise quittierte man in seiner Dienststelle nur noch mit Kopfschütteln. Es zählte nicht mehr, dass er alleine am erfolgreichsten war. Doch er erntete nicht Anerkennung, sondern er fühlte sich gemobbt und zurückgesetzt. Er stritt ja
erfolgreichsten war. Doch er erntete nicht Anerkennung, sondern er fühlte sich gemobbt und zurückgesetzt. Er stritt ja nicht ab, dass er nicht besonders fleißig und höchstens ein wenig überdurchschnittlich intelligent war. Doch er glaubte, er
sei kreativ wie niemand sonst in den K-Gruppen, in der Spurensicherung, in der Gerichtsmedizin und in den
nicht ab, dass er nicht besonders fleißig und höchstens ein wenig überdurchschnittlich intelligent war. Doch er glaubte, er
sei kreativ wie niemand sonst in den K-Gruppen, in der Spurensicherung, in der Gerichtsmedizin und in den zuständigen Staatsanwaltschaften. Davon war er überzeugt. Doch von der neuen Staatsanwältin, die bei ihm zunächst
zuständigen Staatsanwaltschaften. Davon war er überzeugt. Doch von der neuen Staatsanwältin, die bei ihm zunächst einen guten Eindruck hinterlassen hatte, konnte er weder Verständnis noch Rückendeckung für seine Art des Ermittelns
und Sachbearbeitens erwarten, von seinem Vorgesetzten im Amt sowieso nicht. »Kreativität ist in der Kriminalistik nicht
mehr gefragt«, trauerte Frieser alten Zeiten nach und fuhr den Computer herunter. Er hatte ihn vor zwei Stunden
einen guten Eindruck hinterlassen hatte, konnte er weder Verständnis noch Rückendeckung für seine Art des Ermittelns
und Sachbearbeitens erwarten, von seinem Vorgesetzten im Amt sowieso nicht. »Kreativität ist in der Kriminalistik nicht
mehr gefragt«, trauerte Frieser alten Zeiten nach und fuhr den Computer herunter. Er hatte ihn vor zwei Stunden hochgefahren, weil er seine Arbeit der letzten Tage als Rädchen im Getriebe einer Sonderkommission dokumentieren
hochgefahren, weil er seine Arbeit der letzten Tage als Rädchen im Getriebe einer Sonderkommission dokumentieren sollte. Keine Frage, es hätte ihn vor keine technischen und intellektuellen Probleme gestellt, doch nicht einmal einen ein-
zigen Buchstaben hatte er in die Datei zu tippen vermocht. Sie befanden sich noch immer in seinem Kopf und
sollte. Keine Frage, es hätte ihn vor keine technischen und intellektuellen Probleme gestellt, doch nicht einmal einen ein-
zigen Buchstaben hatte er in die Datei zu tippen vermocht. Sie befanden sich noch immer in seinem Kopf und Notizbuch. Eine junge Frau, die seit langem vermisst wurde, sollte endlich gefunden werden. In Nürnberg hatte er nach
den strikten Vorgaben der Ermittlungsspitze Adressen überprüft, Personen befragt, Zugverbindungen verifiziert. Die
Notizbuch. Eine junge Frau, die seit langem vermisst wurde, sollte endlich gefunden werden. In Nürnberg hatte er nach
den strikten Vorgaben der Ermittlungsspitze Adressen überprüft, Personen befragt, Zugverbindungen verifiziert. Die Liste war abgearbeitet, und seine Ergebnisse sollte er morgen während der Lagebesprechung der Sonderkommission
Liste war abgearbeitet, und seine Ergebnisse sollte er morgen während der Lagebesprechung der Sonderkommission  vortragen und in Schriftform zu den Akten geben. Bevor er sich endlich daran machte, sie zu erstellen, wollte er sich
vortragen und in Schriftform zu den Akten geben. Bevor er sich endlich daran machte, sie zu erstellen, wollte er sich noch einen Kaffee holen. Er hoffte, dass Renate, die drei Töchter hatte und im Betrieb ihres Mannes das Büro schmiss,
Christine, die die gute Seele der ganzen Gruppe war, und Anne Kathrin, die vom großen Glück mit ihrem Neuen
noch einen Kaffee holen. Er hoffte, dass Renate, die drei Töchter hatte und im Betrieb ihres Mannes das Büro schmiss,
Christine, die die gute Seele der ganzen Gruppe war, und Anne Kathrin, die vom großen Glück mit ihrem Neuen schwärmte und dennoch bezweifelte, endlich den Richtigen gefunden zu haben, noch drüben seien – wenigstens eine
schwärmte und dennoch bezweifelte, endlich den Richtigen gefunden zu haben, noch drüben seien – wenigstens eine von ihnen. Frieser hatte keine Zweifel, dass ihm jede von ihnen sofort ansehen würde, was ihm in diesem Augenblick auf
dem Herzen lag. Längst hatte er sich ohne den Rest eines Grolls damit abgefunden, dass er in den Augen keiner dieser
von ihnen. Frieser hatte keine Zweifel, dass ihm jede von ihnen sofort ansehen würde, was ihm in diesem Augenblick auf
dem Herzen lag. Längst hatte er sich ohne den Rest eines Grolls damit abgefunden, dass er in den Augen keiner dieser Schönheiten als Mann ihr Typ war. Mit den Jahren hatte er auch akzeptiert, dass er überhaupt nicht das war, was man
Schönheiten als Mann ihr Typ war. Mit den Jahren hatte er auch akzeptiert, dass er überhaupt nicht das war, was man unter einem Frauentypen verstand. Vielleicht war er ein Frauenversteher, wenngleich nicht zu Hause. Wie auch immer, der
Geschmack und die Vorlieben der Frauen waren ihm ein Rätsel geblieben. Seit Jahr und Tag war er schlank und hatte
unter einem Frauentypen verstand. Vielleicht war er ein Frauenversteher, wenngleich nicht zu Hause. Wie auch immer, der
Geschmack und die Vorlieben der Frauen waren ihm ein Rätsel geblieben. Seit Jahr und Tag war er schlank und hatte selbst als Fastpensionist noch ein fast jungenhaftes Gesicht, einen Fastadoniskörper und fast noch keine grauen Haare am
Kopf. Doch deswegen glaubte er bei den Frauen nicht höher im Kurs zu stehen wie als 20-Jähriger. Vielleicht lag es auch
daran, dass er sich nicht besonders schick kleiden wollte, kein Aftershave benutzte, sich nur mit Kernseife wusch, nicht
jeden Tag duschte, keinen Dreitagebart trug, dieselben Geschichten und Witze immer wieder erzählte, Pointen vergaß…
Die drei Damen waren schon gegangen und die Kaffeemaschine war ausgesteckt. Unverrichteter Dinge kehrte Frieser in
sein Büro zurück. Sein Mund war trocken, sein Magen flau. In sauren Bratwürsten, neubackenem Schwarzbrot und in ein,
zwei, drei Pilsbieren wusste er dafür die einzig wirksamen Gegenmittel. Doch die Aussicht auf diese Medizin, diese
selbst als Fastpensionist noch ein fast jungenhaftes Gesicht, einen Fastadoniskörper und fast noch keine grauen Haare am
Kopf. Doch deswegen glaubte er bei den Frauen nicht höher im Kurs zu stehen wie als 20-Jähriger. Vielleicht lag es auch
daran, dass er sich nicht besonders schick kleiden wollte, kein Aftershave benutzte, sich nur mit Kernseife wusch, nicht
jeden Tag duschte, keinen Dreitagebart trug, dieselben Geschichten und Witze immer wieder erzählte, Pointen vergaß…
Die drei Damen waren schon gegangen und die Kaffeemaschine war ausgesteckt. Unverrichteter Dinge kehrte Frieser in
sein Büro zurück. Sein Mund war trocken, sein Magen flau. In sauren Bratwürsten, neubackenem Schwarzbrot und in ein,
zwei, drei Pilsbieren wusste er dafür die einzig wirksamen Gegenmittel. Doch die Aussicht auf diese Medizin, diese Genüsse waren ihm in diesem Augenblick so fern wie die Gunst einer schönen Frau. Dabei hätte er sich in diesen
Genüsse waren ihm in diesem Augenblick so fern wie die Gunst einer schönen Frau. Dabei hätte er sich in diesen Sekunden sogar mit einem Lächeln begnügt. Frieser war sich sicher, dass es ihm dann leichter fallen würde, den Computer
erneut hochzufahren, um endlich seine Recherchen niederzuschreiben. Er erinnerte sich an seine Kinderzeit. Als kleiner
Bub ertappte er sich oft in der Haut eines anderen. Wehmut überkam ihn. Stunden- wenn nicht tagelang weidete er sich
an der Vorstellung, Winnetou, Pelé oder Siegfried der Drachentöter zu sein.
Das Telefon klingelte. Sollte er abheben oder den Computer einschalten? Er überlegte, obschon er wusste, dass er
Sekunden sogar mit einem Lächeln begnügt. Frieser war sich sicher, dass es ihm dann leichter fallen würde, den Computer
erneut hochzufahren, um endlich seine Recherchen niederzuschreiben. Er erinnerte sich an seine Kinderzeit. Als kleiner
Bub ertappte er sich oft in der Haut eines anderen. Wehmut überkam ihn. Stunden- wenn nicht tagelang weidete er sich
an der Vorstellung, Winnetou, Pelé oder Siegfried der Drachentöter zu sein.
Das Telefon klingelte. Sollte er abheben oder den Computer einschalten? Er überlegte, obschon er wusste, dass er früher oder später abheben würde. Den Hörer am Ohr sagte er entgegen seiner Gewohnheit »Ja!«, obwohl er seinen
früher oder später abheben würde. Den Hörer am Ohr sagte er entgegen seiner Gewohnheit »Ja!«, obwohl er seinen Namen nennen wollte. Die Staatsanwältin befand sich am anderen Ende der Leitung. Außergewöhnlich. Bei bislang jeder
Begegnung mit ihr hatte ihn das Gefühl beschlichen, sie würde auf ihn herabschauen. Nicht zuletzt, so glaubte er, weil
Namen nennen wollte. Die Staatsanwältin befand sich am anderen Ende der Leitung. Außergewöhnlich. Bei bislang jeder
Begegnung mit ihr hatte ihn das Gefühl beschlichen, sie würde auf ihn herabschauen. Nicht zuletzt, so glaubte er, weil sie wegen des Größenunterschieds, den selbst ihre hohen Hacken nicht ganz zu egalisieren vermochten, zu ihm, dem
sie wegen des Größenunterschieds, den selbst ihre hohen Hacken nicht ganz zu egalisieren vermochten, zu ihm, dem  Fasteinsachtzigathleten aufschauen musste, und er sagte sich: »Die würde ich nicht einmal dann…, wenn nach einem
Fasteinsachtzigathleten aufschauen musste, und er sagte sich: »Die würde ich nicht einmal dann…, wenn nach einem gigantischen Meteoriteneinschlag nur sie und ich übrigblieben.«
»Wer ist am Apparat?«
»Frieser!«
»Ist niemand sonst von den Ermittlern Ihrer K-Gruppe da?«
»Nein, nur ich! Ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen zu dieser späten Stunde mit mir vorliebnehmen!«, sagte Frieser.
»Was tun Sie so lange im Amt?«
»Kaffee trinken und saure Bratwürste essen!«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
»Das würde ich mir nie erlauben, Frau Staatsanwältin!«, gab Frieser todernst von sich und hörte, wie die Frau schluckte
und ausatmete. »Irgendwie ist die Polizeiinspektion Neumarkt direkt bei mir gelandet«, hob sie nach einer Atempause an.
»Diese Verirrungen der Amtswege, o Gott. Wie auch immer, letztendlich zuständig wäre ich ohnehin«, verhehlte sie ihre
Wichtigkeit nicht und kicherte. Die Frau hatte eine hohe Stimme. Frieser empfand sie süßlich – unangenehm.
»Was Sie nicht sagen, Frau Staatsanwältin«, meinte er. Dabei war sein Tonfall von verhaltenem Spott durchweht.
»Hören Sie, Herr Frieser, die Polizeiinspektion Neumarkt wurde zu einem Todesfall gerufen, bei dem auch die Kripo
gigantischen Meteoriteneinschlag nur sie und ich übrigblieben.«
»Wer ist am Apparat?«
»Frieser!«
»Ist niemand sonst von den Ermittlern Ihrer K-Gruppe da?«
»Nein, nur ich! Ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen zu dieser späten Stunde mit mir vorliebnehmen!«, sagte Frieser.
»Was tun Sie so lange im Amt?«
»Kaffee trinken und saure Bratwürste essen!«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
»Das würde ich mir nie erlauben, Frau Staatsanwältin!«, gab Frieser todernst von sich und hörte, wie die Frau schluckte
und ausatmete. »Irgendwie ist die Polizeiinspektion Neumarkt direkt bei mir gelandet«, hob sie nach einer Atempause an.
»Diese Verirrungen der Amtswege, o Gott. Wie auch immer, letztendlich zuständig wäre ich ohnehin«, verhehlte sie ihre
Wichtigkeit nicht und kicherte. Die Frau hatte eine hohe Stimme. Frieser empfand sie süßlich – unangenehm.
»Was Sie nicht sagen, Frau Staatsanwältin«, meinte er. Dabei war sein Tonfall von verhaltenem Spott durchweht.
»Hören Sie, Herr Frieser, die Polizeiinspektion Neumarkt wurde zu einem Todesfall gerufen, bei dem auch die Kripo gefragt ist. In dem Ort Oberstob fand ein Landwirt seine hochbetagte Mutter tot in der Scheune. Vielleicht ein
gefragt ist. In dem Ort Oberstob fand ein Landwirt seine hochbetagte Mutter tot in der Scheune. Vielleicht ein landwirtschaftlicher Unfall. Der Notarzt stellte eine unnatürliche Todesursache fest. Sehen Sie sich mit der
landwirtschaftlicher Unfall. Der Notarzt stellte eine unnatürliche Todesursache fest. Sehen Sie sich mit der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin dort einmal um. Schön wäre, wenn die Kripo doch mit zwei Ermittlern vor
Spurensicherung und der Gerichtsmedizin dort einmal um. Schön wäre, wenn die Kripo doch mit zwei Ermittlern vor Ort aufkreuzen würde«, sagte die Staatsanwältin.
»Ich weiß, was Sie meinen, Frau Staatsanwältin!«, erwiderte Frieser. Er musste schlucken und dachte: »Du blöde Kuh!«
»Dann sind wir uns ja einig. Doch ich denke, mit diesem Fall würden Sie zur Not auch alleine zurechtkommen«, räumte
die etwa 40-Jährige am anderen Ende der Leitung ein. »Alleine zu ermitteln, davor fürchte ich mich nicht – davor habe
Ort aufkreuzen würde«, sagte die Staatsanwältin.
»Ich weiß, was Sie meinen, Frau Staatsanwältin!«, erwiderte Frieser. Er musste schlucken und dachte: »Du blöde Kuh!«
»Dann sind wir uns ja einig. Doch ich denke, mit diesem Fall würden Sie zur Not auch alleine zurechtkommen«, räumte
die etwa 40-Jährige am anderen Ende der Leitung ein. »Alleine zu ermitteln, davor fürchte ich mich nicht – davor habe ich mich noch nie gefürchtet, im Gegenteil …«, betonte Frieser.
»Übrigens, bereits in dieser Woche – am Montag-vormittag – stürzte in Freystadt ein junger Zimmerer vom Dach, und
der Ort Oberstob liegt meines Wissens zwischen Freystadt und Neumarkt«, berichtete die Staatsanwältin, ohne auf
ich mich noch nie gefürchtet, im Gegenteil …«, betonte Frieser.
»Übrigens, bereits in dieser Woche – am Montag-vormittag – stürzte in Freystadt ein junger Zimmerer vom Dach, und
der Ort Oberstob liegt meines Wissens zwischen Freystadt und Neumarkt«, berichtete die Staatsanwältin, ohne auf Friesers Bemerkung auch nur mit einem Wort eingegangen zu sein, und fragte: »Drang das im Amt nicht bis zu ihnen
Friesers Bemerkung auch nur mit einem Wort eingegangen zu sein, und fragte: »Drang das im Amt nicht bis zu ihnen durch?«
»Nein!«, antwortete Frieser und meinte: »Möglicherweise waren die Kollegen Spontl und Neum vor Ort.«
durch?«
»Nein!«, antwortete Frieser und meinte: »Möglicherweise waren die Kollegen Spontl und Neum vor Ort.« Währenddessen wurde die Tür geöffnet. Frieser blickte zur Seite und sah Bachmann. »Frau Staatsanwältin, Sie können
Währenddessen wurde die Tür geöffnet. Frieser blickte zur Seite und sah Bachmann. »Frau Staatsanwältin, Sie können beruhigt schlafen, der Kollege Bachmann steht in der Tür.«
»Bitte, geben Sie ihn mir!«
»Wie Sie wünschen, Frau Staatsanwältin!«
3.
Bachmann setzte sich ans Steuer. Darüber war Frieser froh. Nach der Erledigung ihrer Ermittlungen in Oberstob wollte
er ihm vorschlagen, auf dem Weg zurück nach Regensburg beim Baptist in Sülzbürg einzukehren. Denn dessen Frau
beruhigt schlafen, der Kollege Bachmann steht in der Tür.«
»Bitte, geben Sie ihn mir!«
»Wie Sie wünschen, Frau Staatsanwältin!«
3.
Bachmann setzte sich ans Steuer. Darüber war Frieser froh. Nach der Erledigung ihrer Ermittlungen in Oberstob wollte
er ihm vorschlagen, auf dem Weg zurück nach Regensburg beim Baptist in Sülzbürg einzukehren. Denn dessen Frau hatte jeden Donnerstag saure Bratwürste auf dem Herd. Und Frieser konnte sich dazu ein, zwei, drei oder vier Pilschen
genehmigen, während Bachmann mit Alkoholfreiem vorlieb nehmen musste.
Bei seinen Radtouren entlang des Main-Donau-Kanals und des Ludwig-Donau-Main-Kanals hatte er vor einigen Jahren
zufällig dieses alte Wirtshaus entdeckt. Es sollte im Laufe der Zeit auch halten, was seine Fachwerkfassade, sein
hatte jeden Donnerstag saure Bratwürste auf dem Herd. Und Frieser konnte sich dazu ein, zwei, drei oder vier Pilschen
genehmigen, während Bachmann mit Alkoholfreiem vorlieb nehmen musste.
Bei seinen Radtouren entlang des Main-Donau-Kanals und des Ludwig-Donau-Main-Kanals hatte er vor einigen Jahren
zufällig dieses alte Wirtshaus entdeckt. Es sollte im Laufe der Zeit auch halten, was seine Fachwerkfassade, sein schattiger Biergarten, seine holzvertäfelte Wirtsstube und sein ergrauter und doch junggebliebener Wirt, der die Musik
schattiger Biergarten, seine holzvertäfelte Wirtsstube und sein ergrauter und doch junggebliebener Wirt, der die Musik und die Literatur liebte, Frieser versprochen hatten.
Es war auf Mittag zugegangen. Im teilweise von hohen Linden und Kastanien beschatteten Biergarten saßen
und die Literatur liebte, Frieser versprochen hatten.
Es war auf Mittag zugegangen. Im teilweise von hohen Linden und Kastanien beschatteten Biergarten saßen Einheimische beim Frühschoppen. Sie diskutierten über Fußball, schimpften über die Geldgier der Oberen, grantelten
Einheimische beim Frühschoppen. Sie diskutierten über Fußball, schimpften über die Geldgier der Oberen, grantelten  über die Dürftigkeit des Daseins und belustigten sich über die Missgeschicke und die Dummheiten von lebenden und
über die Dürftigkeit des Daseins und belustigten sich über die Missgeschicke und die Dummheiten von lebenden und toten Zeitgenossen.
Frieser hatte sich an den Nebentisch zu einem anderen Radfahrer gesetzt und sich ein großes Wasser bestellt. Dieser
toten Zeitgenossen.
Frieser hatte sich an den Nebentisch zu einem anderen Radfahrer gesetzt und sich ein großes Wasser bestellt. Dieser bedauerte, dort leider mit der prallen Sonne vorliebnehmen zu müssen. Bei ihnen am Tisch sei Platz und Schatten mehr
als genug, lud sie ein etwas untersetzter Mann von Mitte 60, dessen Haupthaar etwas zurückgewichen war, mit einem
bedauerte, dort leider mit der prallen Sonne vorliebnehmen zu müssen. Bei ihnen am Tisch sei Platz und Schatten mehr
als genug, lud sie ein etwas untersetzter Mann von Mitte 60, dessen Haupthaar etwas zurückgewichen war, mit einem gewinnenden Lächeln ein. Sein etwas älterer Tischnachbar zu seiner Linken nickte. Trotzdem senkte er seinen Kopf,
gewinnenden Lächeln ein. Sein etwas älterer Tischnachbar zu seiner Linken nickte. Trotzdem senkte er seinen Kopf, klappte seine Augenlider hoch und beäugte misstrauisch die beiden Neuen am Tisch; dabei glitt seine Rechte über sein
klappte seine Augenlider hoch und beäugte misstrauisch die beiden Neuen am Tisch; dabei glitt seine Rechte über sein silbergraues Haupt. Als der Wirt mit Friesers großem Was-ser an den Tisch zurückkehrte, brachte er diesem schlanken
silbergraues Haupt. Als der Wirt mit Friesers großem Was-ser an den Tisch zurückkehrte, brachte er diesem schlanken Mann ein irdenes Schnupftabaksgefäß. Es hatte die Form einer kleinen Vase oder eines Bocksbeutels und war mit
Mann ein irdenes Schnupftabaksgefäß. Es hatte die Form einer kleinen Vase oder eines Bocksbeutels und war mit Edelweiß bemalt. Damit klopfte er sich eine Prise auf seinen linken Handrücken und schnupfte. »Wollen Sie auch eine?«,
hieß er an diesem heißen Sommertag Frieser und den anderen willkommen. Beide bedankten sich und lächelten. »Ihr
Edelweiß bemalt. Damit klopfte er sich eine Prise auf seinen linken Handrücken und schnupfte. »Wollen Sie auch eine?«,
hieß er an diesem heißen Sommertag Frieser und den anderen willkommen. Beide bedankten sich und lächelten. »Ihr wisst nicht, was gut ist!«
Ohne ein Wort zu sagen, amüsierte sich sein schmächtiger Altersgenosse, der links neben ihm beim Bier saß, über die
Ablehnung des Angebots. Sein lebhaftes Lächeln war unverkennbar ein Ausdruck dessen. Doch plötzlich, als wollte er
wisst nicht, was gut ist!«
Ohne ein Wort zu sagen, amüsierte sich sein schmächtiger Altersgenosse, der links neben ihm beim Bier saß, über die
Ablehnung des Angebots. Sein lebhaftes Lächeln war unverkennbar ein Ausdruck dessen. Doch plötzlich, als wollte er sich für seine Schadenfreude entschuldigen, streckte er den Handrücken seiner Linken zu seinem Nebenmann hinüber.
sich für seine Schadenfreude entschuldigen, streckte er den Handrücken seiner Linken zu seinem Nebenmann hinüber. Er nickte und lächelte, als ihm eine Prise aufgeladen wurde.
Frieser hoffte, diese Männer, die er danach näher kennen- und schätzen gelernt hatte, an diesem Abend zu treffen.
Er nickte und lächelte, als ihm eine Prise aufgeladen wurde.
Frieser hoffte, diese Männer, die er danach näher kennen- und schätzen gelernt hatte, an diesem Abend zu treffen. »Schorsch, was hältst du davon, auf der Rückfahrt nach Regensburg am Sulzbürg einzukehren?«, schlug Frieser vor,
»Schorsch, was hältst du davon, auf der Rückfahrt nach Regensburg am Sulzbürg einzukehren?«, schlug Frieser vor, »Dort gibt es jeden Donnerstagabend saure Bratwürste und eine gute Unterhaltung.« Bachmann wiegte mit dem Kopf.
»Dort gibt es jeden Donnerstagabend saure Bratwürste und eine gute Unterhaltung.« Bachmann wiegte mit dem Kopf. »Na gut, dann eben nicht«, machte Frieser einen Rückzieher und deutete nach rechts. Seit einigen Minuten befanden sie
sich auf der Straße von Mühlhausen nach Freystadt und ließen nun Sulzbürg rechts liegen. In etwa 500 Meter
»Na gut, dann eben nicht«, machte Frieser einen Rückzieher und deutete nach rechts. Seit einigen Minuten befanden sie
sich auf der Straße von Mühlhausen nach Freystadt und ließen nun Sulzbürg rechts liegen. In etwa 500 Meter Entfernung erstreckte sich dieser Ort an einem Berg, flankiert von zwei vorgelagerten Hügeln. Ganz oben ragten zwei
Entfernung erstreckte sich dieser Ort an einem Berg, flankiert von zwei vorgelagerten Hügeln. Ganz oben ragten zwei Kirchtürme aus dem dichten Schwarzgrün des Walds, der wie eine Haube den Berg bedeckte. Weiter unten waren einige
helle Häuser mit roten Dächern erkenn-bar. »Dort oben ist auch dieses Wirtshaus«, merkte Frieser an.
»Ich bin gespannt, was uns in Oberstob erwartet«, meinte Bachmann.
»Ein Bauer fand seine Mutter tot in der Scheune«, so Frieser.
»Sicherlich ein Unfall«, meinte Bachmann. Nachdem sie durch einige Dörfer gefahren waren, erstrahlte im versinkenden
Rot der untergehenden Sonne plötzlich eine grünspangrüne Barockkuppel. »Die Wallfahrtskirche von Freystadt«, erklärte
Frieser. »Ich kenne sie von meinen Radtouren.«
Kirchtürme aus dem dichten Schwarzgrün des Walds, der wie eine Haube den Berg bedeckte. Weiter unten waren einige
helle Häuser mit roten Dächern erkenn-bar. »Dort oben ist auch dieses Wirtshaus«, merkte Frieser an.
»Ich bin gespannt, was uns in Oberstob erwartet«, meinte Bachmann.
»Ein Bauer fand seine Mutter tot in der Scheune«, so Frieser.
»Sicherlich ein Unfall«, meinte Bachmann. Nachdem sie durch einige Dörfer gefahren waren, erstrahlte im versinkenden
Rot der untergehenden Sonne plötzlich eine grünspangrüne Barockkuppel. »Die Wallfahrtskirche von Freystadt«, erklärte
Frieser. »Ich kenne sie von meinen Radtouren.«