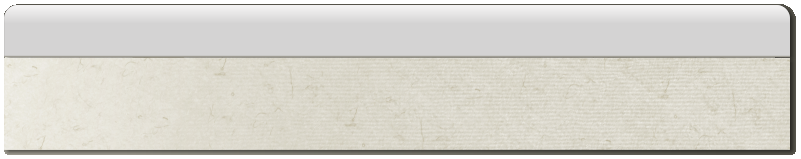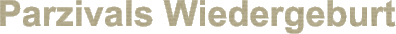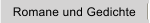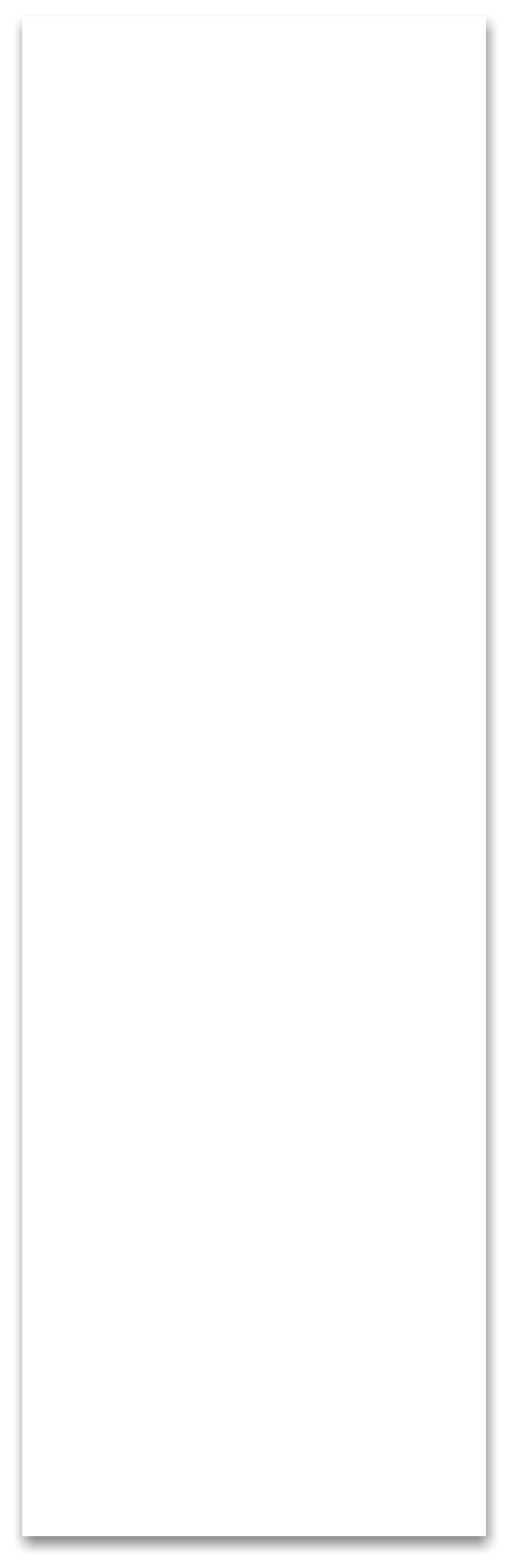


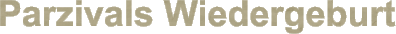
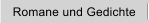
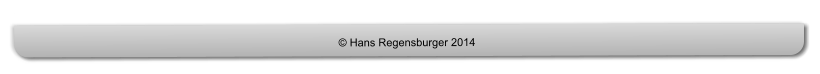
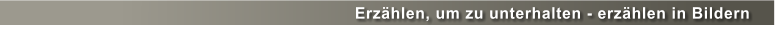 Parzivals Wiedergeburt - neuer Titel: Stromausfall - Entwicklungsroman
Roman 2012; 292 Seiten - Textumfang ca. 85.000 Wörter
Zeit und Orte: 1977-1996, New York, Bonn, Köln, Erlangen, Nürnberg, Hohenfels, Parsberg, Abenberg, Wolframs-Eschenbach
Gerhard Breitbarth Verlag, Regensburg; ISBN 978-3-9435-6419-8; Buch - 14,95 €
ISBN 978-3-9435-6418-1: ePub - eBook-Reader - 8,95 €
Wegen der Geschäftsauflösung des Gerhard Breitbarth Verlags im September 2013 ist der Roman “Parzivals Wiedergeburt” als
Verlagsausgabe vergriffen. Er liegt nun als Eigendruck des Autors in Buchform vor; 8,00 €
Überarbeitung des Textes sowie Neugestaltung des Buchäußeren: Oktober 2016
Der Roman kann entweder beim Autor vor Ort bezogen oder bei ihm bestellt werden - Versand vom Autor mit
Portoaufschlag.
Zum Inhalt
Parzival, geboren in New York, teilt dort mit seinem Vater und dem kauzigen Bird eine bescheidene Wohnung. Parzival ist in
Florence, seine ehemalige Lehrerin, verliebt, die aber seine Liebe nicht erwidert. Dennoch verbindet beide eine enge Freundschaft,
wenn nicht gar eine Seelenverwandtschaft. In jedem Fall haben sie eine einzigartige intellektuelle Beziehung. Es ist eine Beziehung
zwischen Erwachsenen. Parzival holte bei Florence seinen Schulabschluss nach, den er als Kind und Jugendlicher versäumt hatte.
Sie lernte von ihm, der mit Deutsch und Amerikanisch aufwuchs, die deutsche Sprache.
Parzivals außergewöhnlichem Unternehmen, das seinen gesellschaftlichen Aufstieg einläuten sollte, bleibt der Erfolg versagt. Dieser
wäre gleichbedeutend mit Florence´ ganzer Liebe gewesen, glaubt er. Als er mit leeren Händen vor ihr steht, fällt in New York der
Strom aus. Beide wollen dem Verhängnisvollen dieser Nacht entrinnen. Parzival fürchtet eine Strafverfolgung, flieht. Er tritt in die
Army ein und macht dort Karriere.
Ohne von einander zu wissen, verschlägt es sie nach Deutschland. Sie gründet dort eine Familie, genauso er. Ihre ahnungslosen
Kinder besuchen dieselbe Schule und verlieben sich ineinander. Auf einem Fest spürt Florence, in wen sich ihre Tochter verliebte.
Sie fordert das Ende dieser Beziehung, nennt aber zunächst nicht den Grund. Von da an schlittert ihr Leben in die Krise.
In Wolframs-Eschenbach sucht Parzival nach den Spuren seiner deutschen Mutter. Der Zufall führt ihn in Wolframs Museum, wo er
auf Florence trifft, die sich auf einer Klassenfahrt befindet. Ehe sie dort einander gewahr werden, rezitiert sie vor ihren Schülern
Wolfram von Eschenbachs Parzival versäumte Frage an Amfortas: "hêrre, wie stêt iwer nôt?" Florence und Parzival fehlen die
Worte, obwohl sie eine Aussprache herbeisehnen
Der Leser Dr. Joachim Balsliemke schreibt über den Parzival:
Der Titel des Romans lässt wegen der Bezugnahme auf die hochmittelalterliche Parzival-Dichtung an eine überwiegend
intellektuelle und schwer verdauliche Kost denken. Stattdessen handelt es sich um einen sehr spannenden und emotional
bewegenden Roman. Das Schicksal des Protagonisten bewegt sich, ausgehend von den Schlüsselereignissen während des
Blackouts in New York im Jahr 1977, bis in das Deutschland der Gegenwart. Die Handlung ist eingewoben in ein menschliches
Dauerthema: Schuld und Vergebung von Schuld, sowohl in einem personalen als auch in einem gesellschaftlichen Kontext.
Am Ende des Romans steht eigentlich eher ein Happyend als ein Unhappyend. Andererseits stimmen der Schluss und die
Auflösung der personellen Verwicklungen auch nachdenklich. "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern" heißt es. Dass das Erkennen und Vergeben von Schuld nicht nur ein christlich moralischer Imperativ ist, sondern für
die beteiligten Personen auch befreiend sein kann, wird in der Zuspitzung der Geschehnisse deutlich. Schuldig werden, sich selbst
suchen und eine Entwicklung durchleben von Selbstbezogenheit zu stärkerer Empathiefähigkeit, in diesem Sinne handelt es sich
bei dem Protagonisten um einen Parzival und um die Wiedergeburt eines zeitlosen Lebensmotivs. Es ist ein gelungener Roman,
der neben geistiger Anregung auch Lesevergnügen gewährleistet.
Der Leser Ralf schreibt über den Parzival:
Als ich durch meine Freundin in eine Vorlesung zu diesem Buch kam, war ich zunächst skeptisch, da ich zunächst nur von den
komplexen geschichtlichen Zusammenhängen erfuhr, welche mich eher abschreckten und mich befürchten ließen, hierbei handelt
es sich um einen sehr trockenen Roman. Jedoch wurde ich in allen Belangen eines Besseren belehrt, da die Lesung sehr
kurzweilig war und die anschließende Lektüre ebenso, was dadurch bewiesen wurde, dass ich das Buch innerhalb von drei Tagen
las. Regensburger hat es mit diesem Buch geschafft, mich sehr gut zu unterhalten und mir auch vieles beigebracht. Ob dies nun
die liebevoll beschriebene Bonbonherstellung ist oder eben eine Reihe von geschichtlich durchaus interessanten
Zusammenhängen. Einzig zu bemängeln wäre die vorweg verfasste Inhaltsangabe, welche ein wenig das Unvorhersehende
vorhersehen lässt. Es gibt jedoch trotz alledem ein sehr spannendes wie bedrückendes Ende. Alles in allem also ein sehr
lesenswertes Buch, das Freude auf mehr macht.
Der Leser Dr. Bernd Adam schreibt über den Parzival:
Parzivals Wiedergeburt - neuer Titel: Stromausfall - Entwicklungsroman
Roman 2012; 292 Seiten - Textumfang ca. 85.000 Wörter
Zeit und Orte: 1977-1996, New York, Bonn, Köln, Erlangen, Nürnberg, Hohenfels, Parsberg, Abenberg, Wolframs-Eschenbach
Gerhard Breitbarth Verlag, Regensburg; ISBN 978-3-9435-6419-8; Buch - 14,95 €
ISBN 978-3-9435-6418-1: ePub - eBook-Reader - 8,95 €
Wegen der Geschäftsauflösung des Gerhard Breitbarth Verlags im September 2013 ist der Roman “Parzivals Wiedergeburt” als
Verlagsausgabe vergriffen. Er liegt nun als Eigendruck des Autors in Buchform vor; 8,00 €
Überarbeitung des Textes sowie Neugestaltung des Buchäußeren: Oktober 2016
Der Roman kann entweder beim Autor vor Ort bezogen oder bei ihm bestellt werden - Versand vom Autor mit
Portoaufschlag.
Zum Inhalt
Parzival, geboren in New York, teilt dort mit seinem Vater und dem kauzigen Bird eine bescheidene Wohnung. Parzival ist in
Florence, seine ehemalige Lehrerin, verliebt, die aber seine Liebe nicht erwidert. Dennoch verbindet beide eine enge Freundschaft,
wenn nicht gar eine Seelenverwandtschaft. In jedem Fall haben sie eine einzigartige intellektuelle Beziehung. Es ist eine Beziehung
zwischen Erwachsenen. Parzival holte bei Florence seinen Schulabschluss nach, den er als Kind und Jugendlicher versäumt hatte.
Sie lernte von ihm, der mit Deutsch und Amerikanisch aufwuchs, die deutsche Sprache.
Parzivals außergewöhnlichem Unternehmen, das seinen gesellschaftlichen Aufstieg einläuten sollte, bleibt der Erfolg versagt. Dieser
wäre gleichbedeutend mit Florence´ ganzer Liebe gewesen, glaubt er. Als er mit leeren Händen vor ihr steht, fällt in New York der
Strom aus. Beide wollen dem Verhängnisvollen dieser Nacht entrinnen. Parzival fürchtet eine Strafverfolgung, flieht. Er tritt in die
Army ein und macht dort Karriere.
Ohne von einander zu wissen, verschlägt es sie nach Deutschland. Sie gründet dort eine Familie, genauso er. Ihre ahnungslosen
Kinder besuchen dieselbe Schule und verlieben sich ineinander. Auf einem Fest spürt Florence, in wen sich ihre Tochter verliebte.
Sie fordert das Ende dieser Beziehung, nennt aber zunächst nicht den Grund. Von da an schlittert ihr Leben in die Krise.
In Wolframs-Eschenbach sucht Parzival nach den Spuren seiner deutschen Mutter. Der Zufall führt ihn in Wolframs Museum, wo er
auf Florence trifft, die sich auf einer Klassenfahrt befindet. Ehe sie dort einander gewahr werden, rezitiert sie vor ihren Schülern
Wolfram von Eschenbachs Parzival versäumte Frage an Amfortas: "hêrre, wie stêt iwer nôt?" Florence und Parzival fehlen die
Worte, obwohl sie eine Aussprache herbeisehnen
Der Leser Dr. Joachim Balsliemke schreibt über den Parzival:
Der Titel des Romans lässt wegen der Bezugnahme auf die hochmittelalterliche Parzival-Dichtung an eine überwiegend
intellektuelle und schwer verdauliche Kost denken. Stattdessen handelt es sich um einen sehr spannenden und emotional
bewegenden Roman. Das Schicksal des Protagonisten bewegt sich, ausgehend von den Schlüsselereignissen während des
Blackouts in New York im Jahr 1977, bis in das Deutschland der Gegenwart. Die Handlung ist eingewoben in ein menschliches
Dauerthema: Schuld und Vergebung von Schuld, sowohl in einem personalen als auch in einem gesellschaftlichen Kontext.
Am Ende des Romans steht eigentlich eher ein Happyend als ein Unhappyend. Andererseits stimmen der Schluss und die
Auflösung der personellen Verwicklungen auch nachdenklich. "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern" heißt es. Dass das Erkennen und Vergeben von Schuld nicht nur ein christlich moralischer Imperativ ist, sondern für
die beteiligten Personen auch befreiend sein kann, wird in der Zuspitzung der Geschehnisse deutlich. Schuldig werden, sich selbst
suchen und eine Entwicklung durchleben von Selbstbezogenheit zu stärkerer Empathiefähigkeit, in diesem Sinne handelt es sich
bei dem Protagonisten um einen Parzival und um die Wiedergeburt eines zeitlosen Lebensmotivs. Es ist ein gelungener Roman,
der neben geistiger Anregung auch Lesevergnügen gewährleistet.
Der Leser Ralf schreibt über den Parzival:
Als ich durch meine Freundin in eine Vorlesung zu diesem Buch kam, war ich zunächst skeptisch, da ich zunächst nur von den
komplexen geschichtlichen Zusammenhängen erfuhr, welche mich eher abschreckten und mich befürchten ließen, hierbei handelt
es sich um einen sehr trockenen Roman. Jedoch wurde ich in allen Belangen eines Besseren belehrt, da die Lesung sehr
kurzweilig war und die anschließende Lektüre ebenso, was dadurch bewiesen wurde, dass ich das Buch innerhalb von drei Tagen
las. Regensburger hat es mit diesem Buch geschafft, mich sehr gut zu unterhalten und mir auch vieles beigebracht. Ob dies nun
die liebevoll beschriebene Bonbonherstellung ist oder eben eine Reihe von geschichtlich durchaus interessanten
Zusammenhängen. Einzig zu bemängeln wäre die vorweg verfasste Inhaltsangabe, welche ein wenig das Unvorhersehende
vorhersehen lässt. Es gibt jedoch trotz alledem ein sehr spannendes wie bedrückendes Ende. Alles in allem also ein sehr
lesenswertes Buch, das Freude auf mehr macht.
Der Leser Dr. Bernd Adam schreibt über den Parzival: Ich staune über den weiten Bogen der Handlung, den der Autor in diesem großen Roman schlägt. Sie beginnt 1977 in
Ich staune über den weiten Bogen der Handlung, den der Autor in diesem großen Roman schlägt. Sie beginnt 1977 in  New York-Harlem, führt im Laufe der Zeit unter anderem nach Nürnberg und endet zwei Jahrzehnte später in
New York-Harlem, führt im Laufe der Zeit unter anderem nach Nürnberg und endet zwei Jahrzehnte später in  Wolframs-Eschenbach und Abenberg.
Wolframs-Eschenbach und Abenberg.  Vor allem in den letzten Kapiteln steckt unaufdringlich und anregend zugleich viel Lokalkolorit, das zum eigenen Nachspüren in der
Realität anregt. Nicht alles, was ich las, vermochte bei mir Türen zu öffnen – dazu sind mir manche Gedanken inzwischen zu fremd
geworden, etwa solche, die im hitzigen Gespräch von Jugendlichen geäußert werden oder in der von Alkohol befeuerten
Diskussion Erwachsener, die sich über politische Geschehen in Vergangenheit und Gegenwart und dessen Bewertung streiten. An
solchen Stellen habe ich etwas schneller, auch mal diagonal gelesen. Aber zu vielem, auch zu vielen psychologischen
Überlegungen, die selten theoretisch und meist lebensnah formuliert sind, konnte ich eine Tür finden, und ich denke, Hans
Regensburger legte mit „Parzivals Wiedergeburt“ einen wirklich bemerkenswerten Roman vor. Immer wieder ließ ich mich vom
streckenweise rasanten Handlungsverlauf und von der Liebe des Autors zum psychologischen Detail mitnehmen. Dass mir dieser
Roman zugänglich wurde, dafür bin ich dankbar!
Leseprobe
Aus Kapitel 1, Teil I
Im Dampf- und Glutsommer 1977 mögen die New Yorker in ihrer Erfahrung Trost gefunden haben, dass selbst die Tage der
gnadenlosesten Schwüle und Hitze gezählt sind. Trotzdem, so schien es, trugen sie in diesen argen Brenn- und Schwitzwochen
ihre Bilder und Andenken von einer kühleren Atmosphäre und von einem belebenden Regen sang- und klanglos zu Grabe.
Man war zufrieden, wenn die Hitze, die scheinbar unerschütterlich auf den Straßen und Plätzen lastete, nicht jede atlantische
Vor allem in den letzten Kapiteln steckt unaufdringlich und anregend zugleich viel Lokalkolorit, das zum eigenen Nachspüren in der
Realität anregt. Nicht alles, was ich las, vermochte bei mir Türen zu öffnen – dazu sind mir manche Gedanken inzwischen zu fremd
geworden, etwa solche, die im hitzigen Gespräch von Jugendlichen geäußert werden oder in der von Alkohol befeuerten
Diskussion Erwachsener, die sich über politische Geschehen in Vergangenheit und Gegenwart und dessen Bewertung streiten. An
solchen Stellen habe ich etwas schneller, auch mal diagonal gelesen. Aber zu vielem, auch zu vielen psychologischen
Überlegungen, die selten theoretisch und meist lebensnah formuliert sind, konnte ich eine Tür finden, und ich denke, Hans
Regensburger legte mit „Parzivals Wiedergeburt“ einen wirklich bemerkenswerten Roman vor. Immer wieder ließ ich mich vom
streckenweise rasanten Handlungsverlauf und von der Liebe des Autors zum psychologischen Detail mitnehmen. Dass mir dieser
Roman zugänglich wurde, dafür bin ich dankbar!
Leseprobe
Aus Kapitel 1, Teil I
Im Dampf- und Glutsommer 1977 mögen die New Yorker in ihrer Erfahrung Trost gefunden haben, dass selbst die Tage der
gnadenlosesten Schwüle und Hitze gezählt sind. Trotzdem, so schien es, trugen sie in diesen argen Brenn- und Schwitzwochen
ihre Bilder und Andenken von einer kühleren Atmosphäre und von einem belebenden Regen sang- und klanglos zu Grabe.
Man war zufrieden, wenn die Hitze, die scheinbar unerschütterlich auf den Straßen und Plätzen lastete, nicht jede atlantische Brise fraß oder vor die Küste verbannte.
Brise fraß oder vor die Küste verbannte. In Manhattan, Queens und manch anderen Gebieten der großen Stadt mochte man sich glücklich schätzen, das Meer vor der
In Manhattan, Queens und manch anderen Gebieten der großen Stadt mochte man sich glücklich schätzen, das Meer vor der Haustür zu haben und man konnte vielleicht auch für jene Mitleid aufbringen, die weiter landeinwärts zu leben hatten. Wohl
Haustür zu haben und man konnte vielleicht auch für jene Mitleid aufbringen, die weiter landeinwärts zu leben hatten. Wohl wissend, dass es an solchen Tagen dort nichts als Sonne, nichts als Hitze, nicht den zaghaftesten Windhauch gab.
wissend, dass es an solchen Tagen dort nichts als Sonne, nichts als Hitze, nicht den zaghaftesten Windhauch gab. Daran verschwendete man in der Bronx keinen Gedanken. Wer sollte an der Besonderheit, in einer Stadt am Nordatlantik zu
Daran verschwendete man in der Bronx keinen Gedanken. Wer sollte an der Besonderheit, in einer Stadt am Nordatlantik zu leben, einen Vorzug erkennen? Es konnte nicht sein, dass sich allein die Meereswinde nicht gegen sie verschworen hatten. War
leben, einen Vorzug erkennen? Es konnte nicht sein, dass sich allein die Meereswinde nicht gegen sie verschworen hatten. War man jenseits der Dreißig, stieß die Klage, die gesamte Welt, auch Gott, stünde gegen einen, nie auf ein Kopfschütteln. Wohl oder
man jenseits der Dreißig, stieß die Klage, die gesamte Welt, auch Gott, stünde gegen einen, nie auf ein Kopfschütteln. Wohl oder übel hatte man löchrige und verschmutzte Straßen, von Müll übersäte Gehsteige und Wege, verfallene Gebäude, schäbige
übel hatte man löchrige und verschmutzte Straßen, von Müll übersäte Gehsteige und Wege, verfallene Gebäude, schäbige Wohnblocks, herumlungernde Schlägertypen, Gauner, schräge Vögel zu erdulden. Man machte, wenn es die Zeit erlaubte, um all
Wohnblocks, herumlungernde Schlägertypen, Gauner, schräge Vögel zu erdulden. Man machte, wenn es die Zeit erlaubte, um all das einen großen Bogen. Selbst bei angenehmerem Wetter konnte das jedermanns Nerven strapazieren. Die Hitze aber schien die
das einen großen Bogen. Selbst bei angenehmerem Wetter konnte das jedermanns Nerven strapazieren. Die Hitze aber schien die Alltagslasten zu verdoppeln. An solchen Hundstagen konnten die Leute den Anbruch des Abends gar nicht mehr erwarten. Denn
Alltagslasten zu verdoppeln. An solchen Hundstagen konnten die Leute den Anbruch des Abends gar nicht mehr erwarten. Denn von da an war die Nacht nicht mehr weit. Was gehen konnte, kam nach draußen.
von da an war die Nacht nicht mehr weit. Was gehen konnte, kam nach draußen.  An fast jeder Stelle, die dafür geeignet erschien, wurde Basketball gespielt. Die Bemerkungen, Redensarten der jungen Spieler
An fast jeder Stelle, die dafür geeignet erschien, wurde Basketball gespielt. Die Bemerkungen, Redensarten der jungen Spieler legten die Vermutung nahe, dass sie in ihren Köpfen eine Zeitreise in die Zukunft unternahmen. Dort spielten sie nicht auf der
legten die Vermutung nahe, dass sie in ihren Köpfen eine Zeitreise in die Zukunft unternahmen. Dort spielten sie nicht auf der Straße, sondern in den großen Sportarenen Amerikas. Umjubelt und geliebt von ihren Fans; fürstlich entlohnt von den
Straße, sondern in den großen Sportarenen Amerikas. Umjubelt und geliebt von ihren Fans; fürstlich entlohnt von den Eigentümern ihrer Clubs und umworben von den Präsidenten anderer Clubs.
Eigentümern ihrer Clubs und umworben von den Präsidenten anderer Clubs.  Unweit von einer Haltestelle der Untergrundbahn, wo der Kundige noch nicht das Wort Teufelsküche in den Mund nehmen
Unweit von einer Haltestelle der Untergrundbahn, wo der Kundige noch nicht das Wort Teufelsküche in den Mund nehmen wollte, aber bereits ungeniert von einem Getto sprach, hatten basketballverrückte Erwachsene für ihre Sprösslinge einen Korb
wollte, aber bereits ungeniert von einem Getto sprach, hatten basketballverrückte Erwachsene für ihre Sprösslinge einen Korb befestigt. Auch wenn an dieser Stelle fast nichts an ein richtiges Spielfeld erinnerte, die Höhe des Korbs sollte nicht einen
befestigt. Auch wenn an dieser Stelle fast nichts an ein richtiges Spielfeld erinnerte, die Höhe des Korbs sollte nicht einen Fingerbreit von jener im Madison Square Garden abweichen. Dieses ausgelaugte, fransige Geflecht zog die Jungs aus der
Fingerbreit von jener im Madison Square Garden abweichen. Dieses ausgelaugte, fransige Geflecht zog die Jungs aus der Umgebung in seinen Bann. Und keiner von ihnen fluchte über den frostnarbigen, welligen Asphalt, über den sie zu federn
Umgebung in seinen Bann. Und keiner von ihnen fluchte über den frostnarbigen, welligen Asphalt, über den sie zu federn schienen. Wie die Regeln des Spiels waren diese Unebenheiten den Spielern in Fleisch und Blut übergegangen.
schienen. Wie die Regeln des Spiels waren diese Unebenheiten den Spielern in Fleisch und Blut übergegangen. Der Enge und dem Mief der Subway entronnen, hatte Parzival Arthur Milton stets dort seinen Heimweg unterbrochen, auch
dann, wenn er lieber in seinen Gedanken geblieben wäre. Sobald er in die Reichweite ihres besten Distanzwerfers gekommen war,
flog ihm ihr Ball entgegen. Und Parzival dribbelte, täuschte, passte, vollendete.
Aus Kapitel 11, Teil II
Nora und Ralph hatten sich, nachdem sie wieder aus Amerika zurückgekehrt war, täglich zum Baden oder Eisessen verabredet.
Nur an zwei Tagen wurde sie, wie die Jahre zuvor, von ihren Eltern zur Vorbereitung des Sommernachtsfestes gebraucht.
Am Freitag war großer Einkauf, am Samstag hatte man im Haus und Garten zu tun. Man scheute keine Kosten und wollte die
Der Enge und dem Mief der Subway entronnen, hatte Parzival Arthur Milton stets dort seinen Heimweg unterbrochen, auch
dann, wenn er lieber in seinen Gedanken geblieben wäre. Sobald er in die Reichweite ihres besten Distanzwerfers gekommen war,
flog ihm ihr Ball entgegen. Und Parzival dribbelte, täuschte, passte, vollendete.
Aus Kapitel 11, Teil II
Nora und Ralph hatten sich, nachdem sie wieder aus Amerika zurückgekehrt war, täglich zum Baden oder Eisessen verabredet.
Nur an zwei Tagen wurde sie, wie die Jahre zuvor, von ihren Eltern zur Vorbereitung des Sommernachtsfestes gebraucht.
Am Freitag war großer Einkauf, am Samstag hatte man im Haus und Garten zu tun. Man scheute keine Kosten und wollte die Gäste genauso verwöhnen, wie man auf deren Feste verwöhnt wurde. Doch die Spezialität, die bislang unkopiert geblieben war,
Gäste genauso verwöhnen, wie man auf deren Feste verwöhnt wurde. Doch die Spezialität, die bislang unkopiert geblieben war, durfte auch bei dieser Party nicht fehlen.
durfte auch bei dieser Party nicht fehlen.  Kaum hatte Gunther die Befürchtung beschworen: »Ihnen wird doch nicht ausgerechnet heuer etwas dazwischen gekommen
Kaum hatte Gunther die Befürchtung beschworen: »Ihnen wird doch nicht ausgerechnet heuer etwas dazwischen gekommen sein?«, rollte ein schwerer Mercedes auf die Garagenzufahrt. »Helmut und Hilde, endlich!« Gunther eilte hinaus. Noch ehe die
sein?«, rollte ein schwerer Mercedes auf die Garagenzufahrt. »Helmut und Hilde, endlich!« Gunther eilte hinaus. Noch ehe die Ankömmlinge ausgestiegen waren, bewunderte er das neue Auto. Helmut Wolf, ein gelassener und selbstbewusster Mittfünfziger,
Ankömmlinge ausgestiegen waren, bewunderte er das neue Auto. Helmut Wolf, ein gelassener und selbstbewusster Mittfünfziger, meinte, Gunther möge die Kirche im Dorf lassen, denn auch dieses funkelnagelneue und sündhaft teure Auto würde eines Tages
meinte, Gunther möge die Kirche im Dorf lassen, denn auch dieses funkelnagelneue und sündhaft teure Auto würde eines Tages genauso beim Schrotthändler enden wie der billigste und unansehnlichste Ausländer. Doch zuerst wolle er Grüß Gott sagen; er
genauso beim Schrotthändler enden wie der billigste und unansehnlichste Ausländer. Doch zuerst wolle er Grüß Gott sagen; er hoffe, alles sei wie immer in bester Ordnung. Die Kinder genössen den Rest der Ferien und des Betriebsurlaubs lieber zu Hause
hoffe, alles sei wie immer in bester Ordnung. Die Kinder genössen den Rest der Ferien und des Betriebsurlaubs lieber zu Hause mit ihren Freunden. Unser Markus wolle heuer erst einen Tag vor Schulbeginn mit dem Zug anreisen. Florence und Hilde
mit ihren Freunden. Unser Markus wolle heuer erst einen Tag vor Schulbeginn mit dem Zug anreisen. Florence und Hilde strahlten sich an. Ihrem Händedruck folgen Wangenküsschen links und rechts. »Gut siehst du aus, Hilde, richtig gut! Wie schick
strahlten sich an. Ihrem Händedruck folgen Wangenküsschen links und rechts. »Gut siehst du aus, Hilde, richtig gut! Wie schick deine Bluse ist – wo hast du sie gekauft?«, sagte Florence nachdem sie und Hilde sich umarmt hatten und diese antwortete: »Und
deine Bluse ist – wo hast du sie gekauft?«, sagte Florence nachdem sie und Hilde sich umarmt hatten und diese antwortete: »Und du umwerfend wie immer; schön dich zu sehn, Florence. Mit welcher Garderobe wirst du uns heut Abend überraschen?« Beide
du umwerfend wie immer; schön dich zu sehn, Florence. Mit welcher Garderobe wirst du uns heut Abend überraschen?« Beide lachten übers ganze Gesicht. Nora kam hinzu. Flugs deckte sie einen Gartentisch und schenkte Kaffee ein. Man plauderte,
lachten übers ganze Gesicht. Nora kam hinzu. Flugs deckte sie einen Gartentisch und schenkte Kaffee ein. Man plauderte, scherzte, erzählte Witze, lachte. Nichts als heitere Gesichter, nichts als gute Laune. Dann machte Helmut Wolf beinahe
scherzte, erzählte Witze, lachte. Nichts als heitere Gesichter, nichts als gute Laune. Dann machte Helmut Wolf beinahe überfallartig der Unterhaltung den Garaus. »Wenn man auch heuer die besten Fränkischen Bratwürste der Welt auf dem Grill
überfallartig der Unterhaltung den Garaus. »Wenn man auch heuer die besten Fränkischen Bratwürste der Welt auf dem Grill haben möchte, dann kann es bei aller Freundschaft nicht so weitergehen«, witzelte er. Alle lachten.
haben möchte, dann kann es bei aller Freundschaft nicht so weitergehen«, witzelte er. Alle lachten.  Wie von magischen Kräften gehoben, schwenkte der Kofferraumdeckel in die Höhe. Helmut Wolf pries die Güte der Waren,
Wie von magischen Kräften gehoben, schwenkte der Kofferraumdeckel in die Höhe. Helmut Wolf pries die Güte der Waren, die sich im Kofferraum befanden. Seine Art zu reden und zu gestikulieren, machte seine Aussagen unangreifbar. Weit holte er aus.
die sich im Kofferraum befanden. Seine Art zu reden und zu gestikulieren, machte seine Aussagen unangreifbar. Weit holte er aus. Bass und fränkischer Zungenschlag walzten breit dahin. In den Kühlboxen sei schlachtfrisches Schweinefleisch der höchsten
Bass und fränkischer Zungenschlag walzten breit dahin. In den Kühlboxen sei schlachtfrisches Schweinefleisch der höchsten Qualitätsstufe. Deswegen habe gestern Nachmittag ein Schwein sein Leben lassen müssen – das glückliche Schwein der
Qualitätsstufe. Deswegen habe gestern Nachmittag ein Schwein sein Leben lassen müssen – das glückliche Schwein der Oberpfälzer Bauersleute Regina und Erwin Mauderer. Für diese lege er seine Hand ins Feuer. Dieses Tier sei langsam
Oberpfälzer Bauersleute Regina und Erwin Mauderer. Für diese lege er seine Hand ins Feuer. Dieses Tier sei langsam herangereift; es habe nur bestes Futter genossen, das frei von Spritzmitteln und Medikamenten gewesen sei.
herangereift; es habe nur bestes Futter genossen, das frei von Spritzmitteln und Medikamenten gewesen sei.  Ehe die Männer anpackten, die Kühlboxen mit dem Fleisch, den Karton mit den Gewürzen, den Därmen, den Fleischwolf und,
Ehe die Männer anpackten, die Kühlboxen mit dem Fleisch, den Karton mit den Gewürzen, den Därmen, den Fleischwolf und, und, und in den Keller zu bringen, deutete Helmut Wolf auf das Bier und den Wein. Gestenreich kam er darauf zu sprechen.
und, und in den Keller zu bringen, deutete Helmut Wolf auf das Bier und den Wein. Gestenreich kam er darauf zu sprechen. Aus Kapitel 19, Teil III
Der Bus erreichte sein Ziel. Man drängte ins Freie, befand sich auf dem Parkplatz, strebte ins Herz von Wolframs-Eschenbach,
ging dort zum Wolfram-von-Eschenbach-Platz, zu Wolfram selbst, zu dessen Museum und Monument. Overesch scharte die
Kollegen um sich, deutete auf den in Bronze gegossenen Dichter. Ob sie nun Cargohosen oder enge Jeans anhatten, T-Shirts,
Tops oder luftige Sommerkleider, alle betrachteten ihn, gingen um ihn herum. Einige von ihnen lehnten sich an den Brunnen, den
ein Sockel umfing, und griffen ins kühle Nass. »Tolles Wetter erwischt«, meinte Overesch mit Blick auf Wolframs
lorbeerbekränztes Haupt.
»Kaiserwetter«, unterstrich Tonner, der anstelle von Graim ins Kollegium gekommen war, damals vor einem Jahr.
Aus Kapitel 19, Teil III
Der Bus erreichte sein Ziel. Man drängte ins Freie, befand sich auf dem Parkplatz, strebte ins Herz von Wolframs-Eschenbach,
ging dort zum Wolfram-von-Eschenbach-Platz, zu Wolfram selbst, zu dessen Museum und Monument. Overesch scharte die
Kollegen um sich, deutete auf den in Bronze gegossenen Dichter. Ob sie nun Cargohosen oder enge Jeans anhatten, T-Shirts,
Tops oder luftige Sommerkleider, alle betrachteten ihn, gingen um ihn herum. Einige von ihnen lehnten sich an den Brunnen, den
ein Sockel umfing, und griffen ins kühle Nass. »Tolles Wetter erwischt«, meinte Overesch mit Blick auf Wolframs
lorbeerbekränztes Haupt.
»Kaiserwetter«, unterstrich Tonner, der anstelle von Graim ins Kollegium gekommen war, damals vor einem Jahr. »Heiß wird´s werden«, so Florence´ Prognose.
»Heiß wird´s werden«, so Florence´ Prognose. »Für einen Schulausflug gerade recht«, meinte Kuhn.
»Für einen Schulausflug gerade recht«, meinte Kuhn. »Ist nun das Denkmal älter oder der, den es vorgibt darzustellen?«, witzelte Newperry. Man lachte.
»Ist nun das Denkmal älter oder der, den es vorgibt darzustellen?«, witzelte Newperry. Man lachte. »Seid ihr Briten uns diese Art Humor auf Schritt und Tritt schuldig?«, sagte ein anderer. Seine Pikiertheit war nicht zu
»Seid ihr Briten uns diese Art Humor auf Schritt und Tritt schuldig?«, sagte ein anderer. Seine Pikiertheit war nicht zu überhören.
überhören. »Auch nicht von schlechten Eltern«, bewies Overesch Schlagfertigkeit und grinste.
»Auch nicht von schlechten Eltern«, bewies Overesch Schlagfertigkeit und grinste. Vor dem Museum Trauben von Schülern. Eine bunte, putzmuntere Schar. Über dem Lärmpegel Gekicher, Gelächter, ab und zu
Vor dem Museum Trauben von Schülern. Eine bunte, putzmuntere Schar. Über dem Lärmpegel Gekicher, Gelächter, ab und zu ein Pfiff, Rufe. Hantieren an Rucksäcken. Man aß, trank, schob sich einen Kaugummi in den Mund; unter den Älteren sah man
ein Pfiff, Rufe. Hantieren an Rucksäcken. Man aß, trank, schob sich einen Kaugummi in den Mund; unter den Älteren sah man nicht selten eine Zigarette zwischen den Lippen hängen.
nicht selten eine Zigarette zwischen den Lippen hängen. Overesch klatschte in die Hände. Damit verschaffte er sich Gehör. Dann seine Aufforderung, die Klassen mögen sich bei ihren
Overesch klatschte in die Hände. Damit verschaffte er sich Gehör. Dann seine Aufforderung, die Klassen mögen sich bei ihren Lehrern oder Lehrerinnen sammeln. »Wird´s bald? Zigaretten aus im Museum! Verstanden?« Einige Dutzend Schritte davon
Lehrern oder Lehrerinnen sammeln. »Wird´s bald? Zigaretten aus im Museum! Verstanden?« Einige Dutzend Schritte davon entfernt eine Handvoll Leute. Ausnahmslos Erwachsene jenseits der Vierzig. Eine Bedienstete des Museums bat sie, man möge an
entfernt eine Handvoll Leute. Ausnahmslos Erwachsene jenseits der Vierzig. Eine Bedienstete des Museums bat sie, man möge an der Kasse auf sie warten. Dort gab sie ihnen mit auf den Weg: »Bis der große Ansturm kommt, wird Ihre Multimediavorführung
der Kasse auf sie warten. Dort gab sie ihnen mit auf den Weg: »Bis der große Ansturm kommt, wird Ihre Multimediavorführung zu Ende sein. Lassen Sie sich bei der Besichtigung des Museums ruhig Zeit; es wäre sonst schade …!«
zu Ende sein. Lassen Sie sich bei der Besichtigung des Museums ruhig Zeit; es wäre sonst schade …!« Das Video begann von vorne. Florence´ ließ sich Zeit, viel Zeit. Damit strapazierte sie die Geduld ihrer Klassen, das war weder
Das Video begann von vorne. Florence´ ließ sich Zeit, viel Zeit. Damit strapazierte sie die Geduld ihrer Klassen, das war weder zu überhören noch zu übersehen. Als Florence den Eindruck gewonnen hatte, dass sich in den zehn Räumen des Museums nun
zu überhören noch zu übersehen. Als Florence den Eindruck gewonnen hatte, dass sich in den zehn Räumen des Museums nun niemand mehr auf die Füße steigen konnte, führte sie die Mädchen und Jungens hinauf ins erste Stockwerk.
niemand mehr auf die Füße steigen konnte, führte sie die Mädchen und Jungens hinauf ins erste Stockwerk. Auch dort sagte sie der Eile den Kampf an. Im fünften Raum, wo der Dreh- und Angelpunkt der Parzivaldichtung gezeigt wurde,
wollte sie so lange mit dem Beginn ihrer Erläuterungen warten, bis ihre Schülerinnen und Schüler ein einminütiges Schweigen
unter Beweis gestellt hatten. Endlich war sie zufrieden. Dann zeigte Florence auf ein Graffiti, fixierte es und fragte, ohne es aus
den Augen zu lassen: »Könnt ihr das jetzt sehen?« Dann rezitierte sie: »hêrre, wie stêt iwer nôt?« Daran schloss sie Betrachtungen
an. Die Mädchen und Jungens ahnten, dass zu diesem Thema jene Fragen, die nur sie stellen konnte und worauf nur sie die
Antworten wusste, nicht mehr lange auf sich warten ließen. Sie hielt inne. Obwohl die meisten der jungen Leute nicht auf ihren
Vortrag achteten, entging ihnen nicht, dass ihre Lehrerin einen Gedanken nicht zu Ende gebracht hatte. Florence war in ein
Schweigen verfallen. Sie stand wie erstarrt da.
Auch dort sagte sie der Eile den Kampf an. Im fünften Raum, wo der Dreh- und Angelpunkt der Parzivaldichtung gezeigt wurde,
wollte sie so lange mit dem Beginn ihrer Erläuterungen warten, bis ihre Schülerinnen und Schüler ein einminütiges Schweigen
unter Beweis gestellt hatten. Endlich war sie zufrieden. Dann zeigte Florence auf ein Graffiti, fixierte es und fragte, ohne es aus
den Augen zu lassen: »Könnt ihr das jetzt sehen?« Dann rezitierte sie: »hêrre, wie stêt iwer nôt?« Daran schloss sie Betrachtungen
an. Die Mädchen und Jungens ahnten, dass zu diesem Thema jene Fragen, die nur sie stellen konnte und worauf nur sie die
Antworten wusste, nicht mehr lange auf sich warten ließen. Sie hielt inne. Obwohl die meisten der jungen Leute nicht auf ihren
Vortrag achteten, entging ihnen nicht, dass ihre Lehrerin einen Gedanken nicht zu Ende gebracht hatte. Florence war in ein
Schweigen verfallen. Sie stand wie erstarrt da.
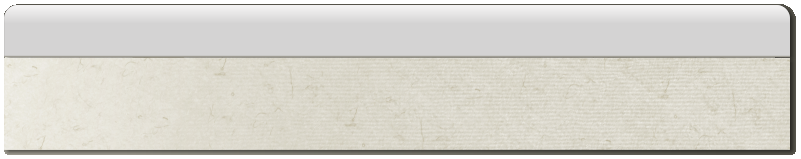

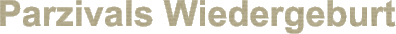



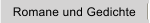




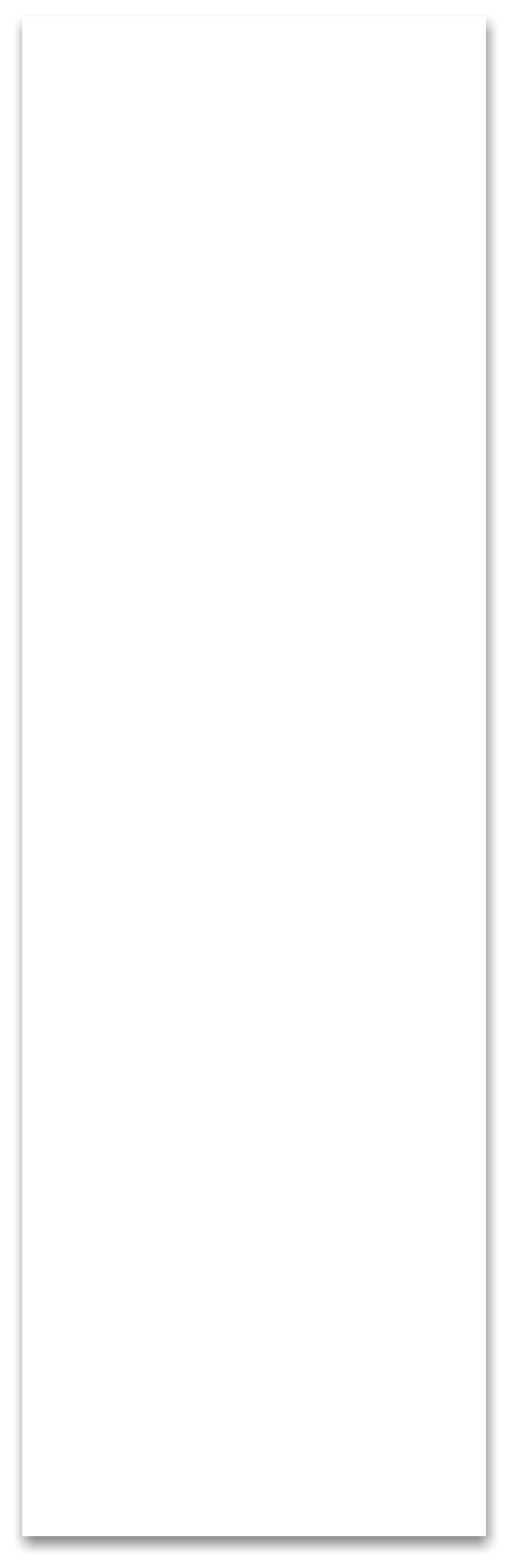


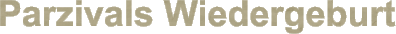
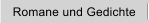
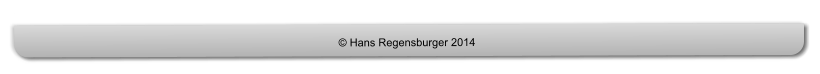
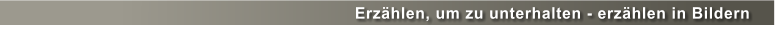 Parzivals Wiedergeburt - neuer Titel: Stromausfall - Entwicklungsroman
Roman 2012; 292 Seiten - Textumfang ca. 85.000 Wörter
Zeit und Orte: 1977-1996, New York, Bonn, Köln, Erlangen, Nürnberg, Hohenfels, Parsberg, Abenberg, Wolframs-Eschenbach
Gerhard Breitbarth Verlag, Regensburg; ISBN 978-3-9435-6419-8; Buch - 14,95 €
ISBN 978-3-9435-6418-1: ePub - eBook-Reader - 8,95 €
Wegen der Geschäftsauflösung des Gerhard Breitbarth Verlags im September 2013 ist der Roman “Parzivals Wiedergeburt” als
Verlagsausgabe vergriffen. Er liegt nun als Eigendruck des Autors in Buchform vor; 8,00 €
Überarbeitung des Textes sowie Neugestaltung des Buchäußeren: Oktober 2016
Der Roman kann entweder beim Autor vor Ort bezogen oder bei ihm bestellt werden - Versand vom Autor mit
Portoaufschlag.
Zum Inhalt
Parzival, geboren in New York, teilt dort mit seinem Vater und dem kauzigen Bird eine bescheidene Wohnung. Parzival ist in
Florence, seine ehemalige Lehrerin, verliebt, die aber seine Liebe nicht erwidert. Dennoch verbindet beide eine enge Freundschaft,
wenn nicht gar eine Seelenverwandtschaft. In jedem Fall haben sie eine einzigartige intellektuelle Beziehung. Es ist eine Beziehung
zwischen Erwachsenen. Parzival holte bei Florence seinen Schulabschluss nach, den er als Kind und Jugendlicher versäumt hatte.
Sie lernte von ihm, der mit Deutsch und Amerikanisch aufwuchs, die deutsche Sprache.
Parzivals außergewöhnlichem Unternehmen, das seinen gesellschaftlichen Aufstieg einläuten sollte, bleibt der Erfolg versagt. Dieser
wäre gleichbedeutend mit Florence´ ganzer Liebe gewesen, glaubt er. Als er mit leeren Händen vor ihr steht, fällt in New York der
Strom aus. Beide wollen dem Verhängnisvollen dieser Nacht entrinnen. Parzival fürchtet eine Strafverfolgung, flieht. Er tritt in die
Army ein und macht dort Karriere.
Ohne von einander zu wissen, verschlägt es sie nach Deutschland. Sie gründet dort eine Familie, genauso er. Ihre ahnungslosen
Kinder besuchen dieselbe Schule und verlieben sich ineinander. Auf einem Fest spürt Florence, in wen sich ihre Tochter verliebte.
Sie fordert das Ende dieser Beziehung, nennt aber zunächst nicht den Grund. Von da an schlittert ihr Leben in die Krise.
In Wolframs-Eschenbach sucht Parzival nach den Spuren seiner deutschen Mutter. Der Zufall führt ihn in Wolframs Museum, wo er
auf Florence trifft, die sich auf einer Klassenfahrt befindet. Ehe sie dort einander gewahr werden, rezitiert sie vor ihren Schülern
Wolfram von Eschenbachs Parzival versäumte Frage an Amfortas: "hêrre, wie stêt iwer nôt?" Florence und Parzival fehlen die
Worte, obwohl sie eine Aussprache herbeisehnen
Der Leser Dr. Joachim Balsliemke schreibt über den Parzival:
Der Titel des Romans lässt wegen der Bezugnahme auf die hochmittelalterliche Parzival-Dichtung an eine überwiegend
intellektuelle und schwer verdauliche Kost denken. Stattdessen handelt es sich um einen sehr spannenden und emotional
bewegenden Roman. Das Schicksal des Protagonisten bewegt sich, ausgehend von den Schlüsselereignissen während des
Blackouts in New York im Jahr 1977, bis in das Deutschland der Gegenwart. Die Handlung ist eingewoben in ein menschliches
Dauerthema: Schuld und Vergebung von Schuld, sowohl in einem personalen als auch in einem gesellschaftlichen Kontext.
Am Ende des Romans steht eigentlich eher ein Happyend als ein Unhappyend. Andererseits stimmen der Schluss und die
Auflösung der personellen Verwicklungen auch nachdenklich. "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern" heißt es. Dass das Erkennen und Vergeben von Schuld nicht nur ein christlich moralischer Imperativ ist, sondern für
die beteiligten Personen auch befreiend sein kann, wird in der Zuspitzung der Geschehnisse deutlich. Schuldig werden, sich selbst
suchen und eine Entwicklung durchleben von Selbstbezogenheit zu stärkerer Empathiefähigkeit, in diesem Sinne handelt es sich
bei dem Protagonisten um einen Parzival und um die Wiedergeburt eines zeitlosen Lebensmotivs. Es ist ein gelungener Roman,
der neben geistiger Anregung auch Lesevergnügen gewährleistet.
Der Leser Ralf schreibt über den Parzival:
Als ich durch meine Freundin in eine Vorlesung zu diesem Buch kam, war ich zunächst skeptisch, da ich zunächst nur von den
komplexen geschichtlichen Zusammenhängen erfuhr, welche mich eher abschreckten und mich befürchten ließen, hierbei handelt
es sich um einen sehr trockenen Roman. Jedoch wurde ich in allen Belangen eines Besseren belehrt, da die Lesung sehr
kurzweilig war und die anschließende Lektüre ebenso, was dadurch bewiesen wurde, dass ich das Buch innerhalb von drei Tagen
las. Regensburger hat es mit diesem Buch geschafft, mich sehr gut zu unterhalten und mir auch vieles beigebracht. Ob dies nun
die liebevoll beschriebene Bonbonherstellung ist oder eben eine Reihe von geschichtlich durchaus interessanten
Zusammenhängen. Einzig zu bemängeln wäre die vorweg verfasste Inhaltsangabe, welche ein wenig das Unvorhersehende
vorhersehen lässt. Es gibt jedoch trotz alledem ein sehr spannendes wie bedrückendes Ende. Alles in allem also ein sehr
lesenswertes Buch, das Freude auf mehr macht.
Der Leser Dr. Bernd Adam schreibt über den Parzival:
Parzivals Wiedergeburt - neuer Titel: Stromausfall - Entwicklungsroman
Roman 2012; 292 Seiten - Textumfang ca. 85.000 Wörter
Zeit und Orte: 1977-1996, New York, Bonn, Köln, Erlangen, Nürnberg, Hohenfels, Parsberg, Abenberg, Wolframs-Eschenbach
Gerhard Breitbarth Verlag, Regensburg; ISBN 978-3-9435-6419-8; Buch - 14,95 €
ISBN 978-3-9435-6418-1: ePub - eBook-Reader - 8,95 €
Wegen der Geschäftsauflösung des Gerhard Breitbarth Verlags im September 2013 ist der Roman “Parzivals Wiedergeburt” als
Verlagsausgabe vergriffen. Er liegt nun als Eigendruck des Autors in Buchform vor; 8,00 €
Überarbeitung des Textes sowie Neugestaltung des Buchäußeren: Oktober 2016
Der Roman kann entweder beim Autor vor Ort bezogen oder bei ihm bestellt werden - Versand vom Autor mit
Portoaufschlag.
Zum Inhalt
Parzival, geboren in New York, teilt dort mit seinem Vater und dem kauzigen Bird eine bescheidene Wohnung. Parzival ist in
Florence, seine ehemalige Lehrerin, verliebt, die aber seine Liebe nicht erwidert. Dennoch verbindet beide eine enge Freundschaft,
wenn nicht gar eine Seelenverwandtschaft. In jedem Fall haben sie eine einzigartige intellektuelle Beziehung. Es ist eine Beziehung
zwischen Erwachsenen. Parzival holte bei Florence seinen Schulabschluss nach, den er als Kind und Jugendlicher versäumt hatte.
Sie lernte von ihm, der mit Deutsch und Amerikanisch aufwuchs, die deutsche Sprache.
Parzivals außergewöhnlichem Unternehmen, das seinen gesellschaftlichen Aufstieg einläuten sollte, bleibt der Erfolg versagt. Dieser
wäre gleichbedeutend mit Florence´ ganzer Liebe gewesen, glaubt er. Als er mit leeren Händen vor ihr steht, fällt in New York der
Strom aus. Beide wollen dem Verhängnisvollen dieser Nacht entrinnen. Parzival fürchtet eine Strafverfolgung, flieht. Er tritt in die
Army ein und macht dort Karriere.
Ohne von einander zu wissen, verschlägt es sie nach Deutschland. Sie gründet dort eine Familie, genauso er. Ihre ahnungslosen
Kinder besuchen dieselbe Schule und verlieben sich ineinander. Auf einem Fest spürt Florence, in wen sich ihre Tochter verliebte.
Sie fordert das Ende dieser Beziehung, nennt aber zunächst nicht den Grund. Von da an schlittert ihr Leben in die Krise.
In Wolframs-Eschenbach sucht Parzival nach den Spuren seiner deutschen Mutter. Der Zufall führt ihn in Wolframs Museum, wo er
auf Florence trifft, die sich auf einer Klassenfahrt befindet. Ehe sie dort einander gewahr werden, rezitiert sie vor ihren Schülern
Wolfram von Eschenbachs Parzival versäumte Frage an Amfortas: "hêrre, wie stêt iwer nôt?" Florence und Parzival fehlen die
Worte, obwohl sie eine Aussprache herbeisehnen
Der Leser Dr. Joachim Balsliemke schreibt über den Parzival:
Der Titel des Romans lässt wegen der Bezugnahme auf die hochmittelalterliche Parzival-Dichtung an eine überwiegend
intellektuelle und schwer verdauliche Kost denken. Stattdessen handelt es sich um einen sehr spannenden und emotional
bewegenden Roman. Das Schicksal des Protagonisten bewegt sich, ausgehend von den Schlüsselereignissen während des
Blackouts in New York im Jahr 1977, bis in das Deutschland der Gegenwart. Die Handlung ist eingewoben in ein menschliches
Dauerthema: Schuld und Vergebung von Schuld, sowohl in einem personalen als auch in einem gesellschaftlichen Kontext.
Am Ende des Romans steht eigentlich eher ein Happyend als ein Unhappyend. Andererseits stimmen der Schluss und die
Auflösung der personellen Verwicklungen auch nachdenklich. "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern" heißt es. Dass das Erkennen und Vergeben von Schuld nicht nur ein christlich moralischer Imperativ ist, sondern für
die beteiligten Personen auch befreiend sein kann, wird in der Zuspitzung der Geschehnisse deutlich. Schuldig werden, sich selbst
suchen und eine Entwicklung durchleben von Selbstbezogenheit zu stärkerer Empathiefähigkeit, in diesem Sinne handelt es sich
bei dem Protagonisten um einen Parzival und um die Wiedergeburt eines zeitlosen Lebensmotivs. Es ist ein gelungener Roman,
der neben geistiger Anregung auch Lesevergnügen gewährleistet.
Der Leser Ralf schreibt über den Parzival:
Als ich durch meine Freundin in eine Vorlesung zu diesem Buch kam, war ich zunächst skeptisch, da ich zunächst nur von den
komplexen geschichtlichen Zusammenhängen erfuhr, welche mich eher abschreckten und mich befürchten ließen, hierbei handelt
es sich um einen sehr trockenen Roman. Jedoch wurde ich in allen Belangen eines Besseren belehrt, da die Lesung sehr
kurzweilig war und die anschließende Lektüre ebenso, was dadurch bewiesen wurde, dass ich das Buch innerhalb von drei Tagen
las. Regensburger hat es mit diesem Buch geschafft, mich sehr gut zu unterhalten und mir auch vieles beigebracht. Ob dies nun
die liebevoll beschriebene Bonbonherstellung ist oder eben eine Reihe von geschichtlich durchaus interessanten
Zusammenhängen. Einzig zu bemängeln wäre die vorweg verfasste Inhaltsangabe, welche ein wenig das Unvorhersehende
vorhersehen lässt. Es gibt jedoch trotz alledem ein sehr spannendes wie bedrückendes Ende. Alles in allem also ein sehr
lesenswertes Buch, das Freude auf mehr macht.
Der Leser Dr. Bernd Adam schreibt über den Parzival: Ich staune über den weiten Bogen der Handlung, den der Autor in diesem großen Roman schlägt. Sie beginnt 1977 in
Ich staune über den weiten Bogen der Handlung, den der Autor in diesem großen Roman schlägt. Sie beginnt 1977 in  New York-Harlem, führt im Laufe der Zeit unter anderem nach Nürnberg und endet zwei Jahrzehnte später in
New York-Harlem, führt im Laufe der Zeit unter anderem nach Nürnberg und endet zwei Jahrzehnte später in  Wolframs-Eschenbach und Abenberg.
Wolframs-Eschenbach und Abenberg.  Vor allem in den letzten Kapiteln steckt unaufdringlich und anregend zugleich viel Lokalkolorit, das zum eigenen Nachspüren in der
Realität anregt. Nicht alles, was ich las, vermochte bei mir Türen zu öffnen – dazu sind mir manche Gedanken inzwischen zu fremd
geworden, etwa solche, die im hitzigen Gespräch von Jugendlichen geäußert werden oder in der von Alkohol befeuerten
Diskussion Erwachsener, die sich über politische Geschehen in Vergangenheit und Gegenwart und dessen Bewertung streiten. An
solchen Stellen habe ich etwas schneller, auch mal diagonal gelesen. Aber zu vielem, auch zu vielen psychologischen
Überlegungen, die selten theoretisch und meist lebensnah formuliert sind, konnte ich eine Tür finden, und ich denke, Hans
Regensburger legte mit „Parzivals Wiedergeburt“ einen wirklich bemerkenswerten Roman vor. Immer wieder ließ ich mich vom
streckenweise rasanten Handlungsverlauf und von der Liebe des Autors zum psychologischen Detail mitnehmen. Dass mir dieser
Roman zugänglich wurde, dafür bin ich dankbar!
Leseprobe
Aus Kapitel 1, Teil I
Im Dampf- und Glutsommer 1977 mögen die New Yorker in ihrer Erfahrung Trost gefunden haben, dass selbst die Tage der
gnadenlosesten Schwüle und Hitze gezählt sind. Trotzdem, so schien es, trugen sie in diesen argen Brenn- und Schwitzwochen
ihre Bilder und Andenken von einer kühleren Atmosphäre und von einem belebenden Regen sang- und klanglos zu Grabe.
Man war zufrieden, wenn die Hitze, die scheinbar unerschütterlich auf den Straßen und Plätzen lastete, nicht jede atlantische
Vor allem in den letzten Kapiteln steckt unaufdringlich und anregend zugleich viel Lokalkolorit, das zum eigenen Nachspüren in der
Realität anregt. Nicht alles, was ich las, vermochte bei mir Türen zu öffnen – dazu sind mir manche Gedanken inzwischen zu fremd
geworden, etwa solche, die im hitzigen Gespräch von Jugendlichen geäußert werden oder in der von Alkohol befeuerten
Diskussion Erwachsener, die sich über politische Geschehen in Vergangenheit und Gegenwart und dessen Bewertung streiten. An
solchen Stellen habe ich etwas schneller, auch mal diagonal gelesen. Aber zu vielem, auch zu vielen psychologischen
Überlegungen, die selten theoretisch und meist lebensnah formuliert sind, konnte ich eine Tür finden, und ich denke, Hans
Regensburger legte mit „Parzivals Wiedergeburt“ einen wirklich bemerkenswerten Roman vor. Immer wieder ließ ich mich vom
streckenweise rasanten Handlungsverlauf und von der Liebe des Autors zum psychologischen Detail mitnehmen. Dass mir dieser
Roman zugänglich wurde, dafür bin ich dankbar!
Leseprobe
Aus Kapitel 1, Teil I
Im Dampf- und Glutsommer 1977 mögen die New Yorker in ihrer Erfahrung Trost gefunden haben, dass selbst die Tage der
gnadenlosesten Schwüle und Hitze gezählt sind. Trotzdem, so schien es, trugen sie in diesen argen Brenn- und Schwitzwochen
ihre Bilder und Andenken von einer kühleren Atmosphäre und von einem belebenden Regen sang- und klanglos zu Grabe.
Man war zufrieden, wenn die Hitze, die scheinbar unerschütterlich auf den Straßen und Plätzen lastete, nicht jede atlantische Brise fraß oder vor die Küste verbannte.
Brise fraß oder vor die Küste verbannte. In Manhattan, Queens und manch anderen Gebieten der großen Stadt mochte man sich glücklich schätzen, das Meer vor der
In Manhattan, Queens und manch anderen Gebieten der großen Stadt mochte man sich glücklich schätzen, das Meer vor der Haustür zu haben und man konnte vielleicht auch für jene Mitleid aufbringen, die weiter landeinwärts zu leben hatten. Wohl
Haustür zu haben und man konnte vielleicht auch für jene Mitleid aufbringen, die weiter landeinwärts zu leben hatten. Wohl wissend, dass es an solchen Tagen dort nichts als Sonne, nichts als Hitze, nicht den zaghaftesten Windhauch gab.
wissend, dass es an solchen Tagen dort nichts als Sonne, nichts als Hitze, nicht den zaghaftesten Windhauch gab. Daran verschwendete man in der Bronx keinen Gedanken. Wer sollte an der Besonderheit, in einer Stadt am Nordatlantik zu
Daran verschwendete man in der Bronx keinen Gedanken. Wer sollte an der Besonderheit, in einer Stadt am Nordatlantik zu leben, einen Vorzug erkennen? Es konnte nicht sein, dass sich allein die Meereswinde nicht gegen sie verschworen hatten. War
leben, einen Vorzug erkennen? Es konnte nicht sein, dass sich allein die Meereswinde nicht gegen sie verschworen hatten. War man jenseits der Dreißig, stieß die Klage, die gesamte Welt, auch Gott, stünde gegen einen, nie auf ein Kopfschütteln. Wohl oder
man jenseits der Dreißig, stieß die Klage, die gesamte Welt, auch Gott, stünde gegen einen, nie auf ein Kopfschütteln. Wohl oder übel hatte man löchrige und verschmutzte Straßen, von Müll übersäte Gehsteige und Wege, verfallene Gebäude, schäbige
übel hatte man löchrige und verschmutzte Straßen, von Müll übersäte Gehsteige und Wege, verfallene Gebäude, schäbige Wohnblocks, herumlungernde Schlägertypen, Gauner, schräge Vögel zu erdulden. Man machte, wenn es die Zeit erlaubte, um all
Wohnblocks, herumlungernde Schlägertypen, Gauner, schräge Vögel zu erdulden. Man machte, wenn es die Zeit erlaubte, um all das einen großen Bogen. Selbst bei angenehmerem Wetter konnte das jedermanns Nerven strapazieren. Die Hitze aber schien die
das einen großen Bogen. Selbst bei angenehmerem Wetter konnte das jedermanns Nerven strapazieren. Die Hitze aber schien die Alltagslasten zu verdoppeln. An solchen Hundstagen konnten die Leute den Anbruch des Abends gar nicht mehr erwarten. Denn
Alltagslasten zu verdoppeln. An solchen Hundstagen konnten die Leute den Anbruch des Abends gar nicht mehr erwarten. Denn von da an war die Nacht nicht mehr weit. Was gehen konnte, kam nach draußen.
von da an war die Nacht nicht mehr weit. Was gehen konnte, kam nach draußen.  An fast jeder Stelle, die dafür geeignet erschien, wurde Basketball gespielt. Die Bemerkungen, Redensarten der jungen Spieler
An fast jeder Stelle, die dafür geeignet erschien, wurde Basketball gespielt. Die Bemerkungen, Redensarten der jungen Spieler legten die Vermutung nahe, dass sie in ihren Köpfen eine Zeitreise in die Zukunft unternahmen. Dort spielten sie nicht auf der
legten die Vermutung nahe, dass sie in ihren Köpfen eine Zeitreise in die Zukunft unternahmen. Dort spielten sie nicht auf der Straße, sondern in den großen Sportarenen Amerikas. Umjubelt und geliebt von ihren Fans; fürstlich entlohnt von den
Straße, sondern in den großen Sportarenen Amerikas. Umjubelt und geliebt von ihren Fans; fürstlich entlohnt von den Eigentümern ihrer Clubs und umworben von den Präsidenten anderer Clubs.
Eigentümern ihrer Clubs und umworben von den Präsidenten anderer Clubs.  Unweit von einer Haltestelle der Untergrundbahn, wo der Kundige noch nicht das Wort Teufelsküche in den Mund nehmen
Unweit von einer Haltestelle der Untergrundbahn, wo der Kundige noch nicht das Wort Teufelsküche in den Mund nehmen wollte, aber bereits ungeniert von einem Getto sprach, hatten basketballverrückte Erwachsene für ihre Sprösslinge einen Korb
wollte, aber bereits ungeniert von einem Getto sprach, hatten basketballverrückte Erwachsene für ihre Sprösslinge einen Korb befestigt. Auch wenn an dieser Stelle fast nichts an ein richtiges Spielfeld erinnerte, die Höhe des Korbs sollte nicht einen
befestigt. Auch wenn an dieser Stelle fast nichts an ein richtiges Spielfeld erinnerte, die Höhe des Korbs sollte nicht einen Fingerbreit von jener im Madison Square Garden abweichen. Dieses ausgelaugte, fransige Geflecht zog die Jungs aus der
Fingerbreit von jener im Madison Square Garden abweichen. Dieses ausgelaugte, fransige Geflecht zog die Jungs aus der Umgebung in seinen Bann. Und keiner von ihnen fluchte über den frostnarbigen, welligen Asphalt, über den sie zu federn
Umgebung in seinen Bann. Und keiner von ihnen fluchte über den frostnarbigen, welligen Asphalt, über den sie zu federn schienen. Wie die Regeln des Spiels waren diese Unebenheiten den Spielern in Fleisch und Blut übergegangen.
schienen. Wie die Regeln des Spiels waren diese Unebenheiten den Spielern in Fleisch und Blut übergegangen. Der Enge und dem Mief der Subway entronnen, hatte Parzival Arthur Milton stets dort seinen Heimweg unterbrochen, auch
dann, wenn er lieber in seinen Gedanken geblieben wäre. Sobald er in die Reichweite ihres besten Distanzwerfers gekommen war,
flog ihm ihr Ball entgegen. Und Parzival dribbelte, täuschte, passte, vollendete.
Aus Kapitel 11, Teil II
Nora und Ralph hatten sich, nachdem sie wieder aus Amerika zurückgekehrt war, täglich zum Baden oder Eisessen verabredet.
Nur an zwei Tagen wurde sie, wie die Jahre zuvor, von ihren Eltern zur Vorbereitung des Sommernachtsfestes gebraucht.
Am Freitag war großer Einkauf, am Samstag hatte man im Haus und Garten zu tun. Man scheute keine Kosten und wollte die
Der Enge und dem Mief der Subway entronnen, hatte Parzival Arthur Milton stets dort seinen Heimweg unterbrochen, auch
dann, wenn er lieber in seinen Gedanken geblieben wäre. Sobald er in die Reichweite ihres besten Distanzwerfers gekommen war,
flog ihm ihr Ball entgegen. Und Parzival dribbelte, täuschte, passte, vollendete.
Aus Kapitel 11, Teil II
Nora und Ralph hatten sich, nachdem sie wieder aus Amerika zurückgekehrt war, täglich zum Baden oder Eisessen verabredet.
Nur an zwei Tagen wurde sie, wie die Jahre zuvor, von ihren Eltern zur Vorbereitung des Sommernachtsfestes gebraucht.
Am Freitag war großer Einkauf, am Samstag hatte man im Haus und Garten zu tun. Man scheute keine Kosten und wollte die Gäste genauso verwöhnen, wie man auf deren Feste verwöhnt wurde. Doch die Spezialität, die bislang unkopiert geblieben war,
Gäste genauso verwöhnen, wie man auf deren Feste verwöhnt wurde. Doch die Spezialität, die bislang unkopiert geblieben war, durfte auch bei dieser Party nicht fehlen.
durfte auch bei dieser Party nicht fehlen.  Kaum hatte Gunther die Befürchtung beschworen: »Ihnen wird doch nicht ausgerechnet heuer etwas dazwischen gekommen
Kaum hatte Gunther die Befürchtung beschworen: »Ihnen wird doch nicht ausgerechnet heuer etwas dazwischen gekommen sein?«, rollte ein schwerer Mercedes auf die Garagenzufahrt. »Helmut und Hilde, endlich!« Gunther eilte hinaus. Noch ehe die
sein?«, rollte ein schwerer Mercedes auf die Garagenzufahrt. »Helmut und Hilde, endlich!« Gunther eilte hinaus. Noch ehe die Ankömmlinge ausgestiegen waren, bewunderte er das neue Auto. Helmut Wolf, ein gelassener und selbstbewusster Mittfünfziger,
Ankömmlinge ausgestiegen waren, bewunderte er das neue Auto. Helmut Wolf, ein gelassener und selbstbewusster Mittfünfziger, meinte, Gunther möge die Kirche im Dorf lassen, denn auch dieses funkelnagelneue und sündhaft teure Auto würde eines Tages
meinte, Gunther möge die Kirche im Dorf lassen, denn auch dieses funkelnagelneue und sündhaft teure Auto würde eines Tages genauso beim Schrotthändler enden wie der billigste und unansehnlichste Ausländer. Doch zuerst wolle er Grüß Gott sagen; er
genauso beim Schrotthändler enden wie der billigste und unansehnlichste Ausländer. Doch zuerst wolle er Grüß Gott sagen; er hoffe, alles sei wie immer in bester Ordnung. Die Kinder genössen den Rest der Ferien und des Betriebsurlaubs lieber zu Hause
hoffe, alles sei wie immer in bester Ordnung. Die Kinder genössen den Rest der Ferien und des Betriebsurlaubs lieber zu Hause mit ihren Freunden. Unser Markus wolle heuer erst einen Tag vor Schulbeginn mit dem Zug anreisen. Florence und Hilde
mit ihren Freunden. Unser Markus wolle heuer erst einen Tag vor Schulbeginn mit dem Zug anreisen. Florence und Hilde strahlten sich an. Ihrem Händedruck folgen Wangenküsschen links und rechts. »Gut siehst du aus, Hilde, richtig gut! Wie schick
strahlten sich an. Ihrem Händedruck folgen Wangenküsschen links und rechts. »Gut siehst du aus, Hilde, richtig gut! Wie schick deine Bluse ist – wo hast du sie gekauft?«, sagte Florence nachdem sie und Hilde sich umarmt hatten und diese antwortete: »Und
deine Bluse ist – wo hast du sie gekauft?«, sagte Florence nachdem sie und Hilde sich umarmt hatten und diese antwortete: »Und du umwerfend wie immer; schön dich zu sehn, Florence. Mit welcher Garderobe wirst du uns heut Abend überraschen?« Beide
du umwerfend wie immer; schön dich zu sehn, Florence. Mit welcher Garderobe wirst du uns heut Abend überraschen?« Beide lachten übers ganze Gesicht. Nora kam hinzu. Flugs deckte sie einen Gartentisch und schenkte Kaffee ein. Man plauderte,
lachten übers ganze Gesicht. Nora kam hinzu. Flugs deckte sie einen Gartentisch und schenkte Kaffee ein. Man plauderte, scherzte, erzählte Witze, lachte. Nichts als heitere Gesichter, nichts als gute Laune. Dann machte Helmut Wolf beinahe
scherzte, erzählte Witze, lachte. Nichts als heitere Gesichter, nichts als gute Laune. Dann machte Helmut Wolf beinahe überfallartig der Unterhaltung den Garaus. »Wenn man auch heuer die besten Fränkischen Bratwürste der Welt auf dem Grill
überfallartig der Unterhaltung den Garaus. »Wenn man auch heuer die besten Fränkischen Bratwürste der Welt auf dem Grill haben möchte, dann kann es bei aller Freundschaft nicht so weitergehen«, witzelte er. Alle lachten.
haben möchte, dann kann es bei aller Freundschaft nicht so weitergehen«, witzelte er. Alle lachten.  Wie von magischen Kräften gehoben, schwenkte der Kofferraumdeckel in die Höhe. Helmut Wolf pries die Güte der Waren,
Wie von magischen Kräften gehoben, schwenkte der Kofferraumdeckel in die Höhe. Helmut Wolf pries die Güte der Waren, die sich im Kofferraum befanden. Seine Art zu reden und zu gestikulieren, machte seine Aussagen unangreifbar. Weit holte er aus.
die sich im Kofferraum befanden. Seine Art zu reden und zu gestikulieren, machte seine Aussagen unangreifbar. Weit holte er aus. Bass und fränkischer Zungenschlag walzten breit dahin. In den Kühlboxen sei schlachtfrisches Schweinefleisch der höchsten
Bass und fränkischer Zungenschlag walzten breit dahin. In den Kühlboxen sei schlachtfrisches Schweinefleisch der höchsten Qualitätsstufe. Deswegen habe gestern Nachmittag ein Schwein sein Leben lassen müssen – das glückliche Schwein der
Qualitätsstufe. Deswegen habe gestern Nachmittag ein Schwein sein Leben lassen müssen – das glückliche Schwein der Oberpfälzer Bauersleute Regina und Erwin Mauderer. Für diese lege er seine Hand ins Feuer. Dieses Tier sei langsam
Oberpfälzer Bauersleute Regina und Erwin Mauderer. Für diese lege er seine Hand ins Feuer. Dieses Tier sei langsam herangereift; es habe nur bestes Futter genossen, das frei von Spritzmitteln und Medikamenten gewesen sei.
herangereift; es habe nur bestes Futter genossen, das frei von Spritzmitteln und Medikamenten gewesen sei.  Ehe die Männer anpackten, die Kühlboxen mit dem Fleisch, den Karton mit den Gewürzen, den Därmen, den Fleischwolf und,
Ehe die Männer anpackten, die Kühlboxen mit dem Fleisch, den Karton mit den Gewürzen, den Därmen, den Fleischwolf und, und, und in den Keller zu bringen, deutete Helmut Wolf auf das Bier und den Wein. Gestenreich kam er darauf zu sprechen.
und, und in den Keller zu bringen, deutete Helmut Wolf auf das Bier und den Wein. Gestenreich kam er darauf zu sprechen. Aus Kapitel 19, Teil III
Der Bus erreichte sein Ziel. Man drängte ins Freie, befand sich auf dem Parkplatz, strebte ins Herz von Wolframs-Eschenbach,
ging dort zum Wolfram-von-Eschenbach-Platz, zu Wolfram selbst, zu dessen Museum und Monument. Overesch scharte die
Kollegen um sich, deutete auf den in Bronze gegossenen Dichter. Ob sie nun Cargohosen oder enge Jeans anhatten, T-Shirts,
Tops oder luftige Sommerkleider, alle betrachteten ihn, gingen um ihn herum. Einige von ihnen lehnten sich an den Brunnen, den
ein Sockel umfing, und griffen ins kühle Nass. »Tolles Wetter erwischt«, meinte Overesch mit Blick auf Wolframs
lorbeerbekränztes Haupt.
»Kaiserwetter«, unterstrich Tonner, der anstelle von Graim ins Kollegium gekommen war, damals vor einem Jahr.
Aus Kapitel 19, Teil III
Der Bus erreichte sein Ziel. Man drängte ins Freie, befand sich auf dem Parkplatz, strebte ins Herz von Wolframs-Eschenbach,
ging dort zum Wolfram-von-Eschenbach-Platz, zu Wolfram selbst, zu dessen Museum und Monument. Overesch scharte die
Kollegen um sich, deutete auf den in Bronze gegossenen Dichter. Ob sie nun Cargohosen oder enge Jeans anhatten, T-Shirts,
Tops oder luftige Sommerkleider, alle betrachteten ihn, gingen um ihn herum. Einige von ihnen lehnten sich an den Brunnen, den
ein Sockel umfing, und griffen ins kühle Nass. »Tolles Wetter erwischt«, meinte Overesch mit Blick auf Wolframs
lorbeerbekränztes Haupt.
»Kaiserwetter«, unterstrich Tonner, der anstelle von Graim ins Kollegium gekommen war, damals vor einem Jahr. »Heiß wird´s werden«, so Florence´ Prognose.
»Heiß wird´s werden«, so Florence´ Prognose. »Für einen Schulausflug gerade recht«, meinte Kuhn.
»Für einen Schulausflug gerade recht«, meinte Kuhn. »Ist nun das Denkmal älter oder der, den es vorgibt darzustellen?«, witzelte Newperry. Man lachte.
»Ist nun das Denkmal älter oder der, den es vorgibt darzustellen?«, witzelte Newperry. Man lachte. »Seid ihr Briten uns diese Art Humor auf Schritt und Tritt schuldig?«, sagte ein anderer. Seine Pikiertheit war nicht zu
»Seid ihr Briten uns diese Art Humor auf Schritt und Tritt schuldig?«, sagte ein anderer. Seine Pikiertheit war nicht zu überhören.
überhören. »Auch nicht von schlechten Eltern«, bewies Overesch Schlagfertigkeit und grinste.
»Auch nicht von schlechten Eltern«, bewies Overesch Schlagfertigkeit und grinste. Vor dem Museum Trauben von Schülern. Eine bunte, putzmuntere Schar. Über dem Lärmpegel Gekicher, Gelächter, ab und zu
Vor dem Museum Trauben von Schülern. Eine bunte, putzmuntere Schar. Über dem Lärmpegel Gekicher, Gelächter, ab und zu ein Pfiff, Rufe. Hantieren an Rucksäcken. Man aß, trank, schob sich einen Kaugummi in den Mund; unter den Älteren sah man
ein Pfiff, Rufe. Hantieren an Rucksäcken. Man aß, trank, schob sich einen Kaugummi in den Mund; unter den Älteren sah man nicht selten eine Zigarette zwischen den Lippen hängen.
nicht selten eine Zigarette zwischen den Lippen hängen. Overesch klatschte in die Hände. Damit verschaffte er sich Gehör. Dann seine Aufforderung, die Klassen mögen sich bei ihren
Overesch klatschte in die Hände. Damit verschaffte er sich Gehör. Dann seine Aufforderung, die Klassen mögen sich bei ihren Lehrern oder Lehrerinnen sammeln. »Wird´s bald? Zigaretten aus im Museum! Verstanden?« Einige Dutzend Schritte davon
Lehrern oder Lehrerinnen sammeln. »Wird´s bald? Zigaretten aus im Museum! Verstanden?« Einige Dutzend Schritte davon entfernt eine Handvoll Leute. Ausnahmslos Erwachsene jenseits der Vierzig. Eine Bedienstete des Museums bat sie, man möge an
entfernt eine Handvoll Leute. Ausnahmslos Erwachsene jenseits der Vierzig. Eine Bedienstete des Museums bat sie, man möge an der Kasse auf sie warten. Dort gab sie ihnen mit auf den Weg: »Bis der große Ansturm kommt, wird Ihre Multimediavorführung
der Kasse auf sie warten. Dort gab sie ihnen mit auf den Weg: »Bis der große Ansturm kommt, wird Ihre Multimediavorführung zu Ende sein. Lassen Sie sich bei der Besichtigung des Museums ruhig Zeit; es wäre sonst schade …!«
zu Ende sein. Lassen Sie sich bei der Besichtigung des Museums ruhig Zeit; es wäre sonst schade …!« Das Video begann von vorne. Florence´ ließ sich Zeit, viel Zeit. Damit strapazierte sie die Geduld ihrer Klassen, das war weder
Das Video begann von vorne. Florence´ ließ sich Zeit, viel Zeit. Damit strapazierte sie die Geduld ihrer Klassen, das war weder zu überhören noch zu übersehen. Als Florence den Eindruck gewonnen hatte, dass sich in den zehn Räumen des Museums nun
zu überhören noch zu übersehen. Als Florence den Eindruck gewonnen hatte, dass sich in den zehn Räumen des Museums nun niemand mehr auf die Füße steigen konnte, führte sie die Mädchen und Jungens hinauf ins erste Stockwerk.
niemand mehr auf die Füße steigen konnte, führte sie die Mädchen und Jungens hinauf ins erste Stockwerk. Auch dort sagte sie der Eile den Kampf an. Im fünften Raum, wo der Dreh- und Angelpunkt der Parzivaldichtung gezeigt wurde,
wollte sie so lange mit dem Beginn ihrer Erläuterungen warten, bis ihre Schülerinnen und Schüler ein einminütiges Schweigen
unter Beweis gestellt hatten. Endlich war sie zufrieden. Dann zeigte Florence auf ein Graffiti, fixierte es und fragte, ohne es aus
den Augen zu lassen: »Könnt ihr das jetzt sehen?« Dann rezitierte sie: »hêrre, wie stêt iwer nôt?« Daran schloss sie Betrachtungen
an. Die Mädchen und Jungens ahnten, dass zu diesem Thema jene Fragen, die nur sie stellen konnte und worauf nur sie die
Antworten wusste, nicht mehr lange auf sich warten ließen. Sie hielt inne. Obwohl die meisten der jungen Leute nicht auf ihren
Vortrag achteten, entging ihnen nicht, dass ihre Lehrerin einen Gedanken nicht zu Ende gebracht hatte. Florence war in ein
Schweigen verfallen. Sie stand wie erstarrt da.
Auch dort sagte sie der Eile den Kampf an. Im fünften Raum, wo der Dreh- und Angelpunkt der Parzivaldichtung gezeigt wurde,
wollte sie so lange mit dem Beginn ihrer Erläuterungen warten, bis ihre Schülerinnen und Schüler ein einminütiges Schweigen
unter Beweis gestellt hatten. Endlich war sie zufrieden. Dann zeigte Florence auf ein Graffiti, fixierte es und fragte, ohne es aus
den Augen zu lassen: »Könnt ihr das jetzt sehen?« Dann rezitierte sie: »hêrre, wie stêt iwer nôt?« Daran schloss sie Betrachtungen
an. Die Mädchen und Jungens ahnten, dass zu diesem Thema jene Fragen, die nur sie stellen konnte und worauf nur sie die
Antworten wusste, nicht mehr lange auf sich warten ließen. Sie hielt inne. Obwohl die meisten der jungen Leute nicht auf ihren
Vortrag achteten, entging ihnen nicht, dass ihre Lehrerin einen Gedanken nicht zu Ende gebracht hatte. Florence war in ein
Schweigen verfallen. Sie stand wie erstarrt da.