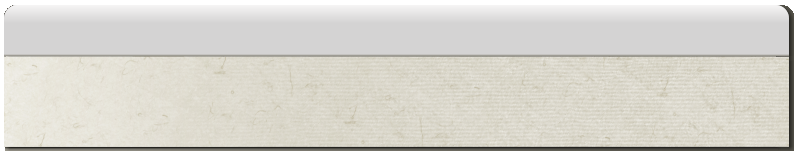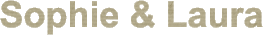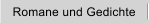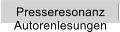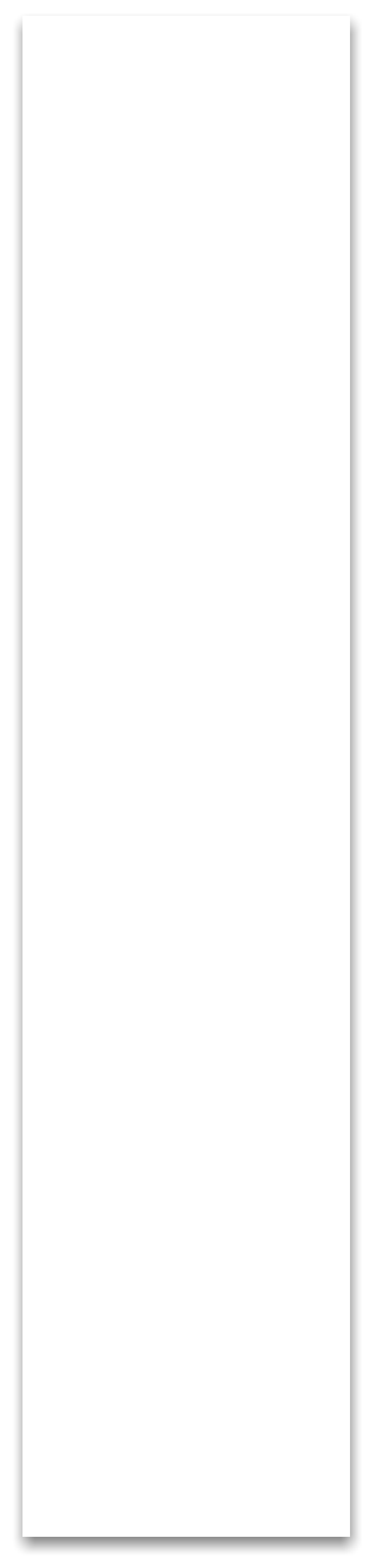
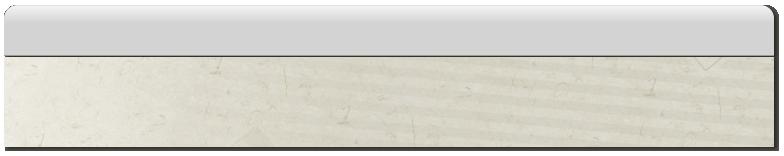

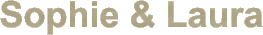
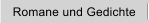
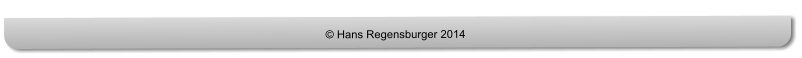
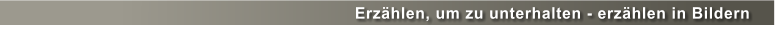 Sophie & Laura - erschienen am 27. März 2014
Roman 2014
Eine Familiengeschichte
Orte und Zeit: etwa 1987 bis 2013; München und Landkreis Neumarkt i.d.OPf. - Freystadt, Neumarkt…
286 Seiten - Textumfang ca. 76.000 Wörter
Spielberg Verlag Regensburg
ISBN 978-3-95452-645-1
12,90 Euro
Der Roman kann in jeder Buchhandlung erhalten oder bei mehreren Internetanbietern bezogen werden oder
beim Autor vor Ort gekauft oder bei ihm zu bestellt werden - Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Zum Inhalt
Ein heftiges Sommergewitter in der Nacht von Montag auf Dienstag reißt Sophie aus dem Schlaf. Die Schäden, die es an der Villa
und im parkähnlichen Garten hinterließ, und die Vorhersage weiterer Unwetter lassen sie in Rat- und Tatenlosigkeit erstarren. Doch
die Männer vor der Tür, die während dieser Tage in München Straßenarbeiten ausführen, kommen Sophie zu Hilfe. Fritz ist einer
von ihnen. Er und Sophie verlieben sich. Neun Monate danach bringt sie Laura zur Welt. Das heizt den schwelenden Streit um das
Familienerbe - die Villa, die Gemälde, die Antiquitäten - zwischen Sophie und ihren Brüdern weiter an.
Fritz, den Sophie Friedel nennt, erfährt nicht, dass er mit ihr eine Tochter hat. Das wird auch beim Standesamt nicht aktenkundig.
Zwanzig Jahre später brechen Sophie und Laura zu einer Reise in die Oberpfalz auf. Denn dort ist Friedel, ein verheirateter
Nebenerwerbslandwirt, zu Hause. Seinen Brief, den sie Jahre davor erhalten, doch nicht beantwortet hat, verschweigt sie ihrer
Tochter nach wie vor. Laura weiß nicht, dass sich ihr Vater von seiner Ehefrau trennen wollte, um mit ihrer Mutter in München zu
leben. Sophie und Laura kommen in dem Dorf in der westlichen Oberpfalz an, und eine Überraschung jagt die andere. Man hält
den Atem an.
Die Leserin und Autorin Maja Kelz schrieb: Hallo Herr Regensburger. Sie können schreiben!!! Ihr Buch hatte ich in zwei
Tagen gelesen - alle Arbeit musste hintanstehen. Die Geschichte ist in Inhalt und literarisch wunderbar erzählt. Hat Ihr
Verlag Ihnen auch einen Platz in Leipzig und Frankfurt reserviert? In Nürnberg sollten Sie sich zum Lesen im
Literaturhaus bewerben; auch bei Riedner in Altdorf. Beide Örtlichkeiten sind immer prallvoll besucht, und gekauft wird
ordentlich. Herzliche Grüße und einen wunderschönen, wenn auch heute nebligen, Tag, Maja Kelz
Wolfgang Fellner, Lokalredakteur der Neumarkter Nachrichten, schreibt über den Roman:
Gegensätze Stadt und Land
FREYSTADT - Es ist ein großes Panorama, das Hans Regensburger im neuen Roman aufspannt: Es geht um die Gegensätze
zwischen Stadt und Land, zwischen reich und arm. Bei "Freystadt liest" bekamen die Zuhörer einen ersten Eindruck aus dem
Roman, der derzeit im Entstehen ist. Die ersten drei Kapitel gab es zu hören und Hans Regensburger wurde nicht entlassen von
den Zuhörern ohne die Zusage, bald die letzten drei Kapitel des Buches nachzuliefern. Dazu erklärte sich der Mörsdorfer gerne
bereit; allerdings bat er noch um etwas Zeit: "Nächstes Jahr um dieselbe Zeit könnten wir es machen", verabschiedete er sich
lächelnd. Denn: Es sei nicht so einfach, die Vorlage, die er sich ausgedacht habe, auszuformulieren. Nachts, wenn alles zur Ruhe
kommt, bastelt er an den vielen Details seiner Figuren, an der Handlung, an den Verästelungen derselben, an den Geschehnissen.
Der Recherche bedarf es auch, alles soll stimmig sein. Autobiografisch sei da nichts, winkt er lachend ab, aber: Natürlich sind es
seine Erfahrungen und Erlebnisse, die auch Eingang finden. Beispielsweise seine Zeit als junger Mann in München, als er als
Metzger in einem Betrieb in einem recht vornehmen Viertel beschäftigt war; "die kamen nicht zum Einkaufen, da haben wir ins
Haus geliefert", sagt Regensburger. Da sah er mitten in der Großstadt Grundstücke, die einen Hektar groß waren, mit Villen und
mehr. So etwas kann dann schon in den Roman einfließen - im aktuellen ist es geschehen. Der grobe Rahmen: Regensburger,
selbst Nebenerwerbslandwirt, wollte die sozialen Verwerfungen aufzeigen, die ein Leben zwischen Land und Stadt auslösen kann.
Hauptdarsteller sind Sophie und Friedrich: sie Tochter aus reichem Haus, die aber um ihr Erbe kämpfen muss, er Landwirt aus der
Oberpfalz, der, um die Familie durchzubringen, als Bauarbeiter in der Landeshauptstadt unterwegs ist.
Die Passagen, die in Friedrichs Heimat spielen, diese Freiheit gönnt sich der Autor, spielen in Freystadt und Mörsdorf, auch wenn
Mörsdorf im Roman nicht Mörsdorf ist und auch anders aussieht. Detailliert und genau zeichnet Regensburger seine Figuren, lässt
die Handlung langsam anlaufen. Ein vielversprechender Einstieg.
Leseprobe
2. Kapitel
Sophie konnte sich nicht entschließen, das Rollo hochzuziehen. Sie war in der Nacht von einem Gewitter wach
Sophie & Laura - erschienen am 27. März 2014
Roman 2014
Eine Familiengeschichte
Orte und Zeit: etwa 1987 bis 2013; München und Landkreis Neumarkt i.d.OPf. - Freystadt, Neumarkt…
286 Seiten - Textumfang ca. 76.000 Wörter
Spielberg Verlag Regensburg
ISBN 978-3-95452-645-1
12,90 Euro
Der Roman kann in jeder Buchhandlung erhalten oder bei mehreren Internetanbietern bezogen werden oder
beim Autor vor Ort gekauft oder bei ihm zu bestellt werden - Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Zum Inhalt
Ein heftiges Sommergewitter in der Nacht von Montag auf Dienstag reißt Sophie aus dem Schlaf. Die Schäden, die es an der Villa
und im parkähnlichen Garten hinterließ, und die Vorhersage weiterer Unwetter lassen sie in Rat- und Tatenlosigkeit erstarren. Doch
die Männer vor der Tür, die während dieser Tage in München Straßenarbeiten ausführen, kommen Sophie zu Hilfe. Fritz ist einer
von ihnen. Er und Sophie verlieben sich. Neun Monate danach bringt sie Laura zur Welt. Das heizt den schwelenden Streit um das
Familienerbe - die Villa, die Gemälde, die Antiquitäten - zwischen Sophie und ihren Brüdern weiter an.
Fritz, den Sophie Friedel nennt, erfährt nicht, dass er mit ihr eine Tochter hat. Das wird auch beim Standesamt nicht aktenkundig.
Zwanzig Jahre später brechen Sophie und Laura zu einer Reise in die Oberpfalz auf. Denn dort ist Friedel, ein verheirateter
Nebenerwerbslandwirt, zu Hause. Seinen Brief, den sie Jahre davor erhalten, doch nicht beantwortet hat, verschweigt sie ihrer
Tochter nach wie vor. Laura weiß nicht, dass sich ihr Vater von seiner Ehefrau trennen wollte, um mit ihrer Mutter in München zu
leben. Sophie und Laura kommen in dem Dorf in der westlichen Oberpfalz an, und eine Überraschung jagt die andere. Man hält
den Atem an.
Die Leserin und Autorin Maja Kelz schrieb: Hallo Herr Regensburger. Sie können schreiben!!! Ihr Buch hatte ich in zwei
Tagen gelesen - alle Arbeit musste hintanstehen. Die Geschichte ist in Inhalt und literarisch wunderbar erzählt. Hat Ihr
Verlag Ihnen auch einen Platz in Leipzig und Frankfurt reserviert? In Nürnberg sollten Sie sich zum Lesen im
Literaturhaus bewerben; auch bei Riedner in Altdorf. Beide Örtlichkeiten sind immer prallvoll besucht, und gekauft wird
ordentlich. Herzliche Grüße und einen wunderschönen, wenn auch heute nebligen, Tag, Maja Kelz
Wolfgang Fellner, Lokalredakteur der Neumarkter Nachrichten, schreibt über den Roman:
Gegensätze Stadt und Land
FREYSTADT - Es ist ein großes Panorama, das Hans Regensburger im neuen Roman aufspannt: Es geht um die Gegensätze
zwischen Stadt und Land, zwischen reich und arm. Bei "Freystadt liest" bekamen die Zuhörer einen ersten Eindruck aus dem
Roman, der derzeit im Entstehen ist. Die ersten drei Kapitel gab es zu hören und Hans Regensburger wurde nicht entlassen von
den Zuhörern ohne die Zusage, bald die letzten drei Kapitel des Buches nachzuliefern. Dazu erklärte sich der Mörsdorfer gerne
bereit; allerdings bat er noch um etwas Zeit: "Nächstes Jahr um dieselbe Zeit könnten wir es machen", verabschiedete er sich
lächelnd. Denn: Es sei nicht so einfach, die Vorlage, die er sich ausgedacht habe, auszuformulieren. Nachts, wenn alles zur Ruhe
kommt, bastelt er an den vielen Details seiner Figuren, an der Handlung, an den Verästelungen derselben, an den Geschehnissen.
Der Recherche bedarf es auch, alles soll stimmig sein. Autobiografisch sei da nichts, winkt er lachend ab, aber: Natürlich sind es
seine Erfahrungen und Erlebnisse, die auch Eingang finden. Beispielsweise seine Zeit als junger Mann in München, als er als
Metzger in einem Betrieb in einem recht vornehmen Viertel beschäftigt war; "die kamen nicht zum Einkaufen, da haben wir ins
Haus geliefert", sagt Regensburger. Da sah er mitten in der Großstadt Grundstücke, die einen Hektar groß waren, mit Villen und
mehr. So etwas kann dann schon in den Roman einfließen - im aktuellen ist es geschehen. Der grobe Rahmen: Regensburger,
selbst Nebenerwerbslandwirt, wollte die sozialen Verwerfungen aufzeigen, die ein Leben zwischen Land und Stadt auslösen kann.
Hauptdarsteller sind Sophie und Friedrich: sie Tochter aus reichem Haus, die aber um ihr Erbe kämpfen muss, er Landwirt aus der
Oberpfalz, der, um die Familie durchzubringen, als Bauarbeiter in der Landeshauptstadt unterwegs ist.
Die Passagen, die in Friedrichs Heimat spielen, diese Freiheit gönnt sich der Autor, spielen in Freystadt und Mörsdorf, auch wenn
Mörsdorf im Roman nicht Mörsdorf ist und auch anders aussieht. Detailliert und genau zeichnet Regensburger seine Figuren, lässt
die Handlung langsam anlaufen. Ein vielversprechender Einstieg.
Leseprobe
2. Kapitel
Sophie konnte sich nicht entschließen, das Rollo hochzuziehen. Sie war in der Nacht von einem Gewitter wach geworden. Instinktiv hatte sie im Stockfinstern am Nachttisch ihre Brille ertastet und sie sich aufgesetzt. Doch als sie
geworden. Instinktiv hatte sie im Stockfinstern am Nachttisch ihre Brille ertastet und sie sich aufgesetzt. Doch als sie ihre Nachtischlampe anknipsen wollte, war diese genauso dunkel geblieben wie danach die große Schlafzimmerlampe
ihre Nachtischlampe anknipsen wollte, war diese genauso dunkel geblieben wie danach die große Schlafzimmerlampe und das Licht im Flur. Dort, vor ihrer Schlafzimmertür, winselte Ron. Als sie in sein weiches Fell greifen konnte und
und das Licht im Flur. Dort, vor ihrer Schlafzimmertür, winselte Ron. Als sie in sein weiches Fell greifen konnte und seine feuchte Schnauze spürte, war sie erleichtert. Obwohl er ihr nicht mehr von der Seite gewichen war, hatte sie sich
seine feuchte Schnauze spürte, war sie erleichtert. Obwohl er ihr nicht mehr von der Seite gewichen war, hatte sie sich auf der Treppe am linken Fuß den großen Zeh angestoßen. Ein Schrei war ihr entfahren, und Ron hatte versucht,
auf der Treppe am linken Fuß den großen Zeh angestoßen. Ein Schrei war ihr entfahren, und Ron hatte versucht, Sophies Fuß zu lecken.
Sophies Fuß zu lecken.  Auch im Parterre knipste sie vergeblich an den Lichtschaltern. Auf dem Flügel im Wohnzimmer wusste sie den
Auch im Parterre knipste sie vergeblich an den Lichtschaltern. Auf dem Flügel im Wohnzimmer wusste sie den schweren Silberleuchter mit einer Kerze. Auf dem Weg dorthin konnte sie am Sims über der Kachelofenfeuerung eine
schweren Silberleuchter mit einer Kerze. Auf dem Weg dorthin konnte sie am Sims über der Kachelofenfeuerung eine Schachtel Streichhölzer ertasten. »Wenigstens darauf ist Verlass, obwohl Sommer ist«, hatte sie aufgeatmet und die
Schachtel Streichhölzer ertasten. »Wenigstens darauf ist Verlass, obwohl Sommer ist«, hatte sie aufgeatmet und die Schachtel zwischen ihre Lippen geklemmt, um für den Leuchter und die Kerze beide Hände frei zu haben. Beim
Schachtel zwischen ihre Lippen geklemmt, um für den Leuchter und die Kerze beide Hände frei zu haben. Beim Entfachen der Kerze erschrak Ron. Als er sich wieder beruhigt hatte, war er im Schein des Kerzenlichts Sophie in die
Entfachen der Kerze erschrak Ron. Als er sich wieder beruhigt hatte, war er im Schein des Kerzenlichts Sophie in die Küche gefolgt. Dort meldete sich in deren großem Zeh wieder der Schmerz. Mit beiden Händen zog Sophie ihren
Küche gefolgt. Dort meldete sich in deren großem Zeh wieder der Schmerz. Mit beiden Händen zog Sophie ihren linken Fuß auf den Stuhl, den sie sich mittlerweile zurechtgerückt hatte, lehnte und entspannte dieses Bein an der
linken Fuß auf den Stuhl, den sie sich mittlerweile zurechtgerückt hatte, lehnte und entspannte dieses Bein an der Tischkante und massierte mit ihrer linken Hand den schmerzenden Zeh. Mit ihrer Rechten konnte sie nun nach Ron
Tischkante und massierte mit ihrer linken Hand den schmerzenden Zeh. Mit ihrer Rechten konnte sie nun nach Ron greifen, der auf den Stuhl rechts von ihr gesprungen war und seinen Kopf auf Sophies rechten Oberschenkel gelegt
greifen, der auf den Stuhl rechts von ihr gesprungen war und seinen Kopf auf Sophies rechten Oberschenkel gelegt hatte.
hatte. Obwohl sie ab und an auf die Uhr an der Wand geschaut hatte, erfasste sie nicht, wie lange sie bereits vor der Kerze
Obwohl sie ab und an auf die Uhr an der Wand geschaut hatte, erfasste sie nicht, wie lange sie bereits vor der Kerze saß. Zwar hatte Sophie in diesen langen Stunden immer wieder einmal erwogen, sich von ihrem Stuhl zu erheben,
saß. Zwar hatte Sophie in diesen langen Stunden immer wieder einmal erwogen, sich von ihrem Stuhl zu erheben, erneut auf einen Lichtschalter zu drücken oder auf den Knopf des Küchenradios zu tippen, um festzustellen, ob es
erneut auf einen Lichtschalter zu drücken oder auf den Knopf des Küchenradios zu tippen, um festzustellen, ob es mittlerweile wieder Strom gab, doch sie hatte es ein ums andere Mal aufgeschoben. Längst hätte sie ihren
mittlerweile wieder Strom gab, doch sie hatte es ein ums andere Mal aufgeschoben. Längst hätte sie ihren Morgenmantel und Pyjama sowie ihre Barfüßigkeit gegen Unterwäsche, Socken, Jeans, Bluse, Pullover und Schuhe
Morgenmantel und Pyjama sowie ihre Barfüßigkeit gegen Unterwäsche, Socken, Jeans, Bluse, Pullover und Schuhe tauschen können. Doch sie hatte keine Hand frei. In dieser Untätigkeit wollte sie so lange verharren, bis die Kerze
tauschen können. Doch sie hatte keine Hand frei. In dieser Untätigkeit wollte sie so lange verharren, bis die Kerze heruntergebrannt war. Obschon das Telefon, das sie neben sich auf den Tisch gestellt hatte, wie eine jungfräuliche
heruntergebrannt war. Obschon das Telefon, das sie neben sich auf den Tisch gestellt hatte, wie eine jungfräuliche Tafel ihrer Lieblingsschokolade lockte, rief sie weder ihre Mutter noch die Feuerwehr an. Nur einen weiteren Blick auf
Tafel ihrer Lieblingsschokolade lockte, rief sie weder ihre Mutter noch die Feuerwehr an. Nur einen weiteren Blick auf die Uhr erlaubte sie sich. Es war bald fünf. Nun erwog sie, zum Fenster zu gehen und das Rollo hochzuziehen, um
die Uhr erlaubte sie sich. Es war bald fünf. Nun erwog sie, zum Fenster zu gehen und das Rollo hochzuziehen, um das Licht der Frühe hereinzulassen. Doch erneut konnte sie sich dazu nicht aufraffen. Sophie erinnerte sich, dass
das Licht der Frühe hereinzulassen. Doch erneut konnte sie sich dazu nicht aufraffen. Sophie erinnerte sich, dass dieses Morgenlicht schon oftmals ihre Laune verändert hatte. Diese besondere Heiterkeit schien sich in ihrem Gesicht
dieses Morgenlicht schon oftmals ihre Laune verändert hatte. Diese besondere Heiterkeit schien sich in ihrem Gesicht gespiegelt zu haben, sonst wäre sie im Ministerium nicht jedes Mal von ihrer Sekretärin darauf angesprochen und
gespiegelt zu haben, sonst wäre sie im Ministerium nicht jedes Mal von ihrer Sekretärin darauf angesprochen und nicht selten darum beneidet worden. Doch was in der Nacht – wovon sie aus dem Schlaf gerissen wurde – von
nicht selten darum beneidet worden. Doch was in der Nacht – wovon sie aus dem Schlaf gerissen wurde – von draußen neben dem Donnern, Blitzen, Fetzen, Fauchen an beängstigenden Geräuschen zu ihr gedrungen war, schien
draußen neben dem Donnern, Blitzen, Fetzen, Fauchen an beängstigenden Geräuschen zu ihr gedrungen war, schien sie zur Tatenlosigkeit verdammt zu haben. Es nährte seitdem ihre schlimmsten Befürchtungen. Jenes Krachen,
sie zur Tatenlosigkeit verdammt zu haben. Es nährte seitdem ihre schlimmsten Befürchtungen. Jenes Krachen, Knacken, Peitschen aus dem Park hatte sie noch immer in Ohr. Plötzlich ertönte die Hausglocke. »Tatsächlich wieder
Knacken, Peitschen aus dem Park hatte sie noch immer in Ohr. Plötzlich ertönte die Hausglocke. »Tatsächlich wieder Strom«, murmelte sie vor sich hin. Sophie fuhr hoch. Ihr linkes Bein war eingeschlafen. Mit ihm verhedderte sie sich
Strom«, murmelte sie vor sich hin. Sophie fuhr hoch. Ihr linkes Bein war eingeschlafen. Mit ihm verhedderte sie sich am Telefonkabel, das vom Tisch hing und am Boden zur Steckdose an der Wand führte. Bevor der Apparat vom Tisch
am Telefonkabel, das vom Tisch hing und am Boden zur Steckdose an der Wand führte. Bevor der Apparat vom Tisch stürzen konnte, kriegte sie ihn zu fassen. »Im letzten Augenblick. Gott sei Dank!«, atmete Sophie auf. Auf dem
stürzen konnte, kriegte sie ihn zu fassen. »Im letzten Augenblick. Gott sei Dank!«, atmete Sophie auf. Auf dem weiteren Weg zur Tür musste sie sich mit der Linken am Küchenbüffet aufstützen und mit ihr an der Wand Halt
weiteren Weg zur Tür musste sie sich mit der Linken am Küchenbüffet aufstützen und mit ihr an der Wand Halt suchen, um nicht umzuknicken. »Wer kann das sein? Hoffentlich nicht die Feuerwehr, die Polizei! Bereits sieben – o
suchen, um nicht umzuknicken. »Wer kann das sein? Hoffentlich nicht die Feuerwehr, die Polizei! Bereits sieben – o Gott!« Sie knipste das Licht in der Küche an und blies die Kerze aus. Ron wich nicht von ihrer Seite, auch nicht, als sie
Gott!« Sie knipste das Licht in der Küche an und blies die Kerze aus. Ron wich nicht von ihrer Seite, auch nicht, als sie die Küchentür öffnete und in den Flur humpelte. Dort fiel das Tageslicht herein; es kam durch die Oberlichte der
die Küchentür öffnete und in den Flur humpelte. Dort fiel das Tageslicht herein; es kam durch die Oberlichte der breiten, wuchtigen Eichentür, die ihr Vater entworfen hatte. An ihr steckte der Schlüssel. Sophie schloss auf und
breiten, wuchtigen Eichentür, die ihr Vater entworfen hatte. An ihr steckte der Schlüssel. Sophie schloss auf und öffnete. Jener Mann vom Bautrupp, den sie am Freitag mit dem Opernglas beobachtet hatte, stand am Fuß des
öffnete. Jener Mann vom Bautrupp, den sie am Freitag mit dem Opernglas beobachtet hatte, stand am Fuß des rechten Flügels der Freitreppe. Sophie konnte über seinen Scheitel hinwegblicken. Robinson, ihr Kater, strich um
rechten Flügels der Freitreppe. Sophie konnte über seinen Scheitel hinwegblicken. Robinson, ihr Kater, strich um dessen Beine; eigentlich um die Sicherheitsschuhe und die Hosenbeine von dessen dunkelgrauer Arbeitshose. In der
dessen Beine; eigentlich um die Sicherheitsschuhe und die Hosenbeine von dessen dunkelgrauer Arbeitshose. In der Linken hielt der Mann einen gelben Bauhelm.
Linken hielt der Mann einen gelben Bauhelm.  »Gu Morng, entschuldigen Sie die Störung, doch Ihr Park… Ich glaub, am Freitoch hat er nu besser ausgsehn«,
»Gu Morng, entschuldigen Sie die Störung, doch Ihr Park… Ich glaub, am Freitoch hat er nu besser ausgsehn«, bedauerte der Mann mit einem vagen Lächeln um den Mund.
bedauerte der Mann mit einem vagen Lächeln um den Mund.  »O Gott, ich bin noch nicht mal angezogen, und mein Bein, es ist mir eingeschlafen!«, klagte Sophie. Der Mann
»O Gott, ich bin noch nicht mal angezogen, und mein Bein, es ist mir eingeschlafen!«, klagte Sophie. Der Mann errötete und fügte unsicher hinzu: »Entschuldigen Sie nochmals, doch ich brauche Ihre Erlaubnis.«
errötete und fügte unsicher hinzu: »Entschuldigen Sie nochmals, doch ich brauche Ihre Erlaubnis.« »Meine Erlaubnis?«
»Meine Erlaubnis?« »Sie sind doch die Eigentümerin des Anwesens – hier?«
»Sie sind doch die Eigentümerin des Anwesens – hier?« »Ja, na ja, doch – eigentlich schon!«, entpuppte sich Sophie als Spielball ihrer Ratlosigkeit.
»Ja, na ja, doch – eigentlich schon!«, entpuppte sich Sophie als Spielball ihrer Ratlosigkeit. »Wir wolln ufanga – Sie wissn schouh: Termine! Doch die drei Baijm, der Zaun…«
»Ist´s so schlimm?«
»A wo!«
»In drei Minuten bin ich draußen bei Ihnen!«
»Wir wolln ufanga – Sie wissn schouh: Termine! Doch die drei Baijm, der Zaun…«
»Ist´s so schlimm?«
»A wo!«
»In drei Minuten bin ich draußen bei Ihnen!«  Ihres Pyjamas hatte sich Sophie wenige Sekunden später entledigt. Kaum länger brauchte sie zum Zähneputzen und
Ihres Pyjamas hatte sich Sophie wenige Sekunden später entledigt. Kaum länger brauchte sie zum Zähneputzen und Waschen des Gesichts. Im Nu war sie auch in ihre Unterwäsche, in ihre blaue Lieblingsjeans geschlüpft, hatte sich
Waschen des Gesichts. Im Nu war sie auch in ihre Unterwäsche, in ihre blaue Lieblingsjeans geschlüpft, hatte sich nicht minder rasch für eine ihrer dunklen Blusen, für ihren ziegelroten Pullover sowie ihre hellbraunen Allzweckschuhe
nicht minder rasch für eine ihrer dunklen Blusen, für ihren ziegelroten Pullover sowie ihre hellbraunen Allzweckschuhe entschieden. Mit Vorliebe trug sie diese Sachen im Haus und draußen im Park. So gekleidet hörte sie nicht einmal von
entschieden. Mit Vorliebe trug sie diese Sachen im Haus und draußen im Park. So gekleidet hörte sie nicht einmal von ihrer Mutter ein kritisches Wort. So konnte sie jederzeit vor die Tür und zu Fuß in der Bäckerei am Romanplatz und der
ihrer Mutter ein kritisches Wort. So konnte sie jederzeit vor die Tür und zu Fuß in der Bäckerei am Romanplatz und der Metzgerei in der Hirschgartenallee einkaufen oder mit dem Auto zum Supermarkt fahren, um größere Anschaffungen
Metzgerei in der Hirschgartenallee einkaufen oder mit dem Auto zum Supermarkt fahren, um größere Anschaffungen zu tätigen. Doch dann warf sie einen Blick in den Spiegel. »O Gott, wie ich aussehe – schrecklich!«
zu tätigen. Doch dann warf sie einen Blick in den Spiegel. »O Gott, wie ich aussehe – schrecklich!« Während sie sich schminkte, fragte sie sich, warum sie sich schminke. »Werde ich etwa in einen meiner Hosenanzüge
schlüpfen oder eins meiner Kostüme anziehen, weil´s zur Arbeit ins Ministerium geht, um damit meiner
Während sie sich schminkte, fragte sie sich, warum sie sich schminke. »Werde ich etwa in einen meiner Hosenanzüge
schlüpfen oder eins meiner Kostüme anziehen, weil´s zur Arbeit ins Ministerium geht, um damit meiner Unscheinbarkeit, die mir Mutter attestiert, Paroli zu bieten?« Dazu gehörte, dass sie auch noch zu einem ihrer
Unscheinbarkeit, die mir Mutter attestiert, Paroli zu bieten?« Dazu gehörte, dass sie auch noch zu einem ihrer Parfumflakons griff und sich betupfte. Das wollte sie an diesem frühen Morgen unterlassen. »Auf jeden Fall!«, betonte
Parfumflakons griff und sich betupfte. Das wollte sie an diesem frühen Morgen unterlassen. »Auf jeden Fall!«, betonte sie. Doch auf dem Weg aus dem Bad machte sie kehrt und betupfte kopfschüttelnd rechts und links ihren Hals und
sie. Doch auf dem Weg aus dem Bad machte sie kehrt und betupfte kopfschüttelnd rechts und links ihren Hals und ihre Bluse oberhalb der Brust mit Parfum, wobei sie den V-Ausschnitt ihres Pullovers lupfte. »Tue ich das, um den
ihre Bluse oberhalb der Brust mit Parfum, wobei sie den V-Ausschnitt ihres Pullovers lupfte. »Tue ich das, um den Anblick des Chaos im Park hinauszuzögern?« Sie ließ diese Frage unbeantwortet. Trotzdem machte sie sich auf den
Anblick des Chaos im Park hinauszuzögern?« Sie ließ diese Frage unbeantwortet. Trotzdem machte sie sich auf den Weg dorthin. Ron wartete an der Haustür. Er blickte zu ihr hinauf und maulte. Sophie kehrte um. Der Hund folgte ihr.
Weg dorthin. Ron wartete an der Haustür. Er blickte zu ihr hinauf und maulte. Sophie kehrte um. Der Hund folgte ihr. Zurück im Bad wollte sie im Spiegelschrank nach ihrem Abschminkwasser greifen. Aber Sophie fand es in den Reihen
Zurück im Bad wollte sie im Spiegelschrank nach ihrem Abschminkwasser greifen. Aber Sophie fand es in den Reihen der Fläschchen, Tuben und Döschen nicht. Trotzdem zweifelte sie nicht daran, dass sie mit der Nase darauf stoßen
der Fläschchen, Tuben und Döschen nicht. Trotzdem zweifelte sie nicht daran, dass sie mit der Nase darauf stoßen konnte. Sie schlug den Schrank zu und griff zum Waschlappen. Doch erst, als sie fest aufdrückte, zeigten sich in ihm
konnte. Sie schlug den Schrank zu und griff zum Waschlappen. Doch erst, als sie fest aufdrückte, zeigten sich in ihm Spuren des Make-up. Nun lief ihr Gesicht glut-rot an. »O nein!«, haderte sie mit sich. »Mach ich das wegen ihm oder
Spuren des Make-up. Nun lief ihr Gesicht glut-rot an. »O nein!«, haderte sie mit sich. »Mach ich das wegen ihm oder will ich mich nur vor dem Anblick des Chaos draußen im Park drücken?« Dagegen setzte sie, ohne dass sie es wollte,
will ich mich nur vor dem Anblick des Chaos draußen im Park drücken?« Dagegen setzte sie, ohne dass sie es wollte, sein »A wo!«. Sie wusste, dass es nur eine Floskel war, um sie zu beruhigen. Doch sie schenkte ihr Glauben, obwohl
sein »A wo!«. Sie wusste, dass es nur eine Floskel war, um sie zu beruhigen. Doch sie schenkte ihr Glauben, obwohl sie wollte, dass ihr dieses »A wo.« keinen Gedanken wert wäre. Erneut begann sie sich zu schminken. Endlich machte
sie wollte, dass ihr dieses »A wo.« keinen Gedanken wert wäre. Erneut begann sie sich zu schminken. Endlich machte sich in ihr Zufriedenheit breit, und Sophie ging mit Ron in den Park. Auf dem Gehsteig hörte sie eine Schar Männer
sich in ihr Zufriedenheit breit, und Sophie ging mit Ron in den Park. Auf dem Gehsteig hörte sie eine Schar Männer plaudern. Dann erst wagte sie nach rechts zu blicken und sah die Verwüstung, die der Gewittersturm dort hinterlassen
plaudern. Dann erst wagte sie nach rechts zu blicken und sah die Verwüstung, die der Gewittersturm dort hinterlassen hatte. »O Gott, Mutter wird der Schlag treffen!«, durchfuhr es sie. »Ausgerechnet ihre drei Lieblingsbäume. Doch
hatte. »O Gott, Mutter wird der Schlag treffen!«, durchfuhr es sie. »Ausgerechnet ihre drei Lieblingsbäume. Doch meine Linde hat wie durch ein Wunder standgehalten.« Sophies Ziel war das Parktor. Es zu durchqueren, verhieß ihr,
meine Linde hat wie durch ein Wunder standgehalten.« Sophies Ziel war das Parktor. Es zu durchqueren, verhieß ihr, auch den Capo zu treffen. Zigarettenrauch schwadete zu ihr herüber. Und sie wollte sagen: »Nun hat es doch etwas
auch den Capo zu treffen. Zigarettenrauch schwadete zu ihr herüber. Und sie wollte sagen: »Nun hat es doch etwas länger gedauert.« Doch sie konnte den Mann, jenen Mann, den sie fortwährend im Kopf hatte, weder in der Gruppe
länger gedauert.« Doch sie konnte den Mann, jenen Mann, den sie fortwährend im Kopf hatte, weder in der Gruppe der plaudernden und rauchenden Arbeiter entdecken noch entlang der Nibelungenstraße, wohin ihr Auge sich stahl.
der plaudernden und rauchenden Arbeiter entdecken noch entlang der Nibelungenstraße, wohin ihr Auge sich stahl. Nun sprachen die Blicke der Bauarbeiter davon, wonach die ihrigen suchten. Denn einer von ihnen sagte: »I bin d
Nun sprachen die Blicke der Bauarbeiter davon, wonach die ihrigen suchten. Denn einer von ihnen sagte: »I bin d Hans. D Fritz – unser Capo – hat schnell af a andre Bauschtö gmyjsst.« Sophie wäre am liebsten ins Haus
Hans. D Fritz – unser Capo – hat schnell af a andre Bauschtö gmyjsst.« Sophie wäre am liebsten ins Haus zurückgerannt, hätte sich auf ihr Bett schmeißen und heulen wollen. Da kam einer von den anderen Arbeitern auf sie
zurückgerannt, hätte sich auf ihr Bett schmeißen und heulen wollen. Da kam einer von den anderen Arbeitern auf sie zu. Er erweckte den Anschein, als wollte er ihr etwas sagen; doch stattdessen griff er nach einer Schaufel, die an
zu. Er erweckte den Anschein, als wollte er ihr etwas sagen; doch stattdessen griff er nach einer Schaufel, die an einem der Bäume lehnte; sie beschatteten streckenweise den Gehsteig und die Straße. Dann vernahm Sophie von
einem der Bäume lehnte; sie beschatteten streckenweise den Gehsteig und die Straße. Dann vernahm Sophie von Hans, dass er sie im Auftrag des Capos fragen solle, ob sie ihnen erlaube, ihren Park zu betreten. »Dies wah am
Hans, dass er sie im Auftrag des Capos fragen solle, ob sie ihnen erlaube, ihren Park zu betreten. »Dies wah am gscheitastn. Dann kanntn wir nemli die drei Baijm dao oseng, die d Sturm umgschmissn hoat, und sie mit de Krona,
gscheitastn. Dann kanntn wir nemli die drei Baijm dao oseng, die d Sturm umgschmissn hoat, und sie mit de Krona, die am Gehsteig liegn, af Ihr Grundstück rucka.«
die am Gehsteig liegn, af Ihr Grundstück rucka.«  »Tatsächlich, ja!«, erwiderte Sophie.
»Das Stück Zaun ist eh beim Teifü. Wir legn Ihnen dieses vbogne Element in den Park und schlong a poor Breder dru.
»Tatsächlich, ja!«, erwiderte Sophie.
»Das Stück Zaun ist eh beim Teifü. Wir legn Ihnen dieses vbogne Element in den Park und schlong a poor Breder dru. Dann kinna S es dweil richten lassn. Des moant d Fritz – d Capo.«
Dann kinna S es dweil richten lassn. Des moant d Fritz – d Capo.« »Sie werden es schon richtig machen, denke ich«, sagte Sophie mit erstickter Stimme. Sie wandte sich um und wollte
»Sie werden es schon richtig machen, denke ich«, sagte Sophie mit erstickter Stimme. Sie wandte sich um und wollte endlich zurück in die Villa. Dabei vergewisserte sich Hans: »Sie gem uns also die Erlaubnis, dass wir in Ihren Park
endlich zurück in die Villa. Dabei vergewisserte sich Hans: »Sie gem uns also die Erlaubnis, dass wir in Ihren Park kinna und dies dann su macha?«
kinna und dies dann su macha?« »Ja, ja!«, erwiderte Sophie.
»Ja, ja!«, erwiderte Sophie.  »Sie sehn dann schouh, wenn ma fertig san«, meinte Hans.
»Sie sehn dann schouh, wenn ma fertig san«, meinte Hans.  Sophie kehrte ins Haus zurück. Dort eilte sie schnurstracks ins Bad. Was sie im Spiegel erblickte: War das sie, ihr
Sophie kehrte ins Haus zurück. Dort eilte sie schnurstracks ins Bad. Was sie im Spiegel erblickte: War das sie, ihr Gesicht? Das Kopfschütteln, das sie sah, es würde zweifelsohne zu ihr gehören, dachte sie. Über dem Rand des
Gesicht? Das Kopfschütteln, das sie sah, es würde zweifelsohne zu ihr gehören, dachte sie. Über dem Rand des Waschbeckens hing der Waschlappen, mit dem sie sich vor nicht einmal einer Viertelstunde die Schminke aus dem
Waschbeckens hing der Waschlappen, mit dem sie sich vor nicht einmal einer Viertelstunde die Schminke aus dem Gesicht gerubbelt hatte. »Nicht einmal ausge-waschen hab ich ihn.« Das holte sie nun nach. Mit einer Mischung aus
Gesicht gerubbelt hatte. »Nicht einmal ausge-waschen hab ich ihn.« Das holte sie nun nach. Mit einer Mischung aus Weinerlichkeit und Wut wischte und rieb sie sich abermals die Schminke aus dem Gesicht. Es lief krebsrot an. Sophie
Weinerlichkeit und Wut wischte und rieb sie sich abermals die Schminke aus dem Gesicht. Es lief krebsrot an. Sophie  fragte sich, weswegen sie nicht den Spiegel zertrümmere, in dem sie das erblicke; die Badtür eintrete; die nächste
fragte sich, weswegen sie nicht den Spiegel zertrümmere, in dem sie das erblicke; die Badtür eintrete; die nächste Person anspucke, die draußen ihren Weg kreuze. Solche Verrücktheiten würden ihr nie und nimmer unterlaufen; das
Person anspucke, die draußen ihren Weg kreuze. Solche Verrücktheiten würden ihr nie und nimmer unterlaufen; das wusste sie. Doch in diesem Augenblick war sie keineswegs stolz darauf; ihr Anstand erschien ihr lästig.
»Das hab ich nun davon. So kann ich nicht einmal zum Metzger und Bäcker, um ihnen eine Brotzeit zu holen, ja«,
wusste sie. Doch in diesem Augenblick war sie keineswegs stolz darauf; ihr Anstand erschien ihr lästig.
»Das hab ich nun davon. So kann ich nicht einmal zum Metzger und Bäcker, um ihnen eine Brotzeit zu holen, ja«, schimpfte sie mit sich. »Ich bin so … eine Idiotin!« Diese abschätzige Selbstbezichtigung, an die sie nicht glaubte,
schimpfte sie mit sich. »Ich bin so … eine Idiotin!« Diese abschätzige Selbstbezichtigung, an die sie nicht glaubte, schien für jeden Gedanken zu stehen, der ihr in diesen Minuten zuflog. Wehrlos war sie gegen diese Zudringlichkeiten
schien für jeden Gedanken zu stehen, der ihr in diesen Minuten zuflog. Wehrlos war sie gegen diese Zudringlichkeiten aus sich selbst, mit denen sie sich fortwährend ertappte. Warum ging in ihr plötzlich die Frage vor, ob Fritz einen
aus sich selbst, mit denen sie sich fortwährend ertappte. Warum ging in ihr plötzlich die Frage vor, ob Fritz einen Ehering trage. »Ich hätte darauf achten sollen, ja«, sagte sie sich. »Doch trägt man auf dem Bau überhaupt einen
Ehering trage. »Ich hätte darauf achten sollen, ja«, sagte sie sich. »Doch trägt man auf dem Bau überhaupt einen Ring? Könnte das nicht bei der Arbeit gefährlich werden? Warum lasse ich es zu, dass ich ihn mit ›Fritz‹ konkretisiere?
Ring? Könnte das nicht bei der Arbeit gefährlich werden? Warum lasse ich es zu, dass ich ihn mit ›Fritz‹ konkretisiere? Wenn, möchte ich ›Friedel‹ zu ihm sagen! O nein!« erwiderte sie ihrem Spiegelbild und schrie es an. Vor der Tür hörte
Wenn, möchte ich ›Friedel‹ zu ihm sagen! O nein!« erwiderte sie ihrem Spiegelbild und schrie es an. Vor der Tür hörte sie Rons verhaltenen Beller. »Wenn ich den nicht hätte?!«, dachte sie und mit einem Schmunzeln um den Mund ging
sie Rons verhaltenen Beller. »Wenn ich den nicht hätte?!«, dachte sie und mit einem Schmunzeln um den Mund ging sie zu ihm. »Komm!« Ron lief ins Wohnzimmer voraus. Vom Park drangen das Knattern und Heulen von Motorsägen
sie zu ihm. »Komm!« Ron lief ins Wohnzimmer voraus. Vom Park drangen das Knattern und Heulen von Motorsägen zu ihr, ab und an auch das laute, eintönige Brummen eines Baggers. Mit einem Blick aus dem Fenster hätte sie das
zu ihr, ab und an auch das laute, eintönige Brummen eines Baggers. Mit einem Blick aus dem Fenster hätte sie das Bild, das diese Geräusche ihr zutrugen, auf seine Richtigkeit überprüfen können. Doch sie widerstand dieser
Bild, das diese Geräusche ihr zutrugen, auf seine Richtigkeit überprüfen können. Doch sie widerstand dieser Versuchung, die sie mehr beängstigend als drängend in sich spürte. Auf dem Sofa liegend suchte ihre Rechte nach
Versuchung, die sie mehr beängstigend als drängend in sich spürte. Auf dem Sofa liegend suchte ihre Rechte nach Ron, der sich auf den Teppich gelegt hatte. Da Sophie nicht sofort den Hund ertastete, drehte sie sich auf die Seite. Der
Border-Collie lag unter dem Couchtisch. Er war mehr als einen Meter von ihr entfernt. »Na, komm schon!« Ron blickte
Ron, der sich auf den Teppich gelegt hatte. Da Sophie nicht sofort den Hund ertastete, drehte sie sich auf die Seite. Der
Border-Collie lag unter dem Couchtisch. Er war mehr als einen Meter von ihr entfernt. »Na, komm schon!« Ron blickte auf, doch er rührte sich nicht von der Stelle. Nach einer Weile legte er seinen Kopf wieder zwischen die Vorderpfoten.
auf, doch er rührte sich nicht von der Stelle. Nach einer Weile legte er seinen Kopf wieder zwischen die Vorderpfoten. »Bist du eifersüchtig, Ron?« Kein Laut entwich ihm.
»Bist du eifersüchtig, Ron?« Kein Laut entwich ihm.  ... Sie wollte ihren Blick abwenden, die Augen schließen und doch schauen; – die zersplitterten Dachlatten, die aus
... Sie wollte ihren Blick abwenden, die Augen schließen und doch schauen; – die zersplitterten Dachlatten, die aus ihren Verzapfungen gerissenen Balken, die ramponierten Dächer, die entwurzelten Bäume, den beschädigten Zaun
ihren Verzapfungen gerissenen Balken, die ramponierten Dächer, die entwurzelten Bäume, den beschädigten Zaun sehen und doch nicht sehen; diesen gespenstischen Anblick als bösen Traum entlarven. »Das ist ja entsetzlich«,
sehen und doch nicht sehen; diesen gespenstischen Anblick als bösen Traum entlarven. »Das ist ja entsetzlich«, keuchte sie mit tränenerstickter Stimme.
Sie rannte zurück ins Haus. Um nicht das Opfer eines Nervenzusammenbruchs zu werden, musste sie etwas tun und
keuchte sie mit tränenerstickter Stimme.
Sie rannte zurück ins Haus. Um nicht das Opfer eines Nervenzusammenbruchs zu werden, musste sie etwas tun und rief jene Maurer-, Dachdecker- und Gartenbaubetriebe an, die schon ihr Vater mit Arbeiten beauftragt hatte. Man
rief jene Maurer-, Dachdecker- und Gartenbaubetriebe an, die schon ihr Vater mit Arbeiten beauftragt hatte. Man vertröstete sie auf die nächste, wenn nicht die übernächste Woche. Dann versuchte sie ihr Glück bei der Feuerwehr
vertröstete sie auf die nächste, wenn nicht die übernächste Woche. Dann versuchte sie ihr Glück bei der Feuerwehr und hörte, man wolle in einigen Tagen die Schäden provisorisch mit Planen abdecken. Sophie war verzweifelt. Sie
und hörte, man wolle in einigen Tagen die Schäden provisorisch mit Planen abdecken. Sophie war verzweifelt. Sie blickte auf die Uhr. »Bald neun«, sagte sie vor sich hin und schaltete in der Küche das Radio ein. Der Wetterbericht
blickte auf die Uhr. »Bald neun«, sagte sie vor sich hin und schaltete in der Küche das Radio ein. Der Wetterbericht meldete bereits für Donnerstag wieder Gewitter und Starkregen. Sie wunderte sich, dass ihre Mutter noch nicht
meldete bereits für Donnerstag wieder Gewitter und Starkregen. Sie wunderte sich, dass ihre Mutter noch nicht angerufen hatte. »Ihr entgeht keine Nachrichtensendung. Vielleicht war es diesmal anders. Ich wüsste nicht, wie ich ihr
angerufen hatte. »Ihr entgeht keine Nachrichtensendung. Vielleicht war es diesmal anders. Ich wüsste nicht, wie ich ihr diese schlimmen Schäden verheimlichen oder erklären könnte.« Erneut ging sie nach draußen. Beim Anblick des
diese schlimmen Schäden verheimlichen oder erklären könnte.« Erneut ging sie nach draußen. Beim Anblick des Durcheinanders weinte sie abermals. Plötzlich stand der Capo vor ihr. Wie aus dem Nichts war er vor ihr aufgetaucht.
Durcheinanders weinte sie abermals. Plötzlich stand der Capo vor ihr. Wie aus dem Nichts war er vor ihr aufgetaucht. In den letzten Minuten hatte sie nicht mehr an ihn gedacht. Nun wurde sie für Augenblicke von purer Verzweiflung
In den letzten Minuten hatte sie nicht mehr an ihn gedacht. Nun wurde sie für Augenblicke von purer Verzweiflung  beherrscht. Vor allem, weil er sie in diesem Zustand überraschte – sie weinen sah. Doch kaum weniger, weil sie sich
beherrscht. Vor allem, weil er sie in diesem Zustand überraschte – sie weinen sah. Doch kaum weniger, weil sie sich ihm in all ihrer Unscheinbarkeit ausgeliefert glaubte. »Ich dumme Kuh, warum hab ich mich abgeschminkt, warum
ihm in all ihrer Unscheinbarkeit ausgeliefert glaubte. »Ich dumme Kuh, warum hab ich mich abgeschminkt, warum nur?« Dann begann er zu reden, und sie fühlte sich besser. »Schlimmer als ich zunächst dachte«, sagte er im
nur?« Dann begann er zu reden, und sie fühlte sich besser. »Schlimmer als ich zunächst dachte«, sagte er im Unterton einer Herausforderung. Sophie hing an seinen Lippen und brachte kein Wort heraus. »Die Schäden sind
Unterton einer Herausforderung. Sophie hing an seinen Lippen und brachte kein Wort heraus. »Die Schäden sind nicht allgemein, sondern vereinzelt wie hintupft – dao amal und dao amal. Der Strom war auch länger weg, ho i ghört.
nicht allgemein, sondern vereinzelt wie hintupft – dao amal und dao amal. Der Strom war auch länger weg, ho i ghört. Beim Umspannwerk draußen solln wie hier die Fetzen gflung seij«, erzählte der Capo. »Er hatte hier freie Bahn, der
Beim Umspannwerk draußen solln wie hier die Fetzen gflung seij«, erzählte der Capo. »Er hatte hier freie Bahn, der Sturm; in der ganzen Umgebung nur hier; wahrscheinlich eine Windhose von vierzig, fünfzig Metern Breite«, erklärte
Sturm; in der ganzen Umgebung nur hier; wahrscheinlich eine Windhose von vierzig, fünfzig Metern Breite«, erklärte der Capo und schilderte im selben Atemzug mit seinen Händen und Armen den Zug des Unwetters von Westen nach
der Capo und schilderte im selben Atemzug mit seinen Händen und Armen den Zug des Unwetters von Westen nach Osten. »Ich muss mich noch bei Ihnen bedanken!«, fuhr er fort. »Hätten Sie uns nicht in Ihren Park gelassen, hätten
Osten. »Ich muss mich noch bei Ihnen bedanken!«, fuhr er fort. »Hätten Sie uns nicht in Ihren Park gelassen, hätten wir wahrscheinlich erst morgen draußen mit dem Ausheben des nächsten Teilstücks beginnen können. Vielleicht
wir wahrscheinlich erst morgen draußen mit dem Ausheben des nächsten Teilstücks beginnen können. Vielleicht können wir uns revanchieren?« Sophie war verblüfft. »Revanchieren?«, dachte sie und ihre Wortlosigkeit gab
können wir uns revanchieren?« Sophie war verblüfft. »Revanchieren?«, dachte sie und ihre Wortlosigkeit gab gleichzeitig ihre Verwirrtheit und Ratlosigkeit wider. »Vielleicht können wir ja etwas für Sie tun.« Während der Capo
gleichzeitig ihre Verwirrtheit und Ratlosigkeit wider. »Vielleicht können wir ja etwas für Sie tun.« Während der Capo das sagte, streifte sein Blick die Verwüstung im Park und an den Gebäuden. Sophie nickte. In ihrer Verlegenheit
das sagte, streifte sein Blick die Verwüstung im Park und an den Gebäuden. Sophie nickte. In ihrer Verlegenheit lächelte sie zaghaft. Das bemerkte der Capo. »Schwül ist´s wieder geworden, und diese stechende Sonne verheißt
lächelte sie zaghaft. Das bemerkte der Capo. »Schwül ist´s wieder geworden, und diese stechende Sonne verheißt nichts Gutes. Übrigens, Fink, Friedrich.« Während er das sagte, streckte er ihr seine Rechte hin. Sophie glaubte in ihrer
Hand etwas unglaublich Zupackendes und Vertrauenswürdiges zu spüren. Nach einer Weile erwiderte sie: »Sophie
nichts Gutes. Übrigens, Fink, Friedrich.« Während er das sagte, streckte er ihr seine Rechte hin. Sophie glaubte in ihrer
Hand etwas unglaublich Zupackendes und Vertrauenswürdiges zu spüren. Nach einer Weile erwiderte sie: »Sophie Reischl.« Dabei errötete sie und fügte hinzu: »Es ist tatsächlich sehr schwül. Und ich hab einen Pullover an –
Reischl.« Dabei errötete sie und fügte hinzu: »Es ist tatsächlich sehr schwül. Und ich hab einen Pullover an – wahrscheinlich vor Aufregung.« Der Capo lächelte, zuckte ansatzweise die Achseln, räkelte ein wenig mit den
wahrscheinlich vor Aufregung.« Der Capo lächelte, zuckte ansatzweise die Achseln, räkelte ein wenig mit den Schultern und zog an seiner Zigarette. »Wenn Sie Hilfe brauchen, dann…«, erklärte er; und seine Handbewegungen,
Schultern und zog an seiner Zigarette. »Wenn Sie Hilfe brauchen, dann…«, erklärte er; und seine Handbewegungen, die er dabei gebrauchte, schienen die Schäden in ein Paket zu schnüren.
die er dabei gebrauchte, schienen die Schäden in ein Paket zu schnüren.  »Sie könnten das tatsächlich…?« ...
»Sie könnten das tatsächlich…?« ... 3. Kapitel
Doch Sophie erschrak über das, was sie gesagt hatte. »O Gott, ich personifizierte Unromantik! Warum falle ich ihm ins
3. Kapitel
Doch Sophie erschrak über das, was sie gesagt hatte. »O Gott, ich personifizierte Unromantik! Warum falle ich ihm ins Wort und sage so etwas und nicht das, woran ich ihn am Aussprechen gehindert habe? Mir ist nicht zu helfen!«, ging
Wort und sage so etwas und nicht das, woran ich ihn am Aussprechen gehindert habe? Mir ist nicht zu helfen!«, ging sie mit sich ins Gericht und hoffte, dass er nun seinen Satz zu Ende bringen würde. Doch der Capo schwieg. Plötzlich
sie mit sich ins Gericht und hoffte, dass er nun seinen Satz zu Ende bringen würde. Doch der Capo schwieg. Plötzlich nahm er ihre Rechte, die sie intuitiv fächerte, und führte sie an seine linke Brust.
nahm er ihre Rechte, die sie intuitiv fächerte, und führte sie an seine linke Brust.
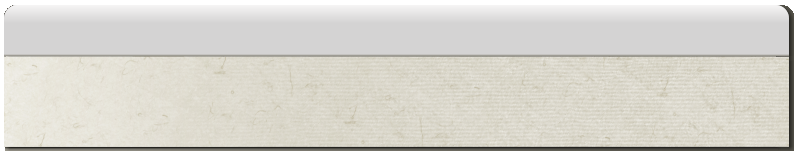

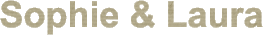



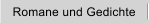
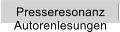



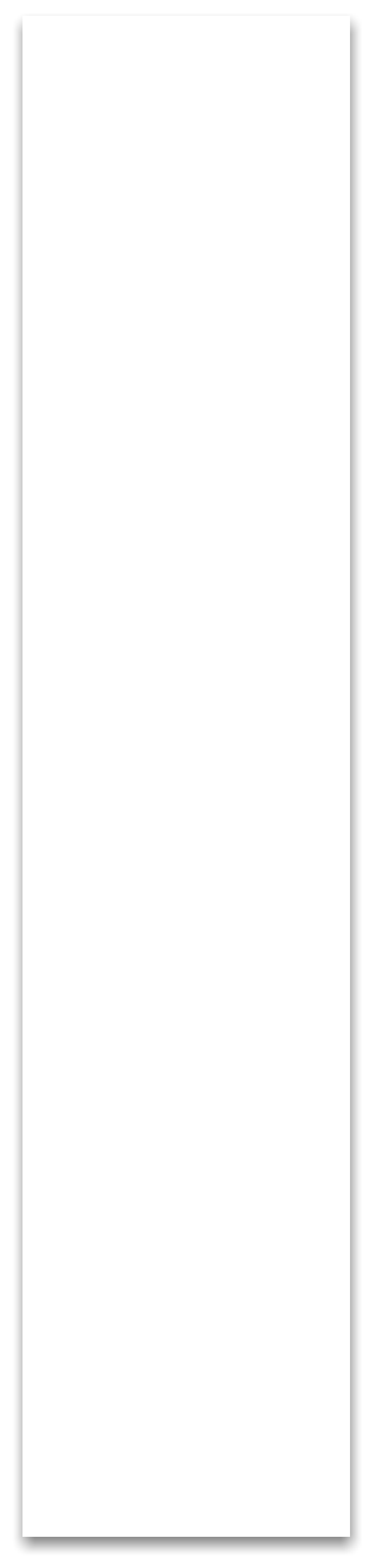
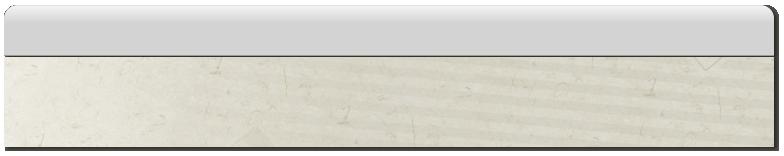

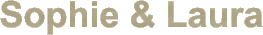
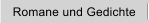
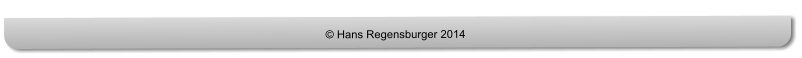
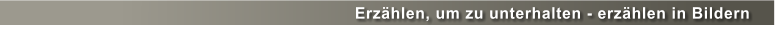 Sophie & Laura - erschienen am 27. März 2014
Roman 2014
Eine Familiengeschichte
Orte und Zeit: etwa 1987 bis 2013; München und Landkreis Neumarkt i.d.OPf. - Freystadt, Neumarkt…
286 Seiten - Textumfang ca. 76.000 Wörter
Spielberg Verlag Regensburg
ISBN 978-3-95452-645-1
12,90 Euro
Der Roman kann in jeder Buchhandlung erhalten oder bei mehreren Internetanbietern bezogen werden oder
beim Autor vor Ort gekauft oder bei ihm zu bestellt werden - Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Zum Inhalt
Ein heftiges Sommergewitter in der Nacht von Montag auf Dienstag reißt Sophie aus dem Schlaf. Die Schäden, die es an der Villa
und im parkähnlichen Garten hinterließ, und die Vorhersage weiterer Unwetter lassen sie in Rat- und Tatenlosigkeit erstarren. Doch
die Männer vor der Tür, die während dieser Tage in München Straßenarbeiten ausführen, kommen Sophie zu Hilfe. Fritz ist einer
von ihnen. Er und Sophie verlieben sich. Neun Monate danach bringt sie Laura zur Welt. Das heizt den schwelenden Streit um das
Familienerbe - die Villa, die Gemälde, die Antiquitäten - zwischen Sophie und ihren Brüdern weiter an.
Fritz, den Sophie Friedel nennt, erfährt nicht, dass er mit ihr eine Tochter hat. Das wird auch beim Standesamt nicht aktenkundig.
Zwanzig Jahre später brechen Sophie und Laura zu einer Reise in die Oberpfalz auf. Denn dort ist Friedel, ein verheirateter
Nebenerwerbslandwirt, zu Hause. Seinen Brief, den sie Jahre davor erhalten, doch nicht beantwortet hat, verschweigt sie ihrer
Tochter nach wie vor. Laura weiß nicht, dass sich ihr Vater von seiner Ehefrau trennen wollte, um mit ihrer Mutter in München zu
leben. Sophie und Laura kommen in dem Dorf in der westlichen Oberpfalz an, und eine Überraschung jagt die andere. Man hält
den Atem an.
Die Leserin und Autorin Maja Kelz schrieb: Hallo Herr Regensburger. Sie können schreiben!!! Ihr Buch hatte ich in zwei
Tagen gelesen - alle Arbeit musste hintanstehen. Die Geschichte ist in Inhalt und literarisch wunderbar erzählt. Hat Ihr
Verlag Ihnen auch einen Platz in Leipzig und Frankfurt reserviert? In Nürnberg sollten Sie sich zum Lesen im
Literaturhaus bewerben; auch bei Riedner in Altdorf. Beide Örtlichkeiten sind immer prallvoll besucht, und gekauft wird
ordentlich. Herzliche Grüße und einen wunderschönen, wenn auch heute nebligen, Tag, Maja Kelz
Wolfgang Fellner, Lokalredakteur der Neumarkter Nachrichten, schreibt über den Roman:
Gegensätze Stadt und Land
FREYSTADT - Es ist ein großes Panorama, das Hans Regensburger im neuen Roman aufspannt: Es geht um die Gegensätze
zwischen Stadt und Land, zwischen reich und arm. Bei "Freystadt liest" bekamen die Zuhörer einen ersten Eindruck aus dem
Roman, der derzeit im Entstehen ist. Die ersten drei Kapitel gab es zu hören und Hans Regensburger wurde nicht entlassen von
den Zuhörern ohne die Zusage, bald die letzten drei Kapitel des Buches nachzuliefern. Dazu erklärte sich der Mörsdorfer gerne
bereit; allerdings bat er noch um etwas Zeit: "Nächstes Jahr um dieselbe Zeit könnten wir es machen", verabschiedete er sich
lächelnd. Denn: Es sei nicht so einfach, die Vorlage, die er sich ausgedacht habe, auszuformulieren. Nachts, wenn alles zur Ruhe
kommt, bastelt er an den vielen Details seiner Figuren, an der Handlung, an den Verästelungen derselben, an den Geschehnissen.
Der Recherche bedarf es auch, alles soll stimmig sein. Autobiografisch sei da nichts, winkt er lachend ab, aber: Natürlich sind es
seine Erfahrungen und Erlebnisse, die auch Eingang finden. Beispielsweise seine Zeit als junger Mann in München, als er als
Metzger in einem Betrieb in einem recht vornehmen Viertel beschäftigt war; "die kamen nicht zum Einkaufen, da haben wir ins
Haus geliefert", sagt Regensburger. Da sah er mitten in der Großstadt Grundstücke, die einen Hektar groß waren, mit Villen und
mehr. So etwas kann dann schon in den Roman einfließen - im aktuellen ist es geschehen. Der grobe Rahmen: Regensburger,
selbst Nebenerwerbslandwirt, wollte die sozialen Verwerfungen aufzeigen, die ein Leben zwischen Land und Stadt auslösen kann.
Hauptdarsteller sind Sophie und Friedrich: sie Tochter aus reichem Haus, die aber um ihr Erbe kämpfen muss, er Landwirt aus der
Oberpfalz, der, um die Familie durchzubringen, als Bauarbeiter in der Landeshauptstadt unterwegs ist.
Die Passagen, die in Friedrichs Heimat spielen, diese Freiheit gönnt sich der Autor, spielen in Freystadt und Mörsdorf, auch wenn
Mörsdorf im Roman nicht Mörsdorf ist und auch anders aussieht. Detailliert und genau zeichnet Regensburger seine Figuren, lässt
die Handlung langsam anlaufen. Ein vielversprechender Einstieg.
Leseprobe
2. Kapitel
Sophie konnte sich nicht entschließen, das Rollo hochzuziehen. Sie war in der Nacht von einem Gewitter wach
Sophie & Laura - erschienen am 27. März 2014
Roman 2014
Eine Familiengeschichte
Orte und Zeit: etwa 1987 bis 2013; München und Landkreis Neumarkt i.d.OPf. - Freystadt, Neumarkt…
286 Seiten - Textumfang ca. 76.000 Wörter
Spielberg Verlag Regensburg
ISBN 978-3-95452-645-1
12,90 Euro
Der Roman kann in jeder Buchhandlung erhalten oder bei mehreren Internetanbietern bezogen werden oder
beim Autor vor Ort gekauft oder bei ihm zu bestellt werden - Versand vom Autor mit Portoaufschlag.
Zum Inhalt
Ein heftiges Sommergewitter in der Nacht von Montag auf Dienstag reißt Sophie aus dem Schlaf. Die Schäden, die es an der Villa
und im parkähnlichen Garten hinterließ, und die Vorhersage weiterer Unwetter lassen sie in Rat- und Tatenlosigkeit erstarren. Doch
die Männer vor der Tür, die während dieser Tage in München Straßenarbeiten ausführen, kommen Sophie zu Hilfe. Fritz ist einer
von ihnen. Er und Sophie verlieben sich. Neun Monate danach bringt sie Laura zur Welt. Das heizt den schwelenden Streit um das
Familienerbe - die Villa, die Gemälde, die Antiquitäten - zwischen Sophie und ihren Brüdern weiter an.
Fritz, den Sophie Friedel nennt, erfährt nicht, dass er mit ihr eine Tochter hat. Das wird auch beim Standesamt nicht aktenkundig.
Zwanzig Jahre später brechen Sophie und Laura zu einer Reise in die Oberpfalz auf. Denn dort ist Friedel, ein verheirateter
Nebenerwerbslandwirt, zu Hause. Seinen Brief, den sie Jahre davor erhalten, doch nicht beantwortet hat, verschweigt sie ihrer
Tochter nach wie vor. Laura weiß nicht, dass sich ihr Vater von seiner Ehefrau trennen wollte, um mit ihrer Mutter in München zu
leben. Sophie und Laura kommen in dem Dorf in der westlichen Oberpfalz an, und eine Überraschung jagt die andere. Man hält
den Atem an.
Die Leserin und Autorin Maja Kelz schrieb: Hallo Herr Regensburger. Sie können schreiben!!! Ihr Buch hatte ich in zwei
Tagen gelesen - alle Arbeit musste hintanstehen. Die Geschichte ist in Inhalt und literarisch wunderbar erzählt. Hat Ihr
Verlag Ihnen auch einen Platz in Leipzig und Frankfurt reserviert? In Nürnberg sollten Sie sich zum Lesen im
Literaturhaus bewerben; auch bei Riedner in Altdorf. Beide Örtlichkeiten sind immer prallvoll besucht, und gekauft wird
ordentlich. Herzliche Grüße und einen wunderschönen, wenn auch heute nebligen, Tag, Maja Kelz
Wolfgang Fellner, Lokalredakteur der Neumarkter Nachrichten, schreibt über den Roman:
Gegensätze Stadt und Land
FREYSTADT - Es ist ein großes Panorama, das Hans Regensburger im neuen Roman aufspannt: Es geht um die Gegensätze
zwischen Stadt und Land, zwischen reich und arm. Bei "Freystadt liest" bekamen die Zuhörer einen ersten Eindruck aus dem
Roman, der derzeit im Entstehen ist. Die ersten drei Kapitel gab es zu hören und Hans Regensburger wurde nicht entlassen von
den Zuhörern ohne die Zusage, bald die letzten drei Kapitel des Buches nachzuliefern. Dazu erklärte sich der Mörsdorfer gerne
bereit; allerdings bat er noch um etwas Zeit: "Nächstes Jahr um dieselbe Zeit könnten wir es machen", verabschiedete er sich
lächelnd. Denn: Es sei nicht so einfach, die Vorlage, die er sich ausgedacht habe, auszuformulieren. Nachts, wenn alles zur Ruhe
kommt, bastelt er an den vielen Details seiner Figuren, an der Handlung, an den Verästelungen derselben, an den Geschehnissen.
Der Recherche bedarf es auch, alles soll stimmig sein. Autobiografisch sei da nichts, winkt er lachend ab, aber: Natürlich sind es
seine Erfahrungen und Erlebnisse, die auch Eingang finden. Beispielsweise seine Zeit als junger Mann in München, als er als
Metzger in einem Betrieb in einem recht vornehmen Viertel beschäftigt war; "die kamen nicht zum Einkaufen, da haben wir ins
Haus geliefert", sagt Regensburger. Da sah er mitten in der Großstadt Grundstücke, die einen Hektar groß waren, mit Villen und
mehr. So etwas kann dann schon in den Roman einfließen - im aktuellen ist es geschehen. Der grobe Rahmen: Regensburger,
selbst Nebenerwerbslandwirt, wollte die sozialen Verwerfungen aufzeigen, die ein Leben zwischen Land und Stadt auslösen kann.
Hauptdarsteller sind Sophie und Friedrich: sie Tochter aus reichem Haus, die aber um ihr Erbe kämpfen muss, er Landwirt aus der
Oberpfalz, der, um die Familie durchzubringen, als Bauarbeiter in der Landeshauptstadt unterwegs ist.
Die Passagen, die in Friedrichs Heimat spielen, diese Freiheit gönnt sich der Autor, spielen in Freystadt und Mörsdorf, auch wenn
Mörsdorf im Roman nicht Mörsdorf ist und auch anders aussieht. Detailliert und genau zeichnet Regensburger seine Figuren, lässt
die Handlung langsam anlaufen. Ein vielversprechender Einstieg.
Leseprobe
2. Kapitel
Sophie konnte sich nicht entschließen, das Rollo hochzuziehen. Sie war in der Nacht von einem Gewitter wach geworden. Instinktiv hatte sie im Stockfinstern am Nachttisch ihre Brille ertastet und sie sich aufgesetzt. Doch als sie
geworden. Instinktiv hatte sie im Stockfinstern am Nachttisch ihre Brille ertastet und sie sich aufgesetzt. Doch als sie ihre Nachtischlampe anknipsen wollte, war diese genauso dunkel geblieben wie danach die große Schlafzimmerlampe
ihre Nachtischlampe anknipsen wollte, war diese genauso dunkel geblieben wie danach die große Schlafzimmerlampe und das Licht im Flur. Dort, vor ihrer Schlafzimmertür, winselte Ron. Als sie in sein weiches Fell greifen konnte und
und das Licht im Flur. Dort, vor ihrer Schlafzimmertür, winselte Ron. Als sie in sein weiches Fell greifen konnte und seine feuchte Schnauze spürte, war sie erleichtert. Obwohl er ihr nicht mehr von der Seite gewichen war, hatte sie sich
seine feuchte Schnauze spürte, war sie erleichtert. Obwohl er ihr nicht mehr von der Seite gewichen war, hatte sie sich auf der Treppe am linken Fuß den großen Zeh angestoßen. Ein Schrei war ihr entfahren, und Ron hatte versucht,
auf der Treppe am linken Fuß den großen Zeh angestoßen. Ein Schrei war ihr entfahren, und Ron hatte versucht, Sophies Fuß zu lecken.
Sophies Fuß zu lecken.  Auch im Parterre knipste sie vergeblich an den Lichtschaltern. Auf dem Flügel im Wohnzimmer wusste sie den
Auch im Parterre knipste sie vergeblich an den Lichtschaltern. Auf dem Flügel im Wohnzimmer wusste sie den schweren Silberleuchter mit einer Kerze. Auf dem Weg dorthin konnte sie am Sims über der Kachelofenfeuerung eine
schweren Silberleuchter mit einer Kerze. Auf dem Weg dorthin konnte sie am Sims über der Kachelofenfeuerung eine Schachtel Streichhölzer ertasten. »Wenigstens darauf ist Verlass, obwohl Sommer ist«, hatte sie aufgeatmet und die
Schachtel Streichhölzer ertasten. »Wenigstens darauf ist Verlass, obwohl Sommer ist«, hatte sie aufgeatmet und die Schachtel zwischen ihre Lippen geklemmt, um für den Leuchter und die Kerze beide Hände frei zu haben. Beim
Schachtel zwischen ihre Lippen geklemmt, um für den Leuchter und die Kerze beide Hände frei zu haben. Beim Entfachen der Kerze erschrak Ron. Als er sich wieder beruhigt hatte, war er im Schein des Kerzenlichts Sophie in die
Entfachen der Kerze erschrak Ron. Als er sich wieder beruhigt hatte, war er im Schein des Kerzenlichts Sophie in die Küche gefolgt. Dort meldete sich in deren großem Zeh wieder der Schmerz. Mit beiden Händen zog Sophie ihren
Küche gefolgt. Dort meldete sich in deren großem Zeh wieder der Schmerz. Mit beiden Händen zog Sophie ihren linken Fuß auf den Stuhl, den sie sich mittlerweile zurechtgerückt hatte, lehnte und entspannte dieses Bein an der
linken Fuß auf den Stuhl, den sie sich mittlerweile zurechtgerückt hatte, lehnte und entspannte dieses Bein an der Tischkante und massierte mit ihrer linken Hand den schmerzenden Zeh. Mit ihrer Rechten konnte sie nun nach Ron
Tischkante und massierte mit ihrer linken Hand den schmerzenden Zeh. Mit ihrer Rechten konnte sie nun nach Ron greifen, der auf den Stuhl rechts von ihr gesprungen war und seinen Kopf auf Sophies rechten Oberschenkel gelegt
greifen, der auf den Stuhl rechts von ihr gesprungen war und seinen Kopf auf Sophies rechten Oberschenkel gelegt hatte.
hatte. Obwohl sie ab und an auf die Uhr an der Wand geschaut hatte, erfasste sie nicht, wie lange sie bereits vor der Kerze
Obwohl sie ab und an auf die Uhr an der Wand geschaut hatte, erfasste sie nicht, wie lange sie bereits vor der Kerze saß. Zwar hatte Sophie in diesen langen Stunden immer wieder einmal erwogen, sich von ihrem Stuhl zu erheben,
saß. Zwar hatte Sophie in diesen langen Stunden immer wieder einmal erwogen, sich von ihrem Stuhl zu erheben, erneut auf einen Lichtschalter zu drücken oder auf den Knopf des Küchenradios zu tippen, um festzustellen, ob es
erneut auf einen Lichtschalter zu drücken oder auf den Knopf des Küchenradios zu tippen, um festzustellen, ob es mittlerweile wieder Strom gab, doch sie hatte es ein ums andere Mal aufgeschoben. Längst hätte sie ihren
mittlerweile wieder Strom gab, doch sie hatte es ein ums andere Mal aufgeschoben. Längst hätte sie ihren Morgenmantel und Pyjama sowie ihre Barfüßigkeit gegen Unterwäsche, Socken, Jeans, Bluse, Pullover und Schuhe
Morgenmantel und Pyjama sowie ihre Barfüßigkeit gegen Unterwäsche, Socken, Jeans, Bluse, Pullover und Schuhe tauschen können. Doch sie hatte keine Hand frei. In dieser Untätigkeit wollte sie so lange verharren, bis die Kerze
tauschen können. Doch sie hatte keine Hand frei. In dieser Untätigkeit wollte sie so lange verharren, bis die Kerze heruntergebrannt war. Obschon das Telefon, das sie neben sich auf den Tisch gestellt hatte, wie eine jungfräuliche
heruntergebrannt war. Obschon das Telefon, das sie neben sich auf den Tisch gestellt hatte, wie eine jungfräuliche Tafel ihrer Lieblingsschokolade lockte, rief sie weder ihre Mutter noch die Feuerwehr an. Nur einen weiteren Blick auf
Tafel ihrer Lieblingsschokolade lockte, rief sie weder ihre Mutter noch die Feuerwehr an. Nur einen weiteren Blick auf die Uhr erlaubte sie sich. Es war bald fünf. Nun erwog sie, zum Fenster zu gehen und das Rollo hochzuziehen, um
die Uhr erlaubte sie sich. Es war bald fünf. Nun erwog sie, zum Fenster zu gehen und das Rollo hochzuziehen, um das Licht der Frühe hereinzulassen. Doch erneut konnte sie sich dazu nicht aufraffen. Sophie erinnerte sich, dass
das Licht der Frühe hereinzulassen. Doch erneut konnte sie sich dazu nicht aufraffen. Sophie erinnerte sich, dass dieses Morgenlicht schon oftmals ihre Laune verändert hatte. Diese besondere Heiterkeit schien sich in ihrem Gesicht
dieses Morgenlicht schon oftmals ihre Laune verändert hatte. Diese besondere Heiterkeit schien sich in ihrem Gesicht gespiegelt zu haben, sonst wäre sie im Ministerium nicht jedes Mal von ihrer Sekretärin darauf angesprochen und
gespiegelt zu haben, sonst wäre sie im Ministerium nicht jedes Mal von ihrer Sekretärin darauf angesprochen und nicht selten darum beneidet worden. Doch was in der Nacht – wovon sie aus dem Schlaf gerissen wurde – von
nicht selten darum beneidet worden. Doch was in der Nacht – wovon sie aus dem Schlaf gerissen wurde – von draußen neben dem Donnern, Blitzen, Fetzen, Fauchen an beängstigenden Geräuschen zu ihr gedrungen war, schien
draußen neben dem Donnern, Blitzen, Fetzen, Fauchen an beängstigenden Geräuschen zu ihr gedrungen war, schien sie zur Tatenlosigkeit verdammt zu haben. Es nährte seitdem ihre schlimmsten Befürchtungen. Jenes Krachen,
sie zur Tatenlosigkeit verdammt zu haben. Es nährte seitdem ihre schlimmsten Befürchtungen. Jenes Krachen, Knacken, Peitschen aus dem Park hatte sie noch immer in Ohr. Plötzlich ertönte die Hausglocke. »Tatsächlich wieder
Knacken, Peitschen aus dem Park hatte sie noch immer in Ohr. Plötzlich ertönte die Hausglocke. »Tatsächlich wieder Strom«, murmelte sie vor sich hin. Sophie fuhr hoch. Ihr linkes Bein war eingeschlafen. Mit ihm verhedderte sie sich
Strom«, murmelte sie vor sich hin. Sophie fuhr hoch. Ihr linkes Bein war eingeschlafen. Mit ihm verhedderte sie sich am Telefonkabel, das vom Tisch hing und am Boden zur Steckdose an der Wand führte. Bevor der Apparat vom Tisch
am Telefonkabel, das vom Tisch hing und am Boden zur Steckdose an der Wand führte. Bevor der Apparat vom Tisch stürzen konnte, kriegte sie ihn zu fassen. »Im letzten Augenblick. Gott sei Dank!«, atmete Sophie auf. Auf dem
stürzen konnte, kriegte sie ihn zu fassen. »Im letzten Augenblick. Gott sei Dank!«, atmete Sophie auf. Auf dem weiteren Weg zur Tür musste sie sich mit der Linken am Küchenbüffet aufstützen und mit ihr an der Wand Halt
weiteren Weg zur Tür musste sie sich mit der Linken am Küchenbüffet aufstützen und mit ihr an der Wand Halt suchen, um nicht umzuknicken. »Wer kann das sein? Hoffentlich nicht die Feuerwehr, die Polizei! Bereits sieben – o
suchen, um nicht umzuknicken. »Wer kann das sein? Hoffentlich nicht die Feuerwehr, die Polizei! Bereits sieben – o Gott!« Sie knipste das Licht in der Küche an und blies die Kerze aus. Ron wich nicht von ihrer Seite, auch nicht, als sie
Gott!« Sie knipste das Licht in der Küche an und blies die Kerze aus. Ron wich nicht von ihrer Seite, auch nicht, als sie die Küchentür öffnete und in den Flur humpelte. Dort fiel das Tageslicht herein; es kam durch die Oberlichte der
die Küchentür öffnete und in den Flur humpelte. Dort fiel das Tageslicht herein; es kam durch die Oberlichte der breiten, wuchtigen Eichentür, die ihr Vater entworfen hatte. An ihr steckte der Schlüssel. Sophie schloss auf und
breiten, wuchtigen Eichentür, die ihr Vater entworfen hatte. An ihr steckte der Schlüssel. Sophie schloss auf und öffnete. Jener Mann vom Bautrupp, den sie am Freitag mit dem Opernglas beobachtet hatte, stand am Fuß des
öffnete. Jener Mann vom Bautrupp, den sie am Freitag mit dem Opernglas beobachtet hatte, stand am Fuß des rechten Flügels der Freitreppe. Sophie konnte über seinen Scheitel hinwegblicken. Robinson, ihr Kater, strich um
rechten Flügels der Freitreppe. Sophie konnte über seinen Scheitel hinwegblicken. Robinson, ihr Kater, strich um dessen Beine; eigentlich um die Sicherheitsschuhe und die Hosenbeine von dessen dunkelgrauer Arbeitshose. In der
dessen Beine; eigentlich um die Sicherheitsschuhe und die Hosenbeine von dessen dunkelgrauer Arbeitshose. In der Linken hielt der Mann einen gelben Bauhelm.
Linken hielt der Mann einen gelben Bauhelm.  »Gu Morng, entschuldigen Sie die Störung, doch Ihr Park… Ich glaub, am Freitoch hat er nu besser ausgsehn«,
»Gu Morng, entschuldigen Sie die Störung, doch Ihr Park… Ich glaub, am Freitoch hat er nu besser ausgsehn«, bedauerte der Mann mit einem vagen Lächeln um den Mund.
bedauerte der Mann mit einem vagen Lächeln um den Mund.  »O Gott, ich bin noch nicht mal angezogen, und mein Bein, es ist mir eingeschlafen!«, klagte Sophie. Der Mann
»O Gott, ich bin noch nicht mal angezogen, und mein Bein, es ist mir eingeschlafen!«, klagte Sophie. Der Mann errötete und fügte unsicher hinzu: »Entschuldigen Sie nochmals, doch ich brauche Ihre Erlaubnis.«
errötete und fügte unsicher hinzu: »Entschuldigen Sie nochmals, doch ich brauche Ihre Erlaubnis.« »Meine Erlaubnis?«
»Meine Erlaubnis?« »Sie sind doch die Eigentümerin des Anwesens – hier?«
»Sie sind doch die Eigentümerin des Anwesens – hier?« »Ja, na ja, doch – eigentlich schon!«, entpuppte sich Sophie als Spielball ihrer Ratlosigkeit.
»Ja, na ja, doch – eigentlich schon!«, entpuppte sich Sophie als Spielball ihrer Ratlosigkeit. »Wir wolln ufanga – Sie wissn schouh: Termine! Doch die drei Baijm, der Zaun…«
»Ist´s so schlimm?«
»A wo!«
»In drei Minuten bin ich draußen bei Ihnen!«
»Wir wolln ufanga – Sie wissn schouh: Termine! Doch die drei Baijm, der Zaun…«
»Ist´s so schlimm?«
»A wo!«
»In drei Minuten bin ich draußen bei Ihnen!«  Ihres Pyjamas hatte sich Sophie wenige Sekunden später entledigt. Kaum länger brauchte sie zum Zähneputzen und
Ihres Pyjamas hatte sich Sophie wenige Sekunden später entledigt. Kaum länger brauchte sie zum Zähneputzen und Waschen des Gesichts. Im Nu war sie auch in ihre Unterwäsche, in ihre blaue Lieblingsjeans geschlüpft, hatte sich
Waschen des Gesichts. Im Nu war sie auch in ihre Unterwäsche, in ihre blaue Lieblingsjeans geschlüpft, hatte sich nicht minder rasch für eine ihrer dunklen Blusen, für ihren ziegelroten Pullover sowie ihre hellbraunen Allzweckschuhe
nicht minder rasch für eine ihrer dunklen Blusen, für ihren ziegelroten Pullover sowie ihre hellbraunen Allzweckschuhe entschieden. Mit Vorliebe trug sie diese Sachen im Haus und draußen im Park. So gekleidet hörte sie nicht einmal von
entschieden. Mit Vorliebe trug sie diese Sachen im Haus und draußen im Park. So gekleidet hörte sie nicht einmal von ihrer Mutter ein kritisches Wort. So konnte sie jederzeit vor die Tür und zu Fuß in der Bäckerei am Romanplatz und der
ihrer Mutter ein kritisches Wort. So konnte sie jederzeit vor die Tür und zu Fuß in der Bäckerei am Romanplatz und der Metzgerei in der Hirschgartenallee einkaufen oder mit dem Auto zum Supermarkt fahren, um größere Anschaffungen
Metzgerei in der Hirschgartenallee einkaufen oder mit dem Auto zum Supermarkt fahren, um größere Anschaffungen zu tätigen. Doch dann warf sie einen Blick in den Spiegel. »O Gott, wie ich aussehe – schrecklich!«
zu tätigen. Doch dann warf sie einen Blick in den Spiegel. »O Gott, wie ich aussehe – schrecklich!« Während sie sich schminkte, fragte sie sich, warum sie sich schminke. »Werde ich etwa in einen meiner Hosenanzüge
schlüpfen oder eins meiner Kostüme anziehen, weil´s zur Arbeit ins Ministerium geht, um damit meiner
Während sie sich schminkte, fragte sie sich, warum sie sich schminke. »Werde ich etwa in einen meiner Hosenanzüge
schlüpfen oder eins meiner Kostüme anziehen, weil´s zur Arbeit ins Ministerium geht, um damit meiner Unscheinbarkeit, die mir Mutter attestiert, Paroli zu bieten?« Dazu gehörte, dass sie auch noch zu einem ihrer
Unscheinbarkeit, die mir Mutter attestiert, Paroli zu bieten?« Dazu gehörte, dass sie auch noch zu einem ihrer Parfumflakons griff und sich betupfte. Das wollte sie an diesem frühen Morgen unterlassen. »Auf jeden Fall!«, betonte
Parfumflakons griff und sich betupfte. Das wollte sie an diesem frühen Morgen unterlassen. »Auf jeden Fall!«, betonte sie. Doch auf dem Weg aus dem Bad machte sie kehrt und betupfte kopfschüttelnd rechts und links ihren Hals und
sie. Doch auf dem Weg aus dem Bad machte sie kehrt und betupfte kopfschüttelnd rechts und links ihren Hals und ihre Bluse oberhalb der Brust mit Parfum, wobei sie den V-Ausschnitt ihres Pullovers lupfte. »Tue ich das, um den
ihre Bluse oberhalb der Brust mit Parfum, wobei sie den V-Ausschnitt ihres Pullovers lupfte. »Tue ich das, um den Anblick des Chaos im Park hinauszuzögern?« Sie ließ diese Frage unbeantwortet. Trotzdem machte sie sich auf den
Anblick des Chaos im Park hinauszuzögern?« Sie ließ diese Frage unbeantwortet. Trotzdem machte sie sich auf den Weg dorthin. Ron wartete an der Haustür. Er blickte zu ihr hinauf und maulte. Sophie kehrte um. Der Hund folgte ihr.
Weg dorthin. Ron wartete an der Haustür. Er blickte zu ihr hinauf und maulte. Sophie kehrte um. Der Hund folgte ihr. Zurück im Bad wollte sie im Spiegelschrank nach ihrem Abschminkwasser greifen. Aber Sophie fand es in den Reihen
Zurück im Bad wollte sie im Spiegelschrank nach ihrem Abschminkwasser greifen. Aber Sophie fand es in den Reihen der Fläschchen, Tuben und Döschen nicht. Trotzdem zweifelte sie nicht daran, dass sie mit der Nase darauf stoßen
der Fläschchen, Tuben und Döschen nicht. Trotzdem zweifelte sie nicht daran, dass sie mit der Nase darauf stoßen konnte. Sie schlug den Schrank zu und griff zum Waschlappen. Doch erst, als sie fest aufdrückte, zeigten sich in ihm
konnte. Sie schlug den Schrank zu und griff zum Waschlappen. Doch erst, als sie fest aufdrückte, zeigten sich in ihm Spuren des Make-up. Nun lief ihr Gesicht glut-rot an. »O nein!«, haderte sie mit sich. »Mach ich das wegen ihm oder
Spuren des Make-up. Nun lief ihr Gesicht glut-rot an. »O nein!«, haderte sie mit sich. »Mach ich das wegen ihm oder will ich mich nur vor dem Anblick des Chaos draußen im Park drücken?« Dagegen setzte sie, ohne dass sie es wollte,
will ich mich nur vor dem Anblick des Chaos draußen im Park drücken?« Dagegen setzte sie, ohne dass sie es wollte, sein »A wo!«. Sie wusste, dass es nur eine Floskel war, um sie zu beruhigen. Doch sie schenkte ihr Glauben, obwohl
sein »A wo!«. Sie wusste, dass es nur eine Floskel war, um sie zu beruhigen. Doch sie schenkte ihr Glauben, obwohl sie wollte, dass ihr dieses »A wo.« keinen Gedanken wert wäre. Erneut begann sie sich zu schminken. Endlich machte
sie wollte, dass ihr dieses »A wo.« keinen Gedanken wert wäre. Erneut begann sie sich zu schminken. Endlich machte sich in ihr Zufriedenheit breit, und Sophie ging mit Ron in den Park. Auf dem Gehsteig hörte sie eine Schar Männer
sich in ihr Zufriedenheit breit, und Sophie ging mit Ron in den Park. Auf dem Gehsteig hörte sie eine Schar Männer plaudern. Dann erst wagte sie nach rechts zu blicken und sah die Verwüstung, die der Gewittersturm dort hinterlassen
plaudern. Dann erst wagte sie nach rechts zu blicken und sah die Verwüstung, die der Gewittersturm dort hinterlassen hatte. »O Gott, Mutter wird der Schlag treffen!«, durchfuhr es sie. »Ausgerechnet ihre drei Lieblingsbäume. Doch
hatte. »O Gott, Mutter wird der Schlag treffen!«, durchfuhr es sie. »Ausgerechnet ihre drei Lieblingsbäume. Doch meine Linde hat wie durch ein Wunder standgehalten.« Sophies Ziel war das Parktor. Es zu durchqueren, verhieß ihr,
meine Linde hat wie durch ein Wunder standgehalten.« Sophies Ziel war das Parktor. Es zu durchqueren, verhieß ihr, auch den Capo zu treffen. Zigarettenrauch schwadete zu ihr herüber. Und sie wollte sagen: »Nun hat es doch etwas
auch den Capo zu treffen. Zigarettenrauch schwadete zu ihr herüber. Und sie wollte sagen: »Nun hat es doch etwas länger gedauert.« Doch sie konnte den Mann, jenen Mann, den sie fortwährend im Kopf hatte, weder in der Gruppe
länger gedauert.« Doch sie konnte den Mann, jenen Mann, den sie fortwährend im Kopf hatte, weder in der Gruppe der plaudernden und rauchenden Arbeiter entdecken noch entlang der Nibelungenstraße, wohin ihr Auge sich stahl.
der plaudernden und rauchenden Arbeiter entdecken noch entlang der Nibelungenstraße, wohin ihr Auge sich stahl. Nun sprachen die Blicke der Bauarbeiter davon, wonach die ihrigen suchten. Denn einer von ihnen sagte: »I bin d
Nun sprachen die Blicke der Bauarbeiter davon, wonach die ihrigen suchten. Denn einer von ihnen sagte: »I bin d Hans. D Fritz – unser Capo – hat schnell af a andre Bauschtö gmyjsst.« Sophie wäre am liebsten ins Haus
Hans. D Fritz – unser Capo – hat schnell af a andre Bauschtö gmyjsst.« Sophie wäre am liebsten ins Haus zurückgerannt, hätte sich auf ihr Bett schmeißen und heulen wollen. Da kam einer von den anderen Arbeitern auf sie
zurückgerannt, hätte sich auf ihr Bett schmeißen und heulen wollen. Da kam einer von den anderen Arbeitern auf sie zu. Er erweckte den Anschein, als wollte er ihr etwas sagen; doch stattdessen griff er nach einer Schaufel, die an
zu. Er erweckte den Anschein, als wollte er ihr etwas sagen; doch stattdessen griff er nach einer Schaufel, die an einem der Bäume lehnte; sie beschatteten streckenweise den Gehsteig und die Straße. Dann vernahm Sophie von
einem der Bäume lehnte; sie beschatteten streckenweise den Gehsteig und die Straße. Dann vernahm Sophie von Hans, dass er sie im Auftrag des Capos fragen solle, ob sie ihnen erlaube, ihren Park zu betreten. »Dies wah am
Hans, dass er sie im Auftrag des Capos fragen solle, ob sie ihnen erlaube, ihren Park zu betreten. »Dies wah am gscheitastn. Dann kanntn wir nemli die drei Baijm dao oseng, die d Sturm umgschmissn hoat, und sie mit de Krona,
gscheitastn. Dann kanntn wir nemli die drei Baijm dao oseng, die d Sturm umgschmissn hoat, und sie mit de Krona, die am Gehsteig liegn, af Ihr Grundstück rucka.«
die am Gehsteig liegn, af Ihr Grundstück rucka.«  »Tatsächlich, ja!«, erwiderte Sophie.
»Das Stück Zaun ist eh beim Teifü. Wir legn Ihnen dieses vbogne Element in den Park und schlong a poor Breder dru.
»Tatsächlich, ja!«, erwiderte Sophie.
»Das Stück Zaun ist eh beim Teifü. Wir legn Ihnen dieses vbogne Element in den Park und schlong a poor Breder dru. Dann kinna S es dweil richten lassn. Des moant d Fritz – d Capo.«
Dann kinna S es dweil richten lassn. Des moant d Fritz – d Capo.« »Sie werden es schon richtig machen, denke ich«, sagte Sophie mit erstickter Stimme. Sie wandte sich um und wollte
»Sie werden es schon richtig machen, denke ich«, sagte Sophie mit erstickter Stimme. Sie wandte sich um und wollte endlich zurück in die Villa. Dabei vergewisserte sich Hans: »Sie gem uns also die Erlaubnis, dass wir in Ihren Park
endlich zurück in die Villa. Dabei vergewisserte sich Hans: »Sie gem uns also die Erlaubnis, dass wir in Ihren Park kinna und dies dann su macha?«
kinna und dies dann su macha?« »Ja, ja!«, erwiderte Sophie.
»Ja, ja!«, erwiderte Sophie.  »Sie sehn dann schouh, wenn ma fertig san«, meinte Hans.
»Sie sehn dann schouh, wenn ma fertig san«, meinte Hans.  Sophie kehrte ins Haus zurück. Dort eilte sie schnurstracks ins Bad. Was sie im Spiegel erblickte: War das sie, ihr
Sophie kehrte ins Haus zurück. Dort eilte sie schnurstracks ins Bad. Was sie im Spiegel erblickte: War das sie, ihr Gesicht? Das Kopfschütteln, das sie sah, es würde zweifelsohne zu ihr gehören, dachte sie. Über dem Rand des
Gesicht? Das Kopfschütteln, das sie sah, es würde zweifelsohne zu ihr gehören, dachte sie. Über dem Rand des Waschbeckens hing der Waschlappen, mit dem sie sich vor nicht einmal einer Viertelstunde die Schminke aus dem
Waschbeckens hing der Waschlappen, mit dem sie sich vor nicht einmal einer Viertelstunde die Schminke aus dem Gesicht gerubbelt hatte. »Nicht einmal ausge-waschen hab ich ihn.« Das holte sie nun nach. Mit einer Mischung aus
Gesicht gerubbelt hatte. »Nicht einmal ausge-waschen hab ich ihn.« Das holte sie nun nach. Mit einer Mischung aus Weinerlichkeit und Wut wischte und rieb sie sich abermals die Schminke aus dem Gesicht. Es lief krebsrot an. Sophie
Weinerlichkeit und Wut wischte und rieb sie sich abermals die Schminke aus dem Gesicht. Es lief krebsrot an. Sophie  fragte sich, weswegen sie nicht den Spiegel zertrümmere, in dem sie das erblicke; die Badtür eintrete; die nächste
fragte sich, weswegen sie nicht den Spiegel zertrümmere, in dem sie das erblicke; die Badtür eintrete; die nächste Person anspucke, die draußen ihren Weg kreuze. Solche Verrücktheiten würden ihr nie und nimmer unterlaufen; das
Person anspucke, die draußen ihren Weg kreuze. Solche Verrücktheiten würden ihr nie und nimmer unterlaufen; das wusste sie. Doch in diesem Augenblick war sie keineswegs stolz darauf; ihr Anstand erschien ihr lästig.
»Das hab ich nun davon. So kann ich nicht einmal zum Metzger und Bäcker, um ihnen eine Brotzeit zu holen, ja«,
wusste sie. Doch in diesem Augenblick war sie keineswegs stolz darauf; ihr Anstand erschien ihr lästig.
»Das hab ich nun davon. So kann ich nicht einmal zum Metzger und Bäcker, um ihnen eine Brotzeit zu holen, ja«, schimpfte sie mit sich. »Ich bin so … eine Idiotin!« Diese abschätzige Selbstbezichtigung, an die sie nicht glaubte,
schimpfte sie mit sich. »Ich bin so … eine Idiotin!« Diese abschätzige Selbstbezichtigung, an die sie nicht glaubte, schien für jeden Gedanken zu stehen, der ihr in diesen Minuten zuflog. Wehrlos war sie gegen diese Zudringlichkeiten
schien für jeden Gedanken zu stehen, der ihr in diesen Minuten zuflog. Wehrlos war sie gegen diese Zudringlichkeiten aus sich selbst, mit denen sie sich fortwährend ertappte. Warum ging in ihr plötzlich die Frage vor, ob Fritz einen
aus sich selbst, mit denen sie sich fortwährend ertappte. Warum ging in ihr plötzlich die Frage vor, ob Fritz einen Ehering trage. »Ich hätte darauf achten sollen, ja«, sagte sie sich. »Doch trägt man auf dem Bau überhaupt einen
Ehering trage. »Ich hätte darauf achten sollen, ja«, sagte sie sich. »Doch trägt man auf dem Bau überhaupt einen Ring? Könnte das nicht bei der Arbeit gefährlich werden? Warum lasse ich es zu, dass ich ihn mit ›Fritz‹ konkretisiere?
Ring? Könnte das nicht bei der Arbeit gefährlich werden? Warum lasse ich es zu, dass ich ihn mit ›Fritz‹ konkretisiere? Wenn, möchte ich ›Friedel‹ zu ihm sagen! O nein!« erwiderte sie ihrem Spiegelbild und schrie es an. Vor der Tür hörte
Wenn, möchte ich ›Friedel‹ zu ihm sagen! O nein!« erwiderte sie ihrem Spiegelbild und schrie es an. Vor der Tür hörte sie Rons verhaltenen Beller. »Wenn ich den nicht hätte?!«, dachte sie und mit einem Schmunzeln um den Mund ging
sie Rons verhaltenen Beller. »Wenn ich den nicht hätte?!«, dachte sie und mit einem Schmunzeln um den Mund ging sie zu ihm. »Komm!« Ron lief ins Wohnzimmer voraus. Vom Park drangen das Knattern und Heulen von Motorsägen
sie zu ihm. »Komm!« Ron lief ins Wohnzimmer voraus. Vom Park drangen das Knattern und Heulen von Motorsägen zu ihr, ab und an auch das laute, eintönige Brummen eines Baggers. Mit einem Blick aus dem Fenster hätte sie das
zu ihr, ab und an auch das laute, eintönige Brummen eines Baggers. Mit einem Blick aus dem Fenster hätte sie das Bild, das diese Geräusche ihr zutrugen, auf seine Richtigkeit überprüfen können. Doch sie widerstand dieser
Bild, das diese Geräusche ihr zutrugen, auf seine Richtigkeit überprüfen können. Doch sie widerstand dieser Versuchung, die sie mehr beängstigend als drängend in sich spürte. Auf dem Sofa liegend suchte ihre Rechte nach
Versuchung, die sie mehr beängstigend als drängend in sich spürte. Auf dem Sofa liegend suchte ihre Rechte nach Ron, der sich auf den Teppich gelegt hatte. Da Sophie nicht sofort den Hund ertastete, drehte sie sich auf die Seite. Der
Border-Collie lag unter dem Couchtisch. Er war mehr als einen Meter von ihr entfernt. »Na, komm schon!« Ron blickte
Ron, der sich auf den Teppich gelegt hatte. Da Sophie nicht sofort den Hund ertastete, drehte sie sich auf die Seite. Der
Border-Collie lag unter dem Couchtisch. Er war mehr als einen Meter von ihr entfernt. »Na, komm schon!« Ron blickte auf, doch er rührte sich nicht von der Stelle. Nach einer Weile legte er seinen Kopf wieder zwischen die Vorderpfoten.
auf, doch er rührte sich nicht von der Stelle. Nach einer Weile legte er seinen Kopf wieder zwischen die Vorderpfoten. »Bist du eifersüchtig, Ron?« Kein Laut entwich ihm.
»Bist du eifersüchtig, Ron?« Kein Laut entwich ihm.  ... Sie wollte ihren Blick abwenden, die Augen schließen und doch schauen; – die zersplitterten Dachlatten, die aus
... Sie wollte ihren Blick abwenden, die Augen schließen und doch schauen; – die zersplitterten Dachlatten, die aus ihren Verzapfungen gerissenen Balken, die ramponierten Dächer, die entwurzelten Bäume, den beschädigten Zaun
ihren Verzapfungen gerissenen Balken, die ramponierten Dächer, die entwurzelten Bäume, den beschädigten Zaun sehen und doch nicht sehen; diesen gespenstischen Anblick als bösen Traum entlarven. »Das ist ja entsetzlich«,
sehen und doch nicht sehen; diesen gespenstischen Anblick als bösen Traum entlarven. »Das ist ja entsetzlich«, keuchte sie mit tränenerstickter Stimme.
Sie rannte zurück ins Haus. Um nicht das Opfer eines Nervenzusammenbruchs zu werden, musste sie etwas tun und
keuchte sie mit tränenerstickter Stimme.
Sie rannte zurück ins Haus. Um nicht das Opfer eines Nervenzusammenbruchs zu werden, musste sie etwas tun und rief jene Maurer-, Dachdecker- und Gartenbaubetriebe an, die schon ihr Vater mit Arbeiten beauftragt hatte. Man
rief jene Maurer-, Dachdecker- und Gartenbaubetriebe an, die schon ihr Vater mit Arbeiten beauftragt hatte. Man vertröstete sie auf die nächste, wenn nicht die übernächste Woche. Dann versuchte sie ihr Glück bei der Feuerwehr
vertröstete sie auf die nächste, wenn nicht die übernächste Woche. Dann versuchte sie ihr Glück bei der Feuerwehr und hörte, man wolle in einigen Tagen die Schäden provisorisch mit Planen abdecken. Sophie war verzweifelt. Sie
und hörte, man wolle in einigen Tagen die Schäden provisorisch mit Planen abdecken. Sophie war verzweifelt. Sie blickte auf die Uhr. »Bald neun«, sagte sie vor sich hin und schaltete in der Küche das Radio ein. Der Wetterbericht
blickte auf die Uhr. »Bald neun«, sagte sie vor sich hin und schaltete in der Küche das Radio ein. Der Wetterbericht meldete bereits für Donnerstag wieder Gewitter und Starkregen. Sie wunderte sich, dass ihre Mutter noch nicht
meldete bereits für Donnerstag wieder Gewitter und Starkregen. Sie wunderte sich, dass ihre Mutter noch nicht angerufen hatte. »Ihr entgeht keine Nachrichtensendung. Vielleicht war es diesmal anders. Ich wüsste nicht, wie ich ihr
angerufen hatte. »Ihr entgeht keine Nachrichtensendung. Vielleicht war es diesmal anders. Ich wüsste nicht, wie ich ihr diese schlimmen Schäden verheimlichen oder erklären könnte.« Erneut ging sie nach draußen. Beim Anblick des
diese schlimmen Schäden verheimlichen oder erklären könnte.« Erneut ging sie nach draußen. Beim Anblick des Durcheinanders weinte sie abermals. Plötzlich stand der Capo vor ihr. Wie aus dem Nichts war er vor ihr aufgetaucht.
Durcheinanders weinte sie abermals. Plötzlich stand der Capo vor ihr. Wie aus dem Nichts war er vor ihr aufgetaucht. In den letzten Minuten hatte sie nicht mehr an ihn gedacht. Nun wurde sie für Augenblicke von purer Verzweiflung
In den letzten Minuten hatte sie nicht mehr an ihn gedacht. Nun wurde sie für Augenblicke von purer Verzweiflung  beherrscht. Vor allem, weil er sie in diesem Zustand überraschte – sie weinen sah. Doch kaum weniger, weil sie sich
beherrscht. Vor allem, weil er sie in diesem Zustand überraschte – sie weinen sah. Doch kaum weniger, weil sie sich ihm in all ihrer Unscheinbarkeit ausgeliefert glaubte. »Ich dumme Kuh, warum hab ich mich abgeschminkt, warum
ihm in all ihrer Unscheinbarkeit ausgeliefert glaubte. »Ich dumme Kuh, warum hab ich mich abgeschminkt, warum nur?« Dann begann er zu reden, und sie fühlte sich besser. »Schlimmer als ich zunächst dachte«, sagte er im
nur?« Dann begann er zu reden, und sie fühlte sich besser. »Schlimmer als ich zunächst dachte«, sagte er im Unterton einer Herausforderung. Sophie hing an seinen Lippen und brachte kein Wort heraus. »Die Schäden sind
Unterton einer Herausforderung. Sophie hing an seinen Lippen und brachte kein Wort heraus. »Die Schäden sind nicht allgemein, sondern vereinzelt wie hintupft – dao amal und dao amal. Der Strom war auch länger weg, ho i ghört.
nicht allgemein, sondern vereinzelt wie hintupft – dao amal und dao amal. Der Strom war auch länger weg, ho i ghört. Beim Umspannwerk draußen solln wie hier die Fetzen gflung seij«, erzählte der Capo. »Er hatte hier freie Bahn, der
Beim Umspannwerk draußen solln wie hier die Fetzen gflung seij«, erzählte der Capo. »Er hatte hier freie Bahn, der Sturm; in der ganzen Umgebung nur hier; wahrscheinlich eine Windhose von vierzig, fünfzig Metern Breite«, erklärte
Sturm; in der ganzen Umgebung nur hier; wahrscheinlich eine Windhose von vierzig, fünfzig Metern Breite«, erklärte der Capo und schilderte im selben Atemzug mit seinen Händen und Armen den Zug des Unwetters von Westen nach
der Capo und schilderte im selben Atemzug mit seinen Händen und Armen den Zug des Unwetters von Westen nach Osten. »Ich muss mich noch bei Ihnen bedanken!«, fuhr er fort. »Hätten Sie uns nicht in Ihren Park gelassen, hätten
Osten. »Ich muss mich noch bei Ihnen bedanken!«, fuhr er fort. »Hätten Sie uns nicht in Ihren Park gelassen, hätten wir wahrscheinlich erst morgen draußen mit dem Ausheben des nächsten Teilstücks beginnen können. Vielleicht
wir wahrscheinlich erst morgen draußen mit dem Ausheben des nächsten Teilstücks beginnen können. Vielleicht können wir uns revanchieren?« Sophie war verblüfft. »Revanchieren?«, dachte sie und ihre Wortlosigkeit gab
können wir uns revanchieren?« Sophie war verblüfft. »Revanchieren?«, dachte sie und ihre Wortlosigkeit gab gleichzeitig ihre Verwirrtheit und Ratlosigkeit wider. »Vielleicht können wir ja etwas für Sie tun.« Während der Capo
gleichzeitig ihre Verwirrtheit und Ratlosigkeit wider. »Vielleicht können wir ja etwas für Sie tun.« Während der Capo das sagte, streifte sein Blick die Verwüstung im Park und an den Gebäuden. Sophie nickte. In ihrer Verlegenheit
das sagte, streifte sein Blick die Verwüstung im Park und an den Gebäuden. Sophie nickte. In ihrer Verlegenheit lächelte sie zaghaft. Das bemerkte der Capo. »Schwül ist´s wieder geworden, und diese stechende Sonne verheißt
lächelte sie zaghaft. Das bemerkte der Capo. »Schwül ist´s wieder geworden, und diese stechende Sonne verheißt nichts Gutes. Übrigens, Fink, Friedrich.« Während er das sagte, streckte er ihr seine Rechte hin. Sophie glaubte in ihrer
Hand etwas unglaublich Zupackendes und Vertrauenswürdiges zu spüren. Nach einer Weile erwiderte sie: »Sophie
nichts Gutes. Übrigens, Fink, Friedrich.« Während er das sagte, streckte er ihr seine Rechte hin. Sophie glaubte in ihrer
Hand etwas unglaublich Zupackendes und Vertrauenswürdiges zu spüren. Nach einer Weile erwiderte sie: »Sophie Reischl.« Dabei errötete sie und fügte hinzu: »Es ist tatsächlich sehr schwül. Und ich hab einen Pullover an –
Reischl.« Dabei errötete sie und fügte hinzu: »Es ist tatsächlich sehr schwül. Und ich hab einen Pullover an – wahrscheinlich vor Aufregung.« Der Capo lächelte, zuckte ansatzweise die Achseln, räkelte ein wenig mit den
wahrscheinlich vor Aufregung.« Der Capo lächelte, zuckte ansatzweise die Achseln, räkelte ein wenig mit den Schultern und zog an seiner Zigarette. »Wenn Sie Hilfe brauchen, dann…«, erklärte er; und seine Handbewegungen,
Schultern und zog an seiner Zigarette. »Wenn Sie Hilfe brauchen, dann…«, erklärte er; und seine Handbewegungen, die er dabei gebrauchte, schienen die Schäden in ein Paket zu schnüren.
die er dabei gebrauchte, schienen die Schäden in ein Paket zu schnüren.  »Sie könnten das tatsächlich…?« ...
»Sie könnten das tatsächlich…?« ... 3. Kapitel
Doch Sophie erschrak über das, was sie gesagt hatte. »O Gott, ich personifizierte Unromantik! Warum falle ich ihm ins
3. Kapitel
Doch Sophie erschrak über das, was sie gesagt hatte. »O Gott, ich personifizierte Unromantik! Warum falle ich ihm ins Wort und sage so etwas und nicht das, woran ich ihn am Aussprechen gehindert habe? Mir ist nicht zu helfen!«, ging
Wort und sage so etwas und nicht das, woran ich ihn am Aussprechen gehindert habe? Mir ist nicht zu helfen!«, ging sie mit sich ins Gericht und hoffte, dass er nun seinen Satz zu Ende bringen würde. Doch der Capo schwieg. Plötzlich
sie mit sich ins Gericht und hoffte, dass er nun seinen Satz zu Ende bringen würde. Doch der Capo schwieg. Plötzlich nahm er ihre Rechte, die sie intuitiv fächerte, und führte sie an seine linke Brust.
nahm er ihre Rechte, die sie intuitiv fächerte, und führte sie an seine linke Brust.